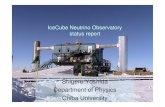ZfP Zeitschrift für Politik 3/2010 · Heinrich Oberreuter, Universität Passau; Prof. Dr. Dr....
Transcript of ZfP Zeitschrift für Politik 3/2010 · Heinrich Oberreuter, Universität Passau; Prof. Dr. Dr....

ZfP Zeitschrift für Politik 3/2010Organ der Hochschule für Politik München 57. Jahrgang
Gegründet im Jahre 1907 durch Adolf Grabowsky und Richard SchmidtSeite 241 – 360
Herausgeber: Prof. Dr. Maurizio Bach, Universität Passau; Prof. Dr. Franz Knöpfle UniversitätAugsburg; Prof. Dr. Peter Cornelius Mayer-Tasch, Universität München; Prof. Dr. Dr. h.c.Heinrich Oberreuter, Universität Passau; Prof. Dr. Dr. Sabine von Schorlemer, TechnischeUniversität Dresden; Prof. Dr. Theo Stammen, Universität Augsburg; Prof. Dr. RolandSturm, Universität Erlangen-Nürnberg; Prof. Dr. Hans Wagner, Universität München; Prof.Dr. Andreas Wirsching, Universität Augsburg; Prof. Dr. Wulfdiether Zippel, Technische Uni-versität MünchenRedaktion: Dr. Andreas Vierecke, Hochschule für Politik MünchenWissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Ulrich Beck; Prof. Dr. Alain Besançon; Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Karl Dietrich Bracher; Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Gumpel; Prof. Dr. Dr. h.c. mult. PeterHäberle; Prof. Dr. Wilhelm Hennis; Prof. Dr. Matthias Kepplinger; Prof. Dr. Peter Graf Kiel-mansegg; Prof. Dr. Dr. h.c. Gottfried-Karl Kindermann; Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Lübbe;Prof. Dr. Harvey C. Mansfield; Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin; Prof. Dr. Dr. h.c. DieterOberndörfer; Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Jürgen Papier; Prof. Dr. Fritz Plasser; Prof. Dr. RobertoRacinaro; Prof. Dr. Alois Riklin; Prof. Dr. Hans Heinrich Rupp; Prof. Dr. Manfred G.Schmidt; Prof. Dr. Charles Taylor; Prof. Dr. Barbara Zehnpfennig
InhaltSophie HaringHerrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? – Technokratie alspolitikwissenschaftliches »Problem-Ensemble« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Zum Thema: Demokratie und Parteiensystem in DeutschlandOskar NiedermayerDie Erosion der Volksparteien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Carsten ReinemannMedialisierung ohne Ende?Zum Stand der Debatte um Medieneinflüsse auf die Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Heinrich Pehle/Roland SturmDie europäische Integration – ein relevanter Bezugsrahmen des nationalenParteienwettbewerbs? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Oscar W. Gabriel/Everhard HoltmannDer Parteienstaat – ein immerwährendes demokratisches Ärgernis?Ideologiekritische und empirische Anmerkungen zu einer aktuellen Debatte . . . . 307
ForschungsnotizFrank DeckerDer Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
LiteraturberichtFelix Dirsch60 Jahre Bundesrepublik – ein Staat in guter Verfassung?Eine Literaturauswahl in der Rückschau auf die Jubiläumsjahre 2008 und 2009 . . 343
Buchbesprechungen mit Verzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
ZfP 57. Jg. 3/2010

Autoren dieses HeftesFrank Decker, Dr. rer. pol., Dipl.-Pol., Professor für Politische Wissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-versität Bonn
Felix Dirsch, Dr. phil., Dipl. sc. Pol., Dipl. Theol., Dozent an Schulen und Hochschulen sowie in der Erwachsenenbildung,Erding
Oscar W. Gabriel, Dr. phil., Professor für Politische Systeme und Politische Soziologie an der Universität Stuttgart
Sophie Haring, Dipl.-Kulturwirtin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Politikwissenschaft I der UniversitätPassau
Everhard Holtmann, Dr. phil., Professor für Systemanalyse und Vergleichende Politik an der Martin-Luther-UniversitätHalle Wittenberg
Oskar Niedermayer, Dr. phil., Professor für Politische Wissenschaft an der Freien Universität Berlin
Heinrich Pehle, Dr. phil., Professor für Politische Wissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Carsten Reinemann, Dr. phil., Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Politische Kommunikationam Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Roland Sturm, Dr. phil., Professor für Politische Wissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
ZfP Zeitschriftfür PolitikOrgan der Hochschule für Pol i t ik München
Redaktion: Dr. Andreas Vierecke, Hochschule für Politik,Ludwigstraße 8, 80539 München.Internet: www.nomos-zeitschriften.de/zfp.htmlE-Mail: [email protected]: NOMOS Verlagsgesellschaft mbH 8 Co. KG, Postfach100 310, 76484 Baden-Baden, Telefon 0 72 21 / 21 04-0, Telefax0 72 21 / 21 04-43Nachdruck und Vervielfältigung: Die Zeitschrift und alle inihr enthaltenen einzelnen Beiträge sind urheberrechtlich ge-schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Ur-heberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzu-lässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset-zungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Ver-arbeitung in elektronischen Systemen.Bezugsbedingungen: Die Zeitschrift erscheint viermal im Jahr.Jahrespreis 92,- € für Printerfassung oder Online-Zugang, 92,-€ für Printerfassung und Online-Zugang, 111,- € für Biblio-theken, Einzelheft 25,- €, für Studenten und Referendare (unterEinsendung eines Studiennachweises) 63,- €. Die Preise verste-hen sich incl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Kündigung nur vier-teljährlich zum Jahresende. Außerhalb des Abonnements er-scheinende Sonderbände gehen den Abonnenten ohne Abnah-meverpflichtung unaufgefordert zur Ansicht zu.Haftungsausschluss: Der Verlag, die Redaktion, die Heraus-geber und die Hochschule für Politik übernehmen keine Ver-antwortung für etwaige Fehler oder für irgendwelche Folgen,die sich aus der Nutzung der in dieser Zeitschrift enthaltendenInformationen ergeben. Die von den jeweiligen Autoren zumAusdruck gebrachten Standpunkte und Ansichten entsprechennicht notwendigerweise denjenigen der Hochschule für Politik,der Herausgeber, der Redaktion oder des Verlages.Anzeigen: sales_friendly, Verlagsdienstleistungen, BettinaRoos, Siegburger Straße 123, 53229 Bonn, Telefon 02 28 / 9 8798-0, Telefax 02 28 / 9 78 98-20, E-Mail: [email protected]: NOMOS Verlagsgesellschaft mbH 8 Co. KG, Post-fach 100 310, 76484 Baden-Baden, Telefon 0 72 21 / 21 04-24,Telefax 0 72 21 / 21 04-79ISSN 0044-3360
Hinweise für AutorenDie im Jahre 1907 begründete ZfP veröffent-licht neueste Forschungsergebnisse und Analy-sen (theoretische und empirische Beiträge) ausdem gesamten Spektrum der Politikwissen-schaft. Um einen hohen Qualitätsstandard zugewährleisten, unterliegen die Manuskripte ei-nem strikten Begutachtungsverfahren nach in-ternationalen Standards. Dies bedeutet u. a.,dass unaufgefordert eingereichte Manuskriptevon mindestens zwei Experten anonym begut-achtet werden. Die Manuskripte sollen der ZfP-Redaktion deshalb in digitaler Form (vorzugs-weise per E-Mail) in zweifacher Ausführungeingereicht werden, von denen eine vollständigzu anonymisieren ist, d. h. dass diese keinerleiHinweise enthalten darf, die auf die Identitätdes Verfassers schließen lassen; dies gilt auch fürVerweise im Manuskript auf andere Veröffent-lichungen des Verfassers. Zur Veröffentlichungkommen aussschließlich Originalaufsätze, dienoch in keinem anderen Publikationsorgan ver-öffentlicht worden sind und für die Dauer desBegutachtungsverfahrens auch keiner anderenZeitschrift zum Abdruck angeboten werden.
Ein Merkblatt mit Hinweisen zur Manus-kriptgestaltung kann bei der Redaktion ange-fordert oder unter der Rubrik Redaktion vonder Internetseite der ZfP (www.zeitschrift-fuer-politik.de) heruntergeladen werden.

Sophie Haring
Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? –Technokratie als politikwissenschaftliches »Problem-
Ensemble«*
1. Technokratie – ein vieldeutiger Begriff
»Das Wort ›Technokratie‹ bezeichnet günstigstenfalls ein Problem-Ensemble, und dasheißt, dass, wo es fällt, niemand von vornherein wissen kann, von welchem Problem nungenau die Rede sein soll.«1
Diese Äußerung Hermann Lübbes zur Technokratiediskussion im Deutschland dersechziger Jahre überrascht, scheint »Technokratie« doch ein eindeutig besetzter Begriffzu sein. Ein Blick in gängige Nachschlagewerke zu dem Thema aber bestätigt LübbesAussage. So definiert Dietrich Herzog den Ausdruck als »Herrschaftsform, in der nichtgewählte Repräsentanten, sondern wissenschaftlich ausgebildete Fachleute, Experten,insbesondere Techniker und Ingenieure, de facto die Entscheidungen treffen«.2 ReinhartBeck versteht unter Technokratie wiederum »ein gesamtgesellschaftliches und politi-sches System, in dem politische Entscheidungen allein nach den angeblich sachlichenErfordernissen und den Gesetzlichkeiten der modernen Technik […] getroffen wer-den«.3 Es ist unschwer zu erkennen, dass diese beiden Definitionen nicht die gleicheStoßrichtung haben, sondern im Gegenteil unterschiedliche Konzepte unter dem glei-chen Namen fassen. Auch in der spezialisierten Literatur wird der Oberbegriff auf soverschiedene Art und Weise verwendet, dass es schwierig ist, den unterschiedlichen Ar-gumentationen zu folgen.4
* Die Autorin dankt besonders Anna Iris Henkel, Irene Kögl, Mariano Barbato, Stefan Köppl,Dominik Hammer, Uwe Kranenpohl und Carsten Pietsch für konstruktive Kritik undzahlreiche hilfreiche Hinweise.
1 Hermann Lübbe, »Anmerkungen zur aktuellen Technokratiediskussion« in: Hans Lenk, (Hg.),Technokratie als Ideologie. Sozialphilosphische Beiträge zu einem politischen Dilemma, Stuttgart1973, S. 94.
2 Dietrich Herzog, »Technokratie« in: Dieter Nohlen / Rainer-Olaf Schultze, (Hg.), Lexikon derPolitikwissenschaft. Theorien – Methoden – Begriffe, Band 2, München 2004, S. 962. Hervorhe-bungen im Original.
3 Reinhart Beck, Sachwörterbuch der Politik, Stuttgart 1977, S. 853ff.4 Es gibt dementsprechend in der breit gefächerten Literatur zu den verschiedenen Technokra-
tieansätzen nur wenige Autoren, die sich um eine deutliche Begriffsdefinition bemühen. Nochgeringer ist die Anzahl derjenigen Beiträge, die den Versuch wagen, Technokratie als Phänomenin seinem gesamten Bedeutungsspektrum zu erfassen. Vgl. als Auswahl: Gottfried Rickert,Technokratie und Demokratie. Zum Technokratieproblem in der Staatstheorie einschließlich desEuroparechts, Frankfurt/Main u.a. 1983; Thomas Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik
ZfP 57. Jg. 3/2010

In diesem Beitrag sollen zwei divergierende Ansätze der Technokratietheorie, einnormativ-ideologischer sowie ein deskriptiv-analytischer, näher untersucht werden, umihre jeweiligen Implikationen für das politische System und das Regieren als Prozess derStaatsleitung und Normsetzung herausstellen zu können. Einige Überlegungen zur Ak-tualität der so dargestellten Ideen und ihrer Konsequenzen für das Regieren im modernenStaat bilden den Abschluss.
2. Der utopische Entwurf : Technokratie als Expertokratie
In seiner normativ-ideologischen Verwendung bezeichnet der Begriff Technokratie alljene utopischen Programme, die eine »grundlegend[e] Umstrukturierung politischerHerrschaft«5 zugunsten einer Herrschaft der Experten fordern. So beschreibt JacquesEllul Technokratie als »Herrschaft einer kleinen Gruppe ›technischer Gebildeter‹«,6 all-gemeiner noch skizziert Frank Fischer die Zielvorstellung der technokratischen Utopienals »a system of governance in which technically trained experts rule by virtue of theirspecialized knowledge and position in dominant political and economic institutions«.7
Wiederum bleiben beide Definitionen vage, vor allem in Bezug auf die genaue Qualifi-kation der Experten. Gerade diese Definition des zur Herrschaft Bestimmten ist es je-doch, welche die verschiedenen normativen Technokratietheorien voneinander unter-scheidet, wohingegen das Staatsmodell bei allen Theorien weitestgehend übereinstimmt.
Eben diese grundlegende gemeinsame Vorstellung soll im Folgenden kurz umrissenwerden, wobei zur Illustration des Ansatzes zwei Vordenker der technokratischen Herr-schaftsform dienen können: Zum einen die Ideen des französischen Comte Claude-Henride Saint-Simon (1760 – 1825), der nicht nur als Vorläufer der technokratischen Staatsidee,sondern sogar als deren Gründer gelten kann.8 Desweiteren untersucht werden sollendie Ideen Thorstein Veblens (1857-1929), dessen Werk The Engineers and the Price Sys-tem9 als »Pionierwerk der Technokratie im engeren Sinne«10 gesehen werden kann.
und das Verschwinden der Gesellschaft. Zur Diskussion um das andere politische Projekt derModerne«, in: Michael Greven, (Hg.), Politikwissenschaft als Kritische Theorie: Festschrift fürKurt Lenk, Baden-Baden 1994, S. 353-386; sowie der gesamte von Hans Lenk herausgegebeneBand Technokratie als Ideologie, aaO (FN 1).
5 Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft. Zur Dis-kussion um das andere politische Projekt der Moderne«, aaO. (FN 4), S. 355.
6 Rickert, Technokratie und Demokratie. Zum Technokratieproblem in der Staatstheorie ein-schließlich des Europarechts, aaO. (FN 4), S. 9.
7 Frank Fischer, Technocracy and the politics of expertise, London u.a. 1990, S.17. Bei dieserPublikation handelt es sich um einen der neueren Beiträge zur Technokratiediskussion, derinteressante Aspekte bedenkt, die in den »älteren« Diskussionen noch kein Thema sein konnten– vor allem, wenn es um die Implikationen des Internets für das Regierungshandeln und diepolitische Kommunikation geht.
8 Vgl. Rickert, Technokratie und Demokratie, aaO. (FN 4), S. 36 f.9 Thorstein Veblen, The Engineers and the price system, New York 1921.
10 Hans Lenk, »›Technokratie‹ als gesellschaftskritisches Klischee« in: ders. (Hg.), Technokratieals Ideologie, aaO. (FN 1), S.10.
244 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 244

2.1 Ineffiziente Herrschaft als Krisenherd: politics of power
Technokratie als neues Ordnungsprogramm im Staat entspringt »Situationen, in denengenuin gesellschaftliche Institutionen in eine Krise geraten«11 zu sein scheinen. Sie wirdalso gedacht als Antwort auf ein Herrschaftssystem, das den Notwendigkeiten der mo-dernen Gesellschaft nicht mehr gerecht werden kann.
Diese bestehenden Verhältnisse sind verdichtet in den politics of power,12 der Herr-schaft interessengeleiteter Eliten, die weder einer ausreichenden (technischen) Rationa-lität verhaftet sind, noch über das notwendige Wissen oder die Ausbildung verfügen, umden modernen Staat zu lenken.
Saint-Simon spricht daher von einem Zustand »parasitären und unproduktiven Da-seins«,13 und bemerkt: »Es sind an allen Stellen die Unfähigen, die mit der Leitung derFähigen betraut sind«.14 Noch deutlicher werden seine Wertvorstellungen, wenn er vonder »›antinationalen‹ Partei der Unproduktiven«15 schreibt: Zu dieser zählt er neben de-nen, die ausschließlich konsumieren, auch jene, die der Produktion und den für dieseVerantwortlichen mit ihrer Politik schaden,16 und eben jene erkennt er in den herrschen-den Eliten, die das Volk bestehlen.17
Auch Veblen orientiert sich in seiner Kritik an den bestehenden Verhältnissen deutlicham Zustand des produktiven Sektors, wobei bei ihm die Verwendung der hierfür be-grenzt zur Verfügung stehenden Mittel und die damit verbundene Effizienz im Mittel-punkt seiner Analyse stehen. Dies wird deutlich, wenn er feststellt, dass die »captains ofindustry«18 – welche sich aus Besitzern und Managern rekrutieren, nicht aber aus derGruppe der dafür ausgebildeten Techniker – eine Politik verwirklichen, welche negative
11 Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«, aaO.(FN 4), S. 361. Es sei darauf hingewiesen, dass Saint-Simon seine Technokratie als Kritik an derpostrevolutionären Gesellschaft entworfen hat, während Veblen auf die »Great Depression«und ihre Folgen reagierte; vgl. auch: Pietro Morandi, »Zur Geschichte der Technokratie« in:Berliner Debatte Initial, Bd. 3 (1997), Berlin, S. 117-126.
12 Vgl. Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«,aaO. (FN 4), S. 357. Das Begriffspaar politics of power und politics of ability stammt von GhitaIonescu. Er führt es in seinem 1976 erschienenen Werk The Political Thought of Saint-Simon,London (u.a.), ein.
13 Rickert, Technokratie und Demokratie, aaO. (FN 4), S. 39.14 Claude-Henri de Saint-Simon, »Erster Auszug aus dem Organisator«, in: Thilo Ramm, (Hg.),
Der Frühsozialismus, Quellentexte, Stuttgart 1965, S.87.15 Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«, aaO.
(FN 4), S. 356.16 Vgl. Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«,
aaO. (FN 4), S. 356.17 Zum Bild, das Saint-Simon von den Herrschern seiner Zeit zeichnet, vgl. v.a. Rickert, Tech-
nokratie und Demokratie, aaO. (FN 4), S. 33-35.18 So bezeichnet er die bestimmenden Kräfte der industriellen produktiven Industrie, welche er
in den absentee owners und ihren Managern identifiziert. Er kritisiert, dass diese Laien seienim Bezug auf die Prozesse, die sie lenken und über die sie bestimmen können, und darum –und aus Profitgründen – eine effektive Produktionspolitik verhinderten. Diese Kritik wirdbesonders deutlich in »The Industrial System and the Captains of Industry«, in: Veblen, TheEngineers and the price system, aaO. (FN 9), S. 27-51.
245 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 245
ZfP 57. Jg. 3/2010

Folgen gezeitigt habe: »The result has been an ever increasing volume of waste and mis-direction in the use of equipment, resources, and man power throughout the industrialsystem«.19 Er begründet diese Analyse damit, dass die ausschließlich an der Mehrungihres eigenen Gewinns interessierten Vertreter der herrschenden und besitzenden Klassedie Produktion von Gütern stark verringerten, statt die Produktionsmethoden zu ver-bessern.20 In gleicher Weise sieht er die Rolle der Politiker im bestehenden System durchnationalistische Ideen negativ beeinflusst: »And all the while the statesmen are at workto divert and obstruct the working forces of this industrial system […] for the specialadvantage of one nation […]«.21 Veblens Herrschaftskritik ist demnach eine »Ver-schwendungskritik«,22 in der er das Handeln der herrschenden Eliten als egoistisch undzerstörerisch begreift.
2.2 Expertenherrschaft als Ausweg aus der Krise: politics of ability
Dem negativen Bild der politics of power setzen die utopischen Vordenker der Techno-kratie ein Idealbild der Herrschaft durch eine Gruppe gebildeter und vor allem technisch-wissenschaftlich qualifizierter Experten entgegen. Diese seien durch ihre ausschließlicheOrientierung an wissenschaftlichen, objektiven Variablen frei von korrumpierenden Ei-geninteressen und garantierten darum eine möglichst umfassende Verwirklichung desallgemeinen Wohls.23
Saint-Simon leitet diese Idee in einem Gedankenspiel nach Art der Parabel ein, in wel-cher er zunächst die Wertigkeit der verschiedenen Eliten hervorhebt. So stellt er die Fra-ge, welche Konsequenzen es habe, wenn die (französische) Nation auf einen Schlag dieherrschende Elite oder aber die Spitze ihres produktiven Sektors, also »Wissenschaftler,Techniker, Ökonomen und Handwerker«24 verlöre. Im ersten Falle geht er davon aus,dass dieser Verlust dem Volk »nur […] Schmerzen bereit[e], denn es entstünde hierauskein politisches Unglück für den Staat«.25 Im Fall der wissenschaftlich-technischen Elitehingegen benötige das Land mindestens eine Generation, um den Verlust wieder auszu-gleichen. Konsequent denkt er dieses Schema zu Ende, wenn er in der Folge einen idealenStaat entwirft, in welchem die Verwaltungs- und Leitungsaufgaben den Industriellen,
19 Veblen, The Engineers and the price system, aaO. (FN 9), S. 43.20 »[I]t has become the ordinary duty of the corporate management to adjust production to the
requirements of the market by restricting the output to what the traffic will bear […].«, Veblen,The Engineers and the price system, aaO. (FN 9), S. 38.
21 Veblen, The Engineers and the price system, aaO. (FN 9), S. 54.22 Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«, aaO.
(FN 4), S. 360. Dies ist ein Ansatz, der sich wohl aus der schwierigen gesellschaftlichen undwirtschaftlichen Situation der USA nach der Weltwirtschaftskrise heraus erklärt.
23 So erläutert es Fischer: »The public interest is said to be safeguarded by the ›impartial con-science‹ and ›neutral competence‹ of the technical expert«. Fischer, Technocracy and the politicsof expertise, aaO. (FN 7), S. 24.
24 Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«, aaO.(FN 4), S. 356.
25 Saint-Simon bei Ramm, Der Frühsozialismus, aaO. (FN 22), S. 29.
246 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 246

unterstützt durch ein System von Fachräten aller Richtungen, übertragen werden.26 Inden Vorschlägen Saint-Simons konkretisiert sich eine meritokratische Vorstellung, nachder jeder Klasse der Rang zukommt, der ihr gemäß ihres Verdienstes für die Gesellschaftzustehen sollte. Es kommt so zu einer Herrschaft der Industriellen, wobei diese der ge-samten Gruppe der »Produktiven« vorstehen.
Eine solche Vormacht der Industriellen gegenüber den Technikern und Ingenieurenist hingegen genau das Strukturelement der modernen Gesellschaft, das Veblen kritisiert.Er fordert stattdessen eine Ablösung der »captains of industry and finance« durch die antechnischer Rationalität orientierten Ingenieure und Techniker. Allein deren Führer-schaft könne ein funktionierendes Produktionswesen zum Wohle der Allgemeinheit ga-rantieren: »The material welfare of the community is unreservedly bound up with thedue working of this industrial system, and therefore with its unreserved control by theengineers, who are alone competent to manage it«. 27 Um diese Herrschaft der technisch-wissenschaftlichen Elite zu verwirklichen, schlägt er einen »practicable soviet of techni-cians«28 vor. Veblen hat damit ein erstes Modell einer Expertokratie, in welcher sich dieHerrschaft aus der wissenschaftlich-technischen Ausbildung ableitet, entworfen.
2.3 Herrschaft und Politik in der Expertokratie
Bei den hier vorgestellten klassischen utopischen Technokratietheorien wird Herrschaftnoch im herkömmlichen Sinne eines Unterwerfungsgefüges zwischen Menschen defi-niert: Die herrschende Gruppe befiehlt, die Beherrschten haben ihr Folge zu leisten. Po-litik als eigenständiges System mit einer ihr eigenen Logik und Funktionsweise – welchein ihrer Wirkung als durchweg negativ bewertet werden – wird damit zwar abgeschafft,bleibt aber im staatlichen Grundphänomen der Herrschaft doch bestehen. Neu ist dabeiauf den ersten Blick vor allem die Rollenverteilung, insbesondere bezüglich der Rekru-tierung der Herrschenden aus einer Gruppe besonders technisch Ausgebildeter. Die uto-pischen Programme einer Expertokratie sind damit Elitetheorien.29
Neu ist zudem ein weiterer zentraler Punkt: Neben einer neuen Herrschaftsordnungund der Genese einer neuen Elite wird in diesen Theorien auch und vor allem ein neuesLegitimationsprinzip geschaffen, nämlich die Begründung der Herrschaft durch den»produktive[n] Beitrag zu nationalem Wohlstand und nationaler Konkurrenzfähig-
26 Vgl. Rickert, Technokratie und Demokratie, aaO. (FN 4), S. 35-37.27 Veblen, The Engineers and the price system, aaO. (FN 9), S. 69.28 So der Titel des Aufsatzes, in dem Veblen am deutlichsten auf die Organisationsform der Re-
gierung in der von ihm entworfenen Utopie eingeht: »A Memorandum on a Practicable Sovietof Technicians«. In der Wortwahl des Soviet spiegelt sich die Verwandtschaft der technokra-tischen Utopien mit den sozialistischen und kommunistischen Ideen, welche unter anderemauch in der Herrschaftskritik Saint-Simons deutlich zu erkennen ist. Vgl. hierzu bes. Rickert,Technokratie und Demokratie, aaO. (FN 4), S. 39 – 45.
29 Vgl. Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«,aaO. (FN 4), S. 360.
247 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 247
ZfP 57. Jg. 3/2010

keit«.30 Die Frage, inwiefern diese Form der Legitimation mit den demokratischen Vor-stellungen moderner Gesellschaften vereinbar ist, stellt sich als zentrales Problem derTechnokratiediskussion dar und soll an einem späteren Punkt noch thematisiert werden.
Festzuhalten bleibt bei diesen Ansätzen, dass es sich um Entwürfe für eine staatlicheOrdnung handelt, welche die Herrschaft auf eine Gruppe wissenschaftlich-technischHochqualifizierter übertragen wollen. Dieser Ansatz erklärt sich vor allem aus den Kri-sen, die den Hintergrund der Entstehung dieses Konzepts bilden und die vor allem zueiner harschen Kritik der bestehenden Verhältnisse geführt haben. Zielvorstellung einersolchen Umgestaltung ist der produktivere und effektivere »Zustand einer rein rationalenVerwaltung von Sachen«.31
2.4 Kritische Würdigung der Expertokratie
Einige der grundlegenden Probleme der technokratischen Utopien und ihrer – soweitüberhaupt möglichen – Umsetzung sollen im Folgenden offen gelegt und diskutiert wer-den. In manchen Punkten ist die Problematik der Ansätze diesen selbst immanent, ergibtsich damit aus einer kritischen Auseinandersetzung mit ihrem Inhalt, in anderen Aspek-ten soll hier auf die Versuche der Umsetzung technokratischer Herrschaft zumindesthingewiesen werden.32
Zunächst einmal ist es fraglich, ob sich auf lange Sicht eine ideologisch und von derQualifikation her homogene Gruppe von Experten bilden ließe, die zwar auf der einenSeite vollkommen frei von Eigeninteressen die Aufgaben der politischen Elite im Staatübernehmen könnte, andererseits aber auch die nötige Motivation zu einer Umgestaltungder staatlichen Herrschaft aufbrächte. Diesem Problem begegnet Veblen, wenn er ver-gebens zur Gründung des Technikerrates aufruft: Ebenso wie Saint-Simon unterstellt erzwar, dass sich aus der (technischen) Qualifikation auch die Motivation zur Machtüber-nahme ergebe, wird aber von den Technikern seiner Zeit enttäuscht.33
Zudem stellt sich die Frage, ob eine Herrschaft der Experten tatsächlich die effizien-teste und damit für das Gemeinwohl beste Lösung garantiert. Diese Behauptung impli-
30 Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«, aaO.(FN 4), S. 356.
31 Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«, aaO.(FN 4), S. 360.
32 Es werden dazu zwei beispielhafte Fälle zitiert: Zum einen die US-amerikanische Bewegungder technocrats, die sich als Reaktion auf die Thesen Veblens etablierte. Zum anderen ist ein inder Literatur immer wieder angeführtes Beispiel technokratischer Regierungsführung daswirtschaftspolitische Handeln in Chile unter General A. Pinochet, das in erster Linie von densog. ODEPLAN Boys nach den Kriterien der neoliberalen Chicagoer Schule gestaltet wurde.Vgl. dazu i. E. Carlos Huneeus, »Technocrats and politicians in an authoritarian regime. The›ODEPLAN Boys‹ and the ›Gremialists‹ in Pinochet’s Chile« in: Journal of Latin AmericanStudies, Bd 32, H 2 (2000), S. 461-502, sowie die betreffenden Ausschnitte in: Jaime ReyesAlvarez, Ars Regnandi – Regierungsstabilität und Herrschaftskrisen in Iberoamerika. Am Bei-spiel von Argentinien und Chile, Frankfurt/Main u.a. 2003.
33 Vgl. Saretzki »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«, aaO.(FN 4), S.361.
248 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 248

ziert die Annahme, dass es der Wissenschaft möglich sei, ein Problem in all seinen Di-mensionen zu erfassen und eine Lösung zu entwickeln, welche eine erschöpfende Ab-schätzung aller Folgen einschließt und negative Folgeerscheinungen minimiert. Dieserbeinahe religiös anmutende Glaube34 an die wissenschaftliche Allmacht ist jedoch weitentfernt von der Realität und auch vom Selbstbild der Wissenschaftler.35
Das grundlegende Problem der utopischen Vorstellung der Expertokratie ist jedochzweifelsohne das der Legitimation: Diese ergibt sich im hier vorgestellten Technokra-tiemodell aus der Überlegenheit der Experten, was die technisch-wissenschaftliche Qua-lifikation und damit Einsicht in die staatlichen Probleme und deren Lösungen an-geht.36 Diese Definition der Elite, welche an der Regierungstätigkeit beteiligt werden soll,schließt von vornherein die Mehrheit der betroffenen Bürger aus und spricht ihnen nochdazu jegliche Beteiligungsmöglichkeit am politischen Entscheidungsprozess ab. Umdaran mitwirken zu können, fehlt all jenen, die nicht zur Klasse der Hochqualifiziertengehören, zum einen das Verständnis der komplexen Probleme und damit der Zugang zuadäquaten Lösungen, zum anderen können diese »Subjekte« der Herrschaft sich darumauch nicht von ihren eigenen Interessen frei machen, was dann wiederum einer rein ansachlichen Argumenten ausgerichteten Problembekämpfung im Wege steht. Der einzel-ne Bürger wird in der Technokratie also »zu seinem eigenen Besten« entmündigt, Par-tizipation wird als ineffizient diskreditiert, Partikularinteressen als dem Gemeinwohlabträglich verstanden und ihr durch Kompromisse erreichter Ausgleich in der politischenArena abgelehnt.37 In der utopischen Idealvorstellung von Technokratie wird der Ef-fektivität, also der angemessenen und möglichst vollständigen Erledigung staatlicherAngelegenheiten, der absolute Vorzug gegenüber allgemeiner Beteiligung an dem damitverbundenen Entscheidungsprozess gegeben: Normativ-ideologische Technokratiemo-delle sind mithin undemokratisch.38
34 Zum religiösen Charakter der technokratischen Idee vgl. auch: Morandi, »Zur Geschichte derTechnokratie«, aaO. (FN 11), S. 121 f.
35 Zum Problem fehlender Technikfolgenabschätzung vgl. u. a. Manfred Mai, »Der neue Tech-nikpopulismus: Technokratie oder Demokratie?« in: Blätter für deutsche und internationalePolitik 9/2007, S. 1132-1142, bes. S. 1136-1138; Roger Williams, Politics and technology, Lon-don 1971; sowie allgemein die Diskussion um Ulrich Becks Risikogesellschaft. Auf dem Wegin eine andere Moderne, Frankfurt/Main 1986.
36 Vgl. Saretzki »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«, aaO.(FN 4), S. 360. Auf die zentrale Frage der Legitimation soll später noch intensiver eingegangenwerden.
37 Vgl. hierzu u.a. Centeno/Silva, wenn sie mit Hinblick auf den expertokratischen Ansatz, dender österreichische Wirtschaftswissenschaftler von Hayek formulierte, konstatieren: »By priv-ileging objective reason, such scientific politics deny the very essence of politics: the represen-tation of particularistic interests and their resolution in some institutional arena.«, Miguel A.Centeno / Patricio Silva, (Hg.), The Politics of Expertise in Latin America, London u.a. 1998,hier: S.5. Der von Centeno und Silva herausgegebene Sammelband kann als gelungenes Beispielderjenigen neueren Technokratieforschung, welche sich mit der Umsetzung der hier disku-tierten Ideen in verschiedenen Weltregionen befasst, gelten.
38 Zur antidemokratischen Einstellung moderner technokratischer Eliten vgl. insb. Fischer,Technocracy and the politics of expertise, aaO. (FN 7), S. 21-26.
249 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 249
ZfP 57. Jg. 3/2010

3. Das analytische Modell: Die Sachzwangthese
Bei den bisher vorgestellten klassischen Entwürfen von Technokratien handelt es sichum normativ-ideologische Forderungen: Es werden ideale Herrschaftsordnungen for-muliert und begründet. Bei dem Ansatz der jüngeren Technokratiediskussion, der imFolgenden vorgestellt werden soll, handelt es sich hingegen um Thesen, die Anspruchauf eine analytische Beschreibung der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung erhebenund ihre Verdichtung in einer Modellwelt erfahren, welche den künftigen Zustand derGesellschaft und der politischen Realität in ihr aus eben diesen Beobachtungen extrapo-liert.39
Dieser Idealtypus des technischen Staates wurde von Helmut Schelsky in erster Liniein seinem Vortrag »Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation«40 entwickelt. DieFrage nach Staat und Regierung sollte hier eigentlich nur als Illustration für SchelskysHauptaugenmerk, die Stellung des Menschen in der modernen, industrialisierten Welt,dienen; sie gab der Technokratiediskussion, welche in Deutschland seit den fünfzigerJahren und bis Anfang der siebziger Jahre geführt wurde, jedoch neue Impulse, indemder »Sachzwanggedanke« als zentraler Aspekt einer einflussreichen Kontroverse eta-bliert wurde.41
Diese Diskussion sowie auch der im Weiteren untersuchte Ansatz müssen vor demHintergrund der kulturpessimistischen und technikdeterministisch inspirierten Gesell-schaftskritiken verstanden werden, denn Schelsky verdichtet in seinem Modell viele As-pekte der durch den Kulturpessimismus stark beeinflussten konservativen Kulturphilo-sophie.42
39 Schelsky hat zwar den Anspruch, eine Analyse erstellt zu haben – wie stark seine Voraussagenjedoch eine Dystopie beinhalten, soll im Folgenden deutlich werden. Vgl. Saretzki, »Techno-kratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«, aaO. (FN 4), S.361. Vieleder einschlägigen Werke entstanden als Teil oder in der Folge der Diskussion der fünfziger undsechziger Jahre. Hier sind – neben den einzelnen Beiträgen zur Debatte um Schelskys Thesen– besonders in dem von Klaus Schubert herausgegebenen Band Politik in der ›Technokratie‹:Zu einigen Aspekten zeitgenössischer Kulturkrisentheorie, Frankfurt/Main 1981, interessanteBeiträge versammelt.
40 Helmut Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹, Vortrag in der 79. Sit-zung der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen am 15.3.1961«,in: ders., Auf der Suche nach Wirklichkeit. Gesammelte Aufsätze, Düsseldorf/Köln 1965, S.439– 480.
41 Vgl. Rickert, Technokratie und Demokratie, aaO. (FN 4), S. 65. Weitere wichtige Ansätze inder Diskussion stammen u.a. von Hermann Lübbe (u. a. Hermann Lübbe, »Technokratie. Po-litische und wirtschaftliche Schicksale einer philosophischen Idee«, in: Allgemeine Zeitschriftfür Philosophie, Jg. 25 (2000), Stuttgart, S. 118–137; ders., »Anmerkungen zur aktuellen Tech-nokratiediskussion«, in: Lenk, Technokratie als Ideologie, aaO. (FN 1) S. 94-104.und Erich Forsthoff.
42 Vgl. Klaus Schubert, Politik in der »Technokratie«, aaO. (FN 39), S. 17.
250 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 250

3.1 Die universal gewordene Technik als gesellschaftliches Phänomen
Um die politiktheoretischen Implikationen von Schelskys Analyse der industrialisiertenGesellschaften abschätzen zu können, sollen hier zunächst deren wichtigste Grundan-nahmen dargestellt werden.
Als Ausgangspunkt für die Überlegungen dient Schelsky das bei Arnold Gehlen43
vertretene Menschenbild eines Mängelwesens, welches die Technik als Ausgleich für diefehlenden organischen Möglichkeiten entwickelt und sich ihrer werkzeughaft bedient.Er geht allerdings weit über diese Vorstellung der Technik als Werkzeug hinaus, wenner betont, dass es sich heute bei der Technik vor allem um eine Bewusstseinsleistung und,noch weiter gedacht, um ein Grunddenkschema des modernen Menschen handelt.44
Diese moderne Technik sieht Schelsky durch drei wesentliche Merkmale gekenn-zeichnet: So bezieht er sich zum einen auf die Vorgehensweise, wenn er schreibt, dassihre Grundlage eine »analytisch[e] Zerlegung des Gegenstandes oder der Handlung inihre letzten Elemente, die in der Natur so nicht vorfindbar sind«45 sei. Dem folge danndie Synthese dieser Elemente nach dem Prinzip der höchsten Wirksamkeit. Die Technik,die Schelsky im Auge hat, folgt somit einem allen anderen übergeordneten Kriterium,nämlich dem der maximal möglichen Leistung, die erzielt werden soll. Die weitere Ent-wicklung ist vorgezeichnet, und zwar hin zum scientifically best one way, eine Annahme,die in der weiteren Argumentation eine wichtige Rolle spielen soll. Hierbei handelt essich um das mögliche »Höchstmaß an technischer Leistungsfähigkeit«,46 mithin die voll-kommene Lösung eines Problems – die absolute Wahrheit, gemessen in Effizienzeinhei-ten.
Das dritte Merkmal der modernen Technik ist schließlich eine Folge der verallgemei-nerten Idealvorstellung höchster Effizienz, welche nicht auf das wissenschaftlich-tech-nische Feld beschränkt, sondern im Gegenteil auf alle Teilbereiche des menschlichenLebens übertragen wird: das Universalwerden der modernen Technik in Form eines Be-wusstseinsmoments des Menschen. Die universale Technik greift in alle Bereiche ein, siewird zum neuen systemischen Überbau und unterwirft alle anderen Systeme ihrer eige-nen Logik. Auf diese Weise wird das Kriterium der Effizienz als allgemeiner Wertmenschlichen Handelns etabliert.47
43 „Morphologisch ist nämlich der Mensch im Gegensatz zu allen höheren Säugern hauptsächlichdurch Mängel bestimmt, die jeweils im exakt biologischen Sinne als Unangepasstheiten, Un-spezialisiertheiten, als Primitivismen, d. h. als Unentwickeltes zu bezeichnen sind: also we-sentlich negativ.“ Arnold Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt,Frankfurt/Main / Bonn 1962, S. 33.
44 Vgl. Rainer Berger, Politik und Technik. Der Beitrag der Gesellschaftstheorien zur Technik-bewertung, Opladen 1991, S. 338.
45 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 445.46 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 445.47 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 444-446. Vgl.
auch: Peter Fischer, Philosophie der Technik: Eine Einführung, Paderborn 2004, S.165. DieseMerkmale der universalen Technik treten dabei nicht nur in bestimmten Schichten oder höherentwickelten Staaten auf: »[S]ie [die Technik, SH] reicht […] in jede Schusterstube, in jeden
251 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 251
ZfP 57. Jg. 3/2010

3.2 Der Sachzwang als Folge der eigenständigen Technikentwicklung
Ausgehend von dem grundlegenden Strukturwandel, den das Universalwerden der Tech-nik in der industrialisierten Gesellschaft darstellt, folgt in Schelskys Modell ein »Kreislaufder sich selbst bedingenden Produktion«.48 Ist die Technik schon in jeden Lebensbereichals dominant vorgedrungen, so ruft auch jede technische Entwicklung Handlungsbedarfin den zwangsweise hieran angebundenen Bereichen hervor:
Jedes technische Problem und jeder technische Erfolg wird unvermeidbar sofort auchein soziales, ein psychologisches Problem, und zwar in der Art, dass dem Menschen eineSachgesetzlichkeit, die er selbst in die Welt gesetzt hat, nun als soziale, als seelischeForderung entgegentritt, die ihrerseits gar keine andere Lösung zulässt als eine tech-nische, eine vom Menschen her geplante und konstruktive, weil dies das Wesen derSache ist, die es zu bewältigen gilt.49
Hiermit führt Schelsky den Sachzwanggedanken ein: Eine technische Entwicklung ver-ändert die soziale Wirklichkeit auf eine solche Art und Weise, dass ein Handlungsbedarfentsteht, dem wiederum technisch nachgekommen werden muss.50 Dies ist das Elementdes Zwanghaften in der wissenschaftlichen Zivilisation – der Mensch reagiert auf Sach-zwänge, anstatt aktiv gestaltend tätig werden zu können.
Dieser Kreislauf stellt das »innere Gesetz der wissenschaftlichen Zivilisation«51 dar:Die Gesellschaft kann sich dem Diktat der Sachzwänge nicht mehr entziehen.
Es ergibt sich zudem ein zweites Charakteristikum der modernen Gesellschaft ausdieser Selbstreproduktion: ihre Offenheit im Sinne einer Unmöglichkeit des Planens.Diese »Unvordenklichkeit als Plan«52 impliziert die These, die Mittel bestimmten dieZiele des Prozesses sowohl der Produktion als eben auch der gesellschaftlichen Ent-wicklung. Gemeint ist damit aber nicht allein die fehlende Zielreflektion in der modernenGesellschaft aufgrund der Fixierung auf das technisch Mögliche, denn diese ist eben einelogische Folge eines zwanghaften Kreislaufes; dadurch, dass jede neue technische Ent-wicklung eine Reaktion fordert, ist eine langfristige Planung des Menschen nicht mehrmöglich: Seine Pläne können nur noch die kurzfristige Bewältigung neuer Problemeumfassen, welche ihrerseits nicht vorausgesehen werden können. Die neue Offenheit derzukünftigen Prozesse ist somit nicht Kennzeichen einer großen menschlichen Macht, diees ihm erlaubte, schnell auf aktuelle Fragestellungen zu reagieren, sondern vielmehr
Bauernhof, ja, fast schon in jeden Negerkral«, Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftli-chen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40)S. 451.
48 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 449.49 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 449.50 Zur Verarbeitung der sozialen und psychologischen Probleme verweist Schelsky auf die »So-
zial-, Wirtschafts- und Humantechniken«, die er zuvor schon als Beweis für das Universal-werden der Technik als Teil derselben angeführt hat; vgl. Schelsky, »›Der Mensch in der wis-senschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 444 f., S. 449.
51 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 449.52 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 450.
252 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 252

Ausfluss einer Ohnmacht des Menschen gegenüber von ihm weitestgehend losgelösten,sachlich begründeten Zwängen.
3.3 Der technische Staat
Die von Schelsky gemachten Beobachtungen im Hinblick auf die gesellschaftliche Ent-wicklung haben bedeutende Konsequenzen für den Staat in der wissenschaftlichen Zi-vilisation, ändern sie doch seine Grundlagen und Voraussetzungen. Diese Aspekte ver-dichtet der Soziologe in seinem idealtypischen Entwurf des technischen Staates.
Von besonderem Interesse sind in diesen Zusammenhang die Implikationen, dieSchelskys Gesellschaftsbild für die Grundphänomene moderner Staaten mit sich bringt,nämlich das Konzept von Herrschaft und ihre Legitimation, die Rolle der Politik und –in der Technokratiediskussion unerlässlich – der Experten in ihr sowie die Möglichkeitder allgemeinen Partizipation in der Demokratie.
Herrschaft in ihrem oben näher erläuterten Sinne eines Unterwerfungsverhältnissesvon Menschen ist im technischen Staat nicht mehr möglich – und auch in ihrer demo-kratisch-liberalen Form als Setzung von Ordnung und Normen wird sie unter den Be-dingungen der wissenschaftlichen Zivilisation obsolet. Statt der Entscheidungen mensch-licher Herrschaft bestimmen die zwanghaften Notwendigkeiten dieser Produktion, aufdie der Mensch nur noch reagieren kann; ein Zustand,
in welchem das Herrschaftsverhältnis seine alte persönliche Beziehung der Macht vonPersonen über Personen verliert, an die Stelle der politischen Normen und Gesetze aberSachgesetzlichkeiten der wissenschaftlich-technischen Zivilisation treten.53
Von Herrschaft im eigentlichen Sinne kann hier also nicht mehr die Rede sein: Wederwird Zwang von einer Gruppe von Menschen auf eine andere ausgeübt – der Zwang istsachnotwendig, von den menschlichen Entscheidungen unabhängig – noch wird Herr-schaft in Form von Normsetzung ausgeübt – die geltenden Normen sind wiederumSachgesetzlichkeiten, auf die der Mensch keinen Einfluss nehmen kann. In der wissen-schaftlichen Zivilisation gilt demnach eine herrschaftsfreie Unterwerfung unter die Sach-zwänge, indem in Reaktion auf neu auftretende Probleme bestimmte Mittel, die dasProblem in seiner technischen Beschaffenheit selbst vorgibt, angewendet werden.54 Dievermeintlich Herrschenden sind demnach lediglich Verwalter des Sachzwanges, sie re-
53 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 453. Zurherrschaftsfreien Herrschaft siehe auch Schubert, Politik in der »Technokratie«, aaO. (FN 39),S. 28.
54 In der Literatur taucht darum oft der Begriff »Herrschaft einer autonom gewordenen Technik«auf (so z. B. bei Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Ge-sellschaft«, aaO. (FN 4), S. 361). Diese Darstellung ist jedoch stark verkürzt und irreführend,denn Schelsky selbst widerspricht diesem Bild, wenn er festhält, dass Technik eben nicht vomMenschen losgelöst, sondern dessen Werk ist. Vielmehr unterwirft der Mensch sich hier seineneigenen Zwängen. Vgl. Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO.(FN 40), S. 450.
253 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 253
ZfP 57. Jg. 3/2010

agieren auf die neuen Notwendigkeiten, indem sie die technisch adäquate Lösung an-wenden: »[H]ier ›herrscht‹ gar niemand mehr, sondern hier läuft eine Apparatur, diesachgemäß bedient sein will.«55
Diese Dominanz des Sachzwangs, das Herrschen als reines Verwalten von Sachen,schlägt sich in erster Linie in der Politik nieder, dem gesellschaftlichen Sub-System, dasursprünglich mit der Steuerung des Staates über den Zugang zur Herrschaft betreut war.Ebenso wenig, wie Herrschaft in ihrem »früheren« Sinne noch besteht, kann Politik inihrer eigentlichen Funktion der normativen Willensbildung noch Bestand haben. Dieeinzig mögliche Entscheidung ist nur die nach technischen Prinzipien, mithin diejenige,welche die höchste Leistungsfähigkeit und die optimale Lösung verspricht. Das verändertauch die Rolle des Politikers: »[D]ieser Staatsmann ist daher gar nicht ›Entscheidender‹oder ›Herrschender‹ sondern Analytiker, Konstrukteur, Planender, Verwirklichen-der«.56 Diese Situation wird umso wahrscheinlicher, je besser entwickelt die Technik ist,und je näher sie in ihren Lösungsvorschlägen dem scientifically best one way kommt.Denn je genauer die wissenschaftlichen Lösungen, umso geringer der Entscheidungs-spielraum der Politiker, die immer mehr auf die Expertise der Wissenschaftler angewiesensind.57 Daraus ergibt sich auch die Rolle des Experten in Schelskys technischem Staat:Auf lange Sicht tritt er zwangsläufig an die Stelle, die noch die Politiker innehaben, be-dient aber in deren Rolle nur sachgemäß das System Staat: er fällt mithin keine Willens-entscheidungen mehr.
Politik als normative Willensbildung entfällt somit, sie kann keine Anwendung finden,da ihre Vorgehensweise nicht der technischen Rationalität und deren Prinzipien ent-spricht; kurzum, sie ist nicht effizient. Allerdings kann sie durchaus noch Verwendungfinden, dann allerdings nur im »Rang eines Hilfsmittels für Unvollkommenheiten des›technischen Staates‹«,58 und zwar im Sinne der Motivmanipulation. Damit ist die Ver-mittlung der Sachgesetzlichkeiten als solche und der damit verbundenen Maßnahmenvon der Verwaltungszentrale an die so verwalteten Bürger gemeint.59 Es wird hier deut-lich, dass dies schlichtweg eine Fassade ist.
In dieser Rolle als Legitimitätsbeschaffer hat die Politik den Status eines Hilfsmittels,und auch dies nur in sehr begrenztem Maße. Denn die Legitimationsfrage stellt sich ineinem Staat, in dem Sinnfragen nach seinem Wesen sowie Herrschaft müßig geworden
55 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 457. Schelskygreift hier ausdrücklich auf Burnhams Managerial Revolution zurück. Aus diesem Herr-schaftsmodell ergeben sich auch Folgen für die Souveränität im Staat: »Eine realistische Defi-nition der Souveränität des Staates wäre dann die, dass souverän ist, wer über die höchsteWirksamkeit der in einer Gesellschaft angewandten wissenschaftlich-technischen Mittel ver-fügt.« Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S.455.
56 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 456. Hierwird auch ersichtlich weshalb Schelsky selbst nicht von Technokratie gesprochen hat: Es han-delt sich nicht um ein Modell der Herrschaft, vielmehr ist diese Gesellschaft herrschaftsfrei.
57 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 458. Schelskywill denn auch in der Gegenwart schon eine »Minimisierung der politischen Entscheidungenim Staate bei ständiger Kompetenzerweiterung des Staates« feststellen.
58 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 456.59 Vgl. Schubert, Politik in der »Technokratie«, aaO. (FN 39), S. 30.
254 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 254

sind, nicht mehr. »Die moderne Technik bedarf keiner Legitimität; mit ihr herrscht man,weil sie funktioniert und solange sie optimal funktioniert.«60 Die Sachzwänge sind ebensolche, während die Technik die einzige Möglichkeit ist, in diesem Kreislauf noch zuagieren.
Aus all den aufgeführten Aspekten ergibt sich für die demokratische Form der Regie-rung in der wissenschaftlichen Zivilisation nur noch eine logische Konsequenz: Sie istobsolet, ja unmöglich. Der Verwirklichung des Volkswillens ist der Boden entzogen, unddies insofern, als das Volk aufgrund fehlenden Wissens – außer als Objekt – keinen Anteilan den technisch notwendigen Maßnahmen haben kann. Jedwede Beteiligung nicht wis-senschaftlich ausgebildeter Experten an der Ausarbeitung einer passenden Lösung istdamit unmöglich. Außerdem reagieren die Verwaltungen ausschließlich auf Zwänge,womit jeglicher Entscheidungsspielraum vernichtet ist: »[D]er ›technische Staat‹ ent-zieht, ohne antidemokratisch zu sein, der Demokratie ihre Substanz«.61 Im technischenStaat verwaltet die Regierung die Sachnotwendigkeiten, das Parlament kontrolliert derenSachlichkeit, und das Volk ist ein »Objekt der Staatstechniken«.62
Warum haben diese Organe der alten Staatsform dann aber noch Bestand in der wis-senschaftlichen Zivilisation? Schelsky postuliert keineswegs ein Verschwinden des Staa-tes, er argumentiert aber, dass dieser seine bisherige Substanz verliere. Er geht dabei ausvon der »These, dass sich […] die Erscheinung der direkten Herrschaft von Menschenüber Menschen im sozialen und politischen Sinne sozusagen von innen her auflöst; des-halb können auch alle Herrschaftsformen wie leere Hülsen stehen bleiben«.63
3.4 Der »Staat der Interessengruppen«
Eben der Blick auf die momentane politische Realität ist es, der Schelsky feststellen lässt,dass die Gesellschaft noch nicht vollkommen seinem idealtypischen Entwurf entspricht.So kritisiert er den »Staat der Interessengruppen«,64 da in diesem die Politik eben nichtdas Gemeinwohl, sondern viel eher Partikularinteressen, vertrete – das Gemeinwohl aberwerde in Form von sachlich-rationalen Lösungsvorschlägen durch die Experten voran-getrieben. Dies spiegele sich denn auch in der öffentlichen Meinung wider, die die sach-lichen Vorschläge den weltanschaulich geprägten Entwürfen der Politik vorziehe.65
Doch der »Staat der Interessengruppen« ist schlechterdings Vorstufe zum technischenStaat, und so ist auch in ihm die Rolle der Technik eine zunehmend bedeutende. Dieszeigt sich in der aktuellen Regierungspraxis, so Schelsky, vor allem in der immer häufigerund wichtiger werdenden Anforderung sowie Verwendung wissenschaftlich-technischer
60 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 456.61 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 459.62 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 459.63 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 460.64 64 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S.458. In
dieser Kritik zeigt sich eine deutliche Tendenz Schelskys hin zu dem, was er vorgeblich kriti-siert; zur rein am Effizienzgedanken ausgerichteten Lösung in der Politik.
65 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 458.
255 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 255
ZfP 57. Jg. 3/2010

Gutachten durch die Politik. Da jedoch die Wissenschaft noch nicht so weit entwickeltist, dass der scientifically best one way festgestellt werden kann, kommt es zu »Gutach-terkämpfen«,66 d. h. verschiedene Fachleute erstellen unterschiedliche Handlungsvorla-gen. Den Politikern bleibt in diesem Stadium also noch eine – wenn auch eingeschränkte– Entscheidungsmöglichkeit, und zwar die zwischen den verschiedenen Gutachten. Da-rauf bleibt die politische Auseinandersetzung jedoch zunehmend beschränkt.
3.5 Einige kritische Anmerkungen zum »technischen Staat«
Die hier vorgestellten Aspekte von Schelskys Thesen zur modernen Gesellschaft als wis-senschaftlicher Zivilisation und der Form des Staates in ihr zeichnen ein auf den erstenBlick zwar komplexes, doch in sich geschlossenes und damit auch überzeugendes Bildeiner möglichen modernen Gesellschaft. Dieses bietet in der Technokratiediskussionkomplett neue Ansätze und Reflektionsflächen. Es ist unter anderem ein wichtiger Punkt,die allgemeine Bewusstseinsprägung durch die Technik mit einzubeziehen, da sie diebreite Akzeptanz technischer Lösungen erst plausibel erscheinen lässt.
Zudem ist vor allem die Einführung des Sachzwanggedanken als Moment technokra-tischer Strukturen ein wichtiger Verdienst der These vom technischen Staat. Es verwun-dert kaum, dass diese Idee zum zentralen Gegenstand der folgenden Technokratiedis-kussion geworden ist,67 bietet sie doch angesichts der komplexen zu beherrschendenRealität eine durchaus überzeugende Variable in der Diskussion um Herrschaftsbezie-hungen.
Allerdings ist die hier vorzufindende Beschreibung der Gesellschaft nur vor dem Hin-tergrund der kulturpessimistischen Schule zu verstehen: Dieses Denken prägt die Schels-ky’schen Thesen der gesellschaftlichen Entwicklung. Damit wird ebenso deutlich, dasses sich keinesfalls um ein durchwegs objektives deskriptives Modell handelt, sondernselbst auf bestimmten Grundannahmen fußt, und zudem in hohem Maße teleologischausgerichtet ist.
Problematisch sind vor allem die technikdeterministischen Prämissen, vor allem dieeiner gänzlich freien und damit unabhängigen Entwicklung der Technik und Wissen-schaft. Dies ist wohl gerade in Gesellschaften, in denen der Staat in hohem Maße in dieTechnikentwicklung eingreift, so nicht gegeben; vielmehr folgt die Forschung zumindestimpliziten Zielvorgaben.68 Das heißt auch, dass nicht jede technische Möglichkeit zwin-gend ihre Anwendung bedeutet: So wurde etwa im Streit um die Zielsetzung und Be-grenzung der Technik die embryonale Stammzellenforschung in Deutschland aufgrundethischer Bedenken stark eingeschränkt.69 Weiterhin kann man sich fragen, ob der Ein-
66 Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 458.67 Vgl. Rickert, Technokratie und Demokratie, aaO. (FN 4), S. 67.68 »[E]gal, ob eine Technik Werkzeug oder Superstruktur ist, sie ist in sich nicht ›zweckfrei‹ […]«,
Fischer, Philosophie der Technik, aaO. (FN 47), S. 341.69 Schelsky würde hier wohl argumentieren, eine solche Selbstbeschränkung sei nicht dauerhaft,
sondern höchstens vorübergehender Natur. Die letzten Lockerungen auf diesem Gebiet bötenihm da eventuell sogar Argumentationsgrund.
256 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 256

fluss der Technik auf die gesellschaftliche Entwicklung wirklich so stark ist wie beiSchelsky angenommen und ob diese Beeinflussung nicht auch in die entgegengesetzteRichtung stattfindet.
Ein weiterer Schwachpunkt der These vom technischen Staat ist die Annahme, dieWissenschaft strebe zu einem »best one way«, der dann die umfassende Lösung einesProblems garantiere. Dies entspricht kaum dem Wissenschaftsprozess, der eher durchein Vorgehen nach dem Prinzip »trial and error« und – im Idealfall – die ständige Be-reitschaft gekennzeichnet ist, die so gewonnenen Erkenntnisse aufgrund neuen Wissenszu revidieren. Zudem scheint das Erreichen »absoluten« Wissens selbst bei einer sichimmer verbessernden und verfeinerten Technik eine unmögliche Zielvorstellung,schließlich geht es ja auch um die Erkenntnis einer immer komplexeren Welt.
Empirisch ließe sich dem Modell entgegenhalten, dass weder das Absterben der Politiknoch deren Aushöhlung durch die technische Rationalität nachweisbar und beobachtbarsind; vielmehr bewahrt sich die Politik bei allen Veränderungen, denen sie ausgesetzt seinmag, die ihr eigene Funktionslogik, welche oft genug nicht mit der technischen überein-stimmt, weshalb selbst bei wissenschaftlich vermeintlich eindeutigen Lösungen diesenicht immer voll umgesetzt werden. Es werden immer noch Nutzenüberlegungen, wiez.B. durch Budgetbeschränkungen nötig, angestellt,70 und der Einfluss verschiedensterInteressengruppen scheint eher noch zu steigen als abzusterben.
Obwohl bis zu dieser Stelle die Ausweitung der Rolle der Experten im politischenProzess als Beleg für die Entwicklung hin zum technischen Staat genannt worden ist,bleibt doch anzumerken, dass die Einbindung der Experten häufig als legitimatorischerSchachzug geschieht, nicht jedoch einen wirklichen Machtzuwachs für die Fachleute be-deutet. Vielmehr erfolgt auch die Auswahl der »Experten« und Fachgutachten wenigernach Sach- als nach Nutzenkriterien, damit deren Expertise die eigene Politik stützt, stattsie in Frage zu stellen. Von einer sachlichen Technisierung der Politik kann hierbei alsonicht die Rede sein.
Bezüglich des Sachzwanggedankens weist etwa Greiffenhagen darauf hin, dass dieBewertung einer Entscheidung als »sachlich-rational« eines »homogenen sozialen Rau-mes« bedarf,71 es hängt also wiederum von den allgemeinen in der Gesellschaft vertre-tenen Werten und Vorstellungen ab, ob ein Sachzwang als solcher erkannt werde odernicht. Dieser homogene Raum, so Greiffenhagen weiter, sei in den modernen Gesell-schaften aber kaum herzustellen, womit das Sachzwangargument scheitern muss.
In der politischen Praxis hingegen wird das Argument, man folge mit einer bestimmtenMaßnahme nur einem Sachzwang, in erster Linie zur Rechtfertigung des Programmsgenutzt. Damit wirkt der Sachzwang selbst als ideologisches bzw. die den Entscheidun-gen zugrunde liegende Ideologie verschleierndes Argument.
Wenig überzeugend scheint schließlich auch der Anspruch Schelskys, einen deskrip-tiv-analytischen Ansatz geliefert zu haben, führt man sich dessen Kritik am »Staat der
70 Vgl. Martin Greiffenhagen, »Demokratie und Techokratie« in: Claus Koch / Dieter Senghaas,(Hg.), Texte zur Technokratiediskussion, Frankfurt/Main 1970, S. 64.
71 Greiffenhagen, »Demokratie und Techokratie«, aaO. (FN 68), S. 65.
257 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 257
ZfP 57. Jg. 3/2010

Interessengruppen« vor Augen: Hier kritisiert Schelsky ein nach politischen Prämissenzwar rationales, technisch aber ineffizientes Entscheidungsverhalten. Sein Hauptaugen-merk liegt dabei auf der Tatsache, dass die Einmischung vieler Gruppen das Gemeinwohlbehindere, da sie der technisch effizientesten Lösung im Wege stünde.72 Dies ist abereindeutig eine normative Bewertung der Situation, welche die vorher kritisierte Aus-richtung an der höchstmöglichen Leistung eines Mittels teilt.
4. Utopie und Sachzwang – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Es sind in diesem Aufsatz zwei grundlegend unterschiedliche Ansätze in der Techno-kratiediskussion vorgestellt worden. Zum einen ist dies der klassische utopische Entwurf,in welchem die Herrschaft durch eine Gruppe wissenschaftlich-technisch qualifizierterExperten eine gute Regierung im Sinne größeren Wachstums und höherer Effizienz ga-rantieren soll. Der jüngere Ansatz hingegen beschreibt eine Gesellschaft, in der die Tech-nik in ihrem weitesten Sinne73 zur alles bestimmenden Konstante geworden ist, welchedas Bewusstsein der Menschen in ihr prägt. Unter diesem universalen Einfluss kann sichder Mensch der sachhaften Zwänge, die sich aus dem technischen Fortschritt ergeben,nicht mehr erwehren, sondern sieht sich gezwungen, auf sie zu reagieren. Damit verlierter aber jegliche Möglichkeit, autonom zu regieren und muss stattdessen der Logik derSachen in seinem Handeln Folge leisten.
Es wird hier deutlich, dass ein grundlegender Unterschied zwischen beiden Ansätzendie Motivation ist, aus der heraus sie entworfen wurden. Im Fall der Utopien geht esdarum, einen besseren Staat zu entwerfen und so Krisen entgegenzutreten. In der Analysedes technischen Staates geht es aber viel eher darum, eine Entwicklung und deren Kon-sequenzen auf lange Sicht aufzuzeigen. Die Unterscheidungslinie verläuft also – folgtman den Ansprüchen der jeweiligen Autoren – zwischen einem normativen und einemanalytisch-deskriptiven Modell. Losgelöst von diesen formalen Ansprüchen kann manaber konstatieren, dass es sich noch deutlicher um den Unterschied zwischen Utopie undDystopie handelt.
Es lassen sich trotz dieser grundlegenden Differenz bei den Theorien der utopischenDenker Saint-Simon und Veblen einerseits und der Analyse Schelskys andererseits ge-meinsame Annahmen und Implikationen für das politische System herausstellen: In bei-den Fällen wird der technischen bzw. wissenschaftlichen Rationalität der Vorzug ge-genüber allen anderen, vor allem aber der politischen, gegeben. Dies geschieht bei denBefürwortern einer Expertokratie, da diese der Politik keine Eigenlogik zugestehen,74
oder aber in ihr den Grund für die Krise des Staates sehen. Gegen das »verschwenderi-
72 Vgl. Schelsky, »›Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 458.73 Schelsky selbst definiert Technik ja weiter als die bloßen Realtechniken, er versteht darunter
auch die »Humantechniken« wie Psychologie oder Organisationslehre. Vgl. Schelsky, »›DerMensch in der wissenschaftlichen Zivilisation‹«, aaO. (FN 40), S. 444.
74 Vgl. Morandi, »Zur Geschichte der Technokratie«, aaO. (FN 11), S. 119.
258 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 258

sche« politische Handeln setzen sie das nach Effizienz- und Sachkriterien ausgerichtetetechnische Handeln, das auf den Staat übertragen werden soll.
Bei Schelsky ergibt sich die Bedeutung dieser Rationalität und ihres Hauptkriteriumsaus der Bedeutung für die Gesellschaft im Ganzen: Ihre neue Stellung als alleiniges Deu-tungsmuster ist ein sich zwingend ergebendes Charakteristikum der modernen Gesell-schaft, das zwar zu einer komplett neuen Stellung des Menschen führt, an sich jedochkeine Wertigkeit hat. Das Universalwerden der technischen Rationalität wird hier alsonur konstatiert, ebenso geht Schelsky aber auf die mitunter dramatischen Folgen dieserVeränderung im menschlichen Denken ein.75
Eine weitere Gemeinsamkeit ist die, dass bei beiden Modellwelten ein unpolitischerStaat entsteht. Das Konzept der Expertokratie erweist sich als hochgradig anti-politisch:So zielt es in erster Linie auf die Abschaffung der Politik, da diese der Verwirklichungvon Partikularinteressen diene, was sich wiederum negativ auf das Gemeinwohl im Staateauswirke. Andererseits handelt es sich hierbei nichtsdestoweniger um »ein explizit po-litisches Projekt«:76 Die Macht, welche die Techniker ausüben sollen, wird in einem Sys-tem der klassischen Herrschaft erlangt und verwirklicht. Damit ist zwar die politischeEigenlogik als Wirkungsmacht verdrängt, Politik als Verwirklichung von Herrschaftbleibt jedoch weiter als staatliches Grundprinzip bestehen.
Nach der These der wissenschaftlichen Zivilisation entsteht der unpolitische techni-sche Staat hingegen, ohne dass anti-politische Kräfte wirken, denn die Politik stirbt ab.Durch die Übermacht der Sachzwänge verliert die Politik als Abwägen und Aushandelneinzelner Interessen ihren Gegenstand; an die Stelle dieser Mechanismen tritt eine tech-nisch eindeutige Lösung. Auch jegliches Fragen nach Sinn und Ziel des Staates und desHandelns in ihm werden überflüssig. Wenngleich Politik nach außen hin noch Bestandhaben mag, wird sie doch von innen her aufgelöst, und hat letztendlich keine Entfal-tungsmöglichkeit mehr.
Die wichtigste Gemeinsamkeit ist jedoch das Spannungsfeld, in dem die Technokratiesich in beiden Theorien bewegt, der Raum zwischen Effektivität und Partizipation. Inbeiden Modellen ist für die Beteiligung der Bürger an der Willensbildung und Entschei-dungsfindung kein Platz, sie steht entweder dem Gemeininteresse entgegen oder istschlicht unmöglich, da schon allgemein keine von den Sachen losgelöste Entscheidungmehr getroffen werden kann.
In der Konzeption von Saint-Simon und Veblen wird deutlich, dass beide eine breiteBeteiligung der Bürger ausschließen. Diese würde wiederum die Vertretung von Parti-kularinteressen mit sich bringen, was gerade durch die Herrschaft des Sachverstandesausgeschlossen werden soll. Zudem fehlt dem Bürger, sofern er nicht eine höhere Aus-bildung erfahren hat, das notwendige Verständnis der Probleme und ihrer technischenLösungen. Zu guter Letzt ist Partizipation auch unnötig, wird doch im Interesse Aller
75 Dabei ist allerdings deutlich zu unterscheiden zwischen Anspruch und Wirklichkeit seinerThesen: Entwirft Schelsky auch keine Utopie, so ist doch, wie schon angedeutet, eine Dystopiedas Leitbild seines Modells.
76 Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«, aaO.(FN 4), S. 361.
259 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 259
ZfP 57. Jg. 3/2010

die Verwirklichung des Gemeinwohls in Form einer möglichst hohen Produktivität an-gestrebt. Hier wird also deutlich, wie stark der effektiven Problemlösung das Primatgegenüber einer hohen Partizipation eingeräumt wird.
Es scheint auf den ersten Blick schwieriger, das gleiche Problemfeld auch in der TheseSchelskys aufzudecken, zumal sein unpolitischer Staat quasi herrschaftsfrei ist und einerzwangsweisen Entwicklung entspringt. Nichtsdestotrotz dominiert auch hier die mög-lichst vollständige und umfassende Problemlösung gegenüber der Partizipation einesmöglichst großen Teils der Bevölkerung. Die Willensbildung, die nach außen hin nochstattfinden mag, ist Schelsky zufolge lediglich ein Produktionsvorgang, bei dem es darumgeht, Zustimmung für die ohnehin notwendigen Maßnahmen zu erzeugen und so dasGefühl zu erzeugen, die Gesellschaft sei in den Prozess der Problemlösung eingebunden.Im idealtypischen technischen Staat ist dies aber weder notwendig noch möglich. DieProbleme, die primär gelöst werden müssen, ergeben sich aus dem Sachzwang, sie werdennicht ausgewählt, und bei der Lösung gibt es keinen Raum für Diskussion, da die Wis-senschaft die eindeutig zutreffende Vorgehensweise vorschreibt. Auch die These destechnischen Staates spricht somit der Partizipation jedwede Bedeutung ab, an ihre Stelletritt eine wissenschaftlich gesteuerte eindeutige Problemlösung.
Die Technokratiediskussion spielt sich genau zwischen diesen beiden »Eckpfeilern«(demokratischen) Regierens ab: Effektivität und Partizipation. Die Hauptfrage ist dabeiimmer, in welchem Verhältnis das eine eingesetzt werden kann, bevor das andere damitvollständig verschwindet, und welchem der beiden Aspekte oberste Priorität eingeräumtwird. Die Technokratietheorien, die hier untersucht worden sind, favorisieren eindeutigEffektivität77 – und zwar bis hin zur völligen Ausschaltung der Partizipation. Man kanndies auch in Bezug zum in der aktuelleren Demokratietheorie relevanten Gegensatzpaarinput- und output- Legitimation78 setzen: Hier gibt die Technokratie der output-Legiti-mation den absoluten Vorzug.
5. Zur Aktualität der Technokratiediskussion
Betrachtet man die Entstehungszeiträume der hier diskutierten Theorien sowie die Hö-hepunkte der allgemeinen Beschäftigung mit dem Themenkomplex, so scheint es, alshandele es sich dabei um einen Aspekt von eher historischem Interesse, der heute so nichtmehr näher beleuchtet werden muss. Die großen utopischen Entwürfe stammen aus dem
77 Wobei in den hier diskutierten Texten immer von Effizienz gesprochen wird. Nach Steffanibezeichnet diese allerdings die schnelle und reibungslose Entscheidungsfindung, also eher denProzess der Problemlösung. Bei allen technokratischen Vorstellungen stellt jedoch dessen Er-gebnis, das eine möglichst dem Problem angemessene Lösung sein soll, den einzig gültigenlegitimitätsstiftenden Zusammenhang dar, was in diesem Beitrag als Effektivität verstandenwird. Vgl. dazu u. a. Winfried Steffani, »Parlamentarische Demokratie – Zur Problematik vonEffizienz, Transparenz und Partizipation«, in: ders. (Hg.), Parlamentarismus ohne Transpa-renz, Opladen 1973, S. 17-47.
78 Vgl hierzu v. a. Fritz W. Scharpf, Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung, Kon-stanz 1970, sowie ders., »Legitimität im europäischen Mehrebenensystem«, in: Leviathan(2009) 37, S. 244-280.
260 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 260

19. bzw. dem beginnenden 20. Jahrhundert, und die letzte umfassendere Debatte zumThema verstummte in Deutschland spätestens Ende der achtziger Jahre. Hat sich die Ideeeiner Expertenherrschaft oder aber der Herrschaft des Sachzwangs damit vollständigüberholt? Dies scheint zu weit gegriffen. Zwar sind die utopischen Ansätze der Tech-nokratie kaum noch aktuell als Gegenentwurf zum demokratischen Staat; die Idee, Fach-wissen als wichtigen Faktor in den politischen Prozess einzubinden, hat hingegen kauman Aktualität verloren. So sei beispielsweise auf die starke Einbindung von Fachleutenin das momentane politische Geschehen auf verschiedenen Ebenen hingewiesen, die auchin der Bevölkerung als durchaus positiv wahrgenommen wird. Die fachliche Expertisehat als Legitimation einer Aussage und der damit verbundenen Entscheidungsmacht ofteinen höheren Stellenwert als der vermeintliche »Parteienklüngel«, der in seiner irratio-nalen, fast schon als korrupt empfundenen Funktionsweise keine »passenden« Lösungenhervorzubringen scheint. Hierin kann man sowohl die immer noch wirkmächtige Vor-stellung einer Möglichkeit der Expertenherrschaft sehen als auch einen Beleg für dieThese, dass der von der Technik durchgesetzte Effizienzgedanke ein bestimmendes Mo-ment des allgemeinen Denkens und Bewertens sei.79 Eine ebenso aktuelle Diskussion umdie Chancen und Grenzen technokratischen Regierens wird geführt mit Blick auf dieRolle der Experten in den jungen Demokratien, wie z.B. in den seit den achtziger Jahrendemokratisierten lateinamerikanischen Staaten. Hier wird sogar die Möglichkeit von»technocratic democracies«, in denen die Experten mit ihren sachlogischen Lösungen diefragilen demokratischen Strukturen stabilisieren, in Betracht gezogen.80
Zum Schluss sei hier auch noch einmal auf die Aktualität der Thesen Schelskys hin-gewiesen: Zwar scheint der von ihm skizzierte technische Staat sich in dieser radikalenForm nicht zu entwickeln, andererseits zeigt er jedoch viele Tendenzen auf, die bei einerkritischen Betrachtung der Gesellschaft nicht abwegig erscheinen.
So seien hier einige aktuelle Tendenzen kurz angedacht.81 Zum einen lässt sich fest-stellen, dass in einer Gesellschaft, in der Information einen immer höheren Eigenwerthat, die Informationsbeschaffung und ihre Verarbeitung immer stärker ausgelagert bzw.auf Dritte übertragen werden.82 Dies gilt für Wirtschaftsunternehmen83 ebenso wie fürdas politische System und seine Akteure. Die Rolle der Experten ist hier also vor allemdie Suche nach und Aufarbeitung von Information, die im weiteren (politischen) Han-deln und Entscheiden bedacht werden sollen. Dieser Zusammenhang führt im politischenBereich zu einer immer weiter wachsenden Zahl von Experten, sei es innerhalb der Ver-
79 Die Diskussion um die Bedeutung der Politikberatung, ihren Einfluss auf den Prozess und ihreInstrumentalisierung, kann also auch als eine neue Facette der Technokratiediskussion aufge-fasst werden.
80 Vgl. Centeno / Silva, The Politics of Expertise in Latin America, aaO. (FN 37), S. 10 ff.81 Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass es sich beim Entwurf des technischen
Staates um einen Idealtypus handelt. Die hier genannten Aspekte sollen demnach auch nichtüber allgemeine Hinweise hinausgehen.
82 Zur information society s.a. Fischer, Technocracy and the politics of expertise, aaO. (FN 7),S. 15 f.
83 Man denke z. B. an die immer bedeutendere Rolle der Unternehmensberatungen.
261 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 261
ZfP 57. Jg. 3/2010

waltungs- und Regierungsbehörden84 oder auch innerhalb der Parteien, in denen die all-gemeinen Fragen immer stärker in Politikfelder aufgeschlüsselt werden, derer sich in-nerparteiliche Fachmänner annehmen.85 Schließlich sei noch auf den Gebrauch des Sach-zwangarguments in der politischen Kommunikation hingewiesen. Häufig weisen die re-gierenden Politiker darauf hin, dass eine Entscheidung aufgrund von Sachzwängen un-ausweichlich sei. Folgt man den politischen Diskussionen, so kann man hauptsächlichbei Reformvorhaben den Eindruck gewinnen, die Regierenden könnten sich den äußerenGegebenheiten des Regierens nicht entziehen und seien geradezu gezwungen, bestimm-ten nicht von ihnen verursachten oder beeinflussbaren Sachverhalten nachzugeben.
In seiner Beschreibung der wissenschaftlichen Zivilisation und ihrer Konsequenzenbleibt Schelsky – aus der Perspektive der sechziger Jahre heraus – der Technik als Leit-motiv verhaftet. Dies besitzt heute zwar bis zu einem gewissen Grad durchaus Gültigkeit,es hat jedoch gegenüber der Sprengkraft, die dieses Argument in den sechziger Jahren zuentfalten vermochte, an Überzeugungskraft verloren. Anders liegt der Fall, setzt man fürden Begriff der Technik den der Wirtschaft ein: Damit wäre die wirtschaftliche Ratio-nalität mit den ihr eigenen Werten und Kriterien das vorherrschende Bewertungsinstru-mentarium, wirtschaftlicher Nutzen und Effizienz die Leitbilder der modernen Gesell-schaft. Zwar scheint auch diese Diagnose in ihrer Kritik überhöht, sie findet jedoch,ebenso wie die These von der universal gewordenen Technik, zweifellos Entsprechungenin der gesellschaftlichen Realität. Genau dieser Gedanke spiegelt sich auch in vielen mo-dernen Gesellschaftskritiken, besonders in der Argumentation globalisierungskritischerDiskurse – die ihrerseits zweifellos durch den ihnen eigenen Kulturpessimismus geprägtsind- sowie in der aktuellen Diskussion um »Entgleisungen« des Kapitalismus wieder.86
Über diese direkt mit den Thesen der technokratischen Ansätze verbundenen Aspektehinaus sei aber noch auf deren Relevanz in der aktuellen Demokratiediskussion hinge-wiesen, die den Stellenwert und die Aktualität des Konzeptes in der politikwissenschaft-lichen Debatte ausmachen. Technokratie schließt, wie oben schon ausgeführt, in beidenModellen die Partizipation einer breiten Masse der Bürger aus. Kontrastiert man diesnun mit Theorien der pluralistischen Demokratie, so wird der Widerspruch zwischenbeiden Ansätzen besonders deutlich. Als Beispiel soll hier das Konzept der PolyarchieRobert A. Dahls87 herangezogen werden: Dieser stellt fünf Kriterien einer »procedural
84 Vgl. Fischer, Technocracy and the politics of expertise, aaO. (FN 7), S. 19.85 Vgl. Saretzki, »Technokratie, Technokratiekritik und das Verschwinden der Gesellschaft«,
aaO. (FN 4), S. 377. Die Sektoralisierung der Politik ist demnach auch schon Gegenstand einertechnokratischen These geworden.
86 Zur Globalisierungskritik seien hier einige Titel stellvertretend genannt: Vivianne Forrester,Der Terror der Ökonomie, Wien 1997; David Held / Anthony McGrew, Globalization / Anti-globalization. Beyond the great divide, Canbridge 2007, sowie die Beträge in Elmar Altvater(Hg.), Der Sound des Sachzwangs. Der Globalisierungsreader, Bonn u. a. 2007.
87 Vgl. zur Polyarchie u. a.: Robert Alan Dahl, Polyarchy. Participation and opposition, NewHaven et al. 1971; ders., Democracy and its critics, New Haven et al. 1989, ders., »Die polyar-chische Demokratie«, in: ders., Vorstufen zur Demokratie-Theorie, Tübingen 1976.
262 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 262

democracy«88 auf, nämlich »1. Equality in voting […] 2. Effective participation […] 3.Enlightened understanding […] 4. Final control over the agenda […] 5. Inclusion […]«Gleicht man diese Aufzählung mit den Annahmen der bis hierhin dargestellten Konzepteab, so wird schnell deren Unvereinbarkeit mit dem Dahlschen Idealtypus der Polyarchiedeutlich: Durch die alleinige Entscheidungsgewalt der Experten – sei es als Herrscheroder als Bediener der Problemlösungsmaschinerie Gemeinwesen – ist weder eine Gleich-wertigkeit der Stimmgewalt der einzelnen Bürger, noch eine effektive Teilhabe möglich,bzw. erwünscht. Noch deutlicher wird der hier aufgezeigte Widerspruch bei dem drittenvon Dahl genannten Punkt, dem »aufgeklärten Wissensstand«:89 Dieser wird nicht nurals unmöglich angesehen; vielmehr ist es im Sinne einer guten Ordnung, bzw. im Zugeder effizienten Verwaltung der Sachzwänge nicht wünschenswert, dass alle Bürger dieMöglichkeit haben, sich mithilfe der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen eineeigene Meinung zu den zu entscheidenden Sachverhalten zu bilden. Die Meinungsbil-dung ist darüber hinaus vollkommen unnötig, wird doch im Sinne der Sachlogik eineeindeutige Problemlösung durchgeführt. Die Entscheidung des nicht technisch gebilde-ten Bürgers ist hier also überflüssig. Dementsprechend ist auch eine finale Kontrolle derAgenda durch den Demos hinfällig, bzw. unmöglich. Zwar soll dieser Aspekt hier nichtweiter ausgeführt werden, doch wird deutlich, dass die technokratischen Modelle in ihrenverschiedenen Ausprägungen mitnichten nur eine besondere Spielart politischer Theoriedarstellen, sondern vor allem im Rahmen grundlegender Diskussionen um das Wesendes Staates und insbesondere der demokratischen Ordnung von höchster Relevanz seinkönnen und als Gegenentwürfe auch die Vorzüge und eventuellen Gefährdungen derDemokratie abbilden können.
Zusammenfassung
Der Technokratiebegriff scheint nur auf den ersten Blick ein eindeutig einzugrenzendespolitikwissenschaftliches Problem zu bezeichnen, wird doch bei näherer Betrachtungdeutlich, dass er, je nach Kontext, verschiedenste politische Ordnungsvorstellungen undanalytische Modelle bezeichnet. Der Artikel stellt zwei Ansätze der Technokratiedis-kussion einander gegenüber, nämlich die utopischen Entwürfe Saint-Simons und Veblenseinerseits, und das analytische Modell des »technischen Staates«, das Helmut Schelskyin den sechziger Jahren entwickelte, andererseits. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Un-terschiede beider Ansätze herauszuarbeiten, und zwar mit dem Schwerpunkt auf derenBedeutung für das Verständnis von Politik und Regieren.
88 So der Titel eines der für diesen Abschnitt einschlägigen Aufsätze: Robert A. Dahl, »ProceduralDemocracy«, in: ders. Toward democracy: a journey. Reflections: 1940-1990, Bd. I, Berkeley1997, S. 57-92.
89 Für die deutschen Begrifflichkeiten wurde hier auf die in der Kurzdarstellung durch ManfredG. Schmidt verwandte Übersetzung zurückgegriffen; Manfred G. Schmidt, »Die Demokrati-etheorie der Pluralisten«, in: ders., Demokratietheorien. Eine Einführung, Wiesbaden 2008,S. 210-224.
263 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 263
ZfP 57. Jg. 3/2010

Summary
The term »technocracy« appears to be unequivocal only at first glance. A closer inves-tigation of its use and meanings conveys that »technocracy« – depending on its contextualapplication – refers to widely diverging models of society and state as well as to specificanalytical concepts. In this essay two approaches to the discussion of technocracy willbe scrutinized. Therefore, the utopian ideas of Saint-Simon and Veblen shall be comparedwith the analysis of the »technical state« as formulated by Helmut Schelsky in the1960 s. This aims at showing similarities and differences between the two approaches,especially elaborating on the implications these models have for the understanding ofpolitics and government.
Sophie Haring, Rule of Experts or Rule of Inherent Necessity? – Technocracy as a Topicof Political Science
264 Sophie Haring · Herrschaft der Experten oder Herrschaft des Sachzwangs? 264
Bitte bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei unter www.nomos-shop.de
Das StandardwerkJahrbuch Extremismus & Demokratie (E & D)21. Jahrgang 2009Herausgegeben von Uwe Backes, Alexander Gallus und Eckhard Jesse2010, 504 S., geb., 49,– €, ISBN 978-3-8329-5232-7
Das Jahrbuch E & D dokumentiert, kommentiert und analysiert umfassend die Entwicklung des politischen Extremismus im Berichtsjahr. Neben Analysen, Daten und Dokumenten finden sich eine ausführliche Literaturschau bzw. Rezensio-nen zu den wichtigsten Publikationen aus dem Bereich der Extremismusforschung.

Oskar Niedermayer
Die Erosion der Volksparteien
Sucht man nach dem zentralen Charakteristikum, mit dem der gegenwärtige Zustand derbundesdeutschen Parteiendemokratie beschrieben wird, so drängt sich unweigerlich dieThese vom »Ende der Volksparteien«1 auf. Sind die Volksparteien tatsächlich am Ende?Oder sollte man etwas vorsichtiger von ihrer allmählichen »Erosion« sprechen? Der fol-gende Beitrag geht dieser Frage nach, indem er vor allem die Entwicklung der elektoralenbzw. parlamentarischen Dominanz und der koalitionsstrategischen Relevanz aber auchder gesellschaftlichen Verankerung der Volksparteien untersucht. Ohne auf die vielfältigesozialwissenschaftliche Diskussion um den Begriff der Volkspartei als analytische Ka-tegorie einzugehen,2 wollen wir hier eine Partei als Volkspartei ansehen, wenn sie überein breites programmatisches Profil, eine große Zahl und hinreichende soziale Bandbreitevon Mitgliedern und Wählern, eine flächendeckende Organisationsdichte und eine ge-wisse Bündnisoffenheit besitzt.3 Nach dieser Abgrenzung konnten in der Bundesrepu-blik in der Vergangenheit die CDU, die SPD und die auf Bayern begrenzte CSU alsVolksparteien angesehen werden. Über eine Einbeziehung der Linkspartei in diese Ka-tegorie ließe sich diskutieren, wenn man nur Ostdeutschland betrachten würde. Im Ge-gensatz zur CSU ist die Linke organisatorisch und elektoral jedoch nicht auf eine be-stimmte Region beschränkt, sodass sie nicht einbezogen wird.
1. Die Entwicklung der elektoralen und parlamentarischen Dominanz der Volksparteien
Der übliche Indikator zur Analyse der elektoralen Dominanz von Parteien ist ihr Anteilan den bei Bundestagswahlen abgegebenen gültigen Stimmen. Die tatsächliche Fähigkeitder Parteien, die Bürgerinnen und Bürger von ihrem personellen und inhaltlichen Poli-tikangebot zu überzeugen, also ihre Mobilisierungsfähigkeit, wird jedoch sinnvoller überden Anteil der für die Partei abgegebenen Stimmen an der Gesamtheit der Wahlberech-tigten gemessen. Dieser Indikator bezieht die Tatsache mit ein, dass es den Parteien beiden einzelnen Wahlen in unterschiedlichem Ausmaß gelingt, ihr Wählerpotenzial zumobilisieren, was sich in unterschiedlichen Wahlbeteiligungen ausdrückt. Schaubild 1
1 Peter Lösche, »Ende der Volksparteien« in: Aus Politik und Zeitgeschichte 51 (2009), S. 6.2 Vgl. hierzu z.B. Alf Minzel, Die Volkspartei. Typus und Wirklichkeit, Opladen 1984 und Bernd
Hofmann, Annäherung an die Volkspartei. Eine typologische und parteiensoziologische Studie,Wiesbaden 2004.
3 Vgl. hierzu auch Everhard Holtmann, »Repräsentation des Volkes durch Volksparteien?« in:Eckhard Jesse / Roland Sturm (Hg.), Bilanz der Bundestagswahl 2005, Wiesbaden 2006, S. 212.
ZfP 57. Jg. 3/2010

gibt die Mobilisierungsfähigkeit von CDU, CSU und SPD bei allen bisherigen Bundes-tagswahlen wieder.
Die parlamentarische Dominanz von Parteien wird an ihrem Anteil an den Mandatengemessen, der in Schaubild 2 wiedergegeben ist. Beim Vergleich der beiden Schaubilderwird deutlich, dass die Struktur eines Parteiensystems auf der elektoralen Ebene beiWahlen nicht eins zu eins auf der parlamentarischen Ebene abgebildet wird. Zum einenerfolgt die Mandatsaufteilung zwischen den Parteien gemäß dem Verhältnis der abgege-benen gültigen Stimmen, d.h. die Wahlbeteiligung spielt für die Mandatszahlen keineRolle, zum anderen entfalten die unterschiedlichen Typen von Wahlsystemen unter-schiedlich starke Konzentrationswirkungen.4 Daher liegen die Mandatsanteile derVolksparteien deutlich über ihren Stimmenanteilen an den Wahlberechtigten.
Die beiden Schaubilder zeigen, dass das Parteiensystem der Bundesrepublik von An-fang an von CDU/CSU und SPD geprägt wurde, auch wenn deren Dominanz bei derersten Bundestagswahl 1949 noch nicht so stark ausgeprägt war: CDU, CSU und SPDkonnten zusammen 45,8 % der Wahlberechtigten mobilisieren. Ihr gemeinsamer Man-datsanteil betrug 67,2 Prozent, beide Parteien errangen jeweils etwa ein Drittel der Man-date und die FDP als drittstärkste Partei hatte einen Mandatsanteil von nur 13 Prozent.In den nächsten beiden Jahrzehnten konnten die Volksparteien ihre Vormachtstellungimmer stärker ausbauen. Auf dem Höhepunkt ihrer Dominanz, in den Siebzigerjahren,mobilisierten sie zusammen über 80 Prozent der Wahlberechtigten und stellten über 90Prozent der Bundestagsabgeordneten. Danach baute sich die Dominanz der Volkspar-teien jedoch kontinuierlich wieder ab.
4 Als wichtigste Merkmale, die zur Konzentrationswirkung eines Wahlsystems beitragen, geltendie Gesamtzahl der zu vergebenden Mandate, die Wahlkreisgröße (Zahl der in einem Wahlkreiszugeteilten Mandate) und Sperrklauseln (Beschränkung der parlamentarischen Repräsentationauf Parteien ab einem bestimmten Stimmenanteil, z.B. die Fünf-Prozent-Hürde in der Bundes-republik), weitere relevante Merkmale sind das Stimmenverrechnungsverfahren und die geo-grafische Wahlkreiseinteilung. In der Bundesrepublik kommt noch der Verzerrungseffekt durchmögliche Überhangmandate hinzu.
266 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 266

Schaubild 1: Mobilisierungsfähigkeit der Volksparteien 1949-2009
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
49 53 57 61 65 69 72 76 80 83 87 90 94 98 02 05 09
CDU/CSU+SPD SPD CDU CSU CDU/CSU
Schaubild 2: Mandatsanteile der Volksparteien im Bundestag 1949-2009
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
49 53 57 61 65 69 72 76 80 83 87 90 94 98 02 05 09
CDU/CSU+SPD CDU/CSU SPD
Quelle: eigene Berechnungen auf der Grundlage der amtlichen Wahlstatistik.
267 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 267
ZfP 57. Jg. 3/2010

Die getrennte Betrachtung von CDU und CSU zeigt, dass die CSU – nachdem sie sichgegen die Bayernpartei durchgesetzt hatte – seit Ende der Fünfzigerjahre in Bayern im-mer deutlich mehr Wahlberechtigte mobilisieren konnte als die CDU außerhalb vonBayern, wobei sich die Mobilisierungsfähigkeit der beiden Parteien in der Folgezeit par-allel entwickelte – mit Ausnahme der Wahl von 2002, in der der bayerische Minsister-präsident Edmund Stroiber als Unions-Kanzlerkandidat in Bayern zu einer starken Mo-bilisierung führte (vgl.Schaubild 1).
Im Verhältnis zwischen Union und SPD bildete sich im Verlauf der Fünfzigerjahreeine strukturelle Asymmetrie zugunsten der Union heraus.5 Ursachen hierfür waren: (1)die »nachholende Volksparteiwerdung« der SPD: Sowohl die SPD als auch die Unionwaren ihren bis zur Entstehung des deutschen Parteiensystems im Gründungsjahrzehntdes Kaiserreichs zurückreichenden historischen Wurzeln verhaftet, nämlich dem Klas-senkonflikt und der konfessionell-religiösen Konfliktlinie, die sich in der neu entstan-denen Bundesrepublik in dem ökonomischen Gegensatz zwischen einer mittelständisch-freiberuflichen Orientierung und einer Arbeitnehmer- /Gewerkschaftsorientierung unddem gesellschaftspolitischen Konflikt zwischen religiös-kirchlich-konfessioneller Bin-dung und Säkularisierung äußerten. Ihre traditionelle, in sozialen Milieus verankerteKernwählerschaft bestand daher aus der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaftauf der einen und den religiösen, kirchengebundenen Katholiken auf der anderen Seite.CDU und CSU verstanden sich im Gegensatz zur katholischen Zentrumspartei des Kai-serreichs und der Weimarer Republik jedoch von Anfang an als konfessionsübergrei-fend-christliche Parteien und schufen so die Voraussetzungen für eine über das katholi-sche Milieu hinausreichende »Union« unterschiedlicher Strömungen innerhalb der Wäh-lerschaft, während sich bei der SPD erst im Laufe der Fünfzigerjahre ein Wandel von derallein im Arbeitermilieu verhafteten »Klassenpartei« zur – linken – Volkspartei vollzog,der auf der ideologisch-programmatischen Ebene durch die Annahme des GodesbergerProgramms dokumentiert wurde; (2) der Antikommunismus als einigende Klammer vonansonsten durchaus unterschiedliche Interessen vertretenden bürgerlich-konservativenWählerschichten, der von der Union stets zur Mobilisierung genutzte wurde; (3) die vonder CDU und CSU aktiv betriebene Integrationsstrategie, durch die es gelang, das bür-gerlich-konservative Kleinparteienspektrum nach und nach weitgehend zu absorbieren;(4) die Tatsache, dass die Union als Regierungspartei den raschen ökonomischen Auf-schwung sehr viel stärker für sich nutzen konnte als die SPD, wodurch sich im kollektivenGedächtnis der Bevölkerung eine einseitige Zuschreibung von Wirtschaftskompetenz andie Union verankerte.
Sowohl die gesellschaftlichen Bedingungen auf der Nachfrageseite als auch die Akti-vitäten der Union auf der Angebotsseite des politischen Wettbewerbs führten somit da-zu, dass die Union im Vergleich zur SPD auf ein durch die sozialstrukturelle Zusam-mensetzung und die längerfristigen Grundüberzeugungen der Bevölkerung abgestütztes,
5 Zur Entwicklung des Verhältnisses der Volksparteien von 1949 bis heute vgl. Oskar Nieder-mayer, »Triumph und Desaster: Die SPD im deutschen Parteiensystem nach der Vereinigung«in: Gesellschaft. Wirtschaft. Politik, 2/2010, S. 225-237.
268 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 268

strukturell größeres Wählerpotenzial zurückgreifen konnte. Diese nachfragebedingtestrukturelle Asymmetrie zugunsten der Union blieb – mit Ausnahme der Wahl von 19726
– in den nächsten drei Jahrzehnten bis zur Vereinigung erhalten, auch wenn die SPD bisEnde der Sechzigerjahre den Abstand zur Union verringern konnte.7 Allerdings nahmdie Mobilisierungsfähigkeit der Union schon ab Mitte der Siebzigerjahre – mit Ausnahmevon 1983 – kontinuierlich ab.8 Die längerfristigen Gründe für diese Entwicklung waren:(1) Der traditionelle Milieu-Kern der CDU/CSU-Wählerschaft, die Gruppe der kir-chengebundenen Katholiken, schmolz aufgrund des gesellschaftlichen Säkularisierungs-prozesses langsam aber kontinuierlich ab; (2) durch die Parteireformen der Siebzigerjahreentfremdete sich die CDU/CSU zum Teil von den sie tragenden lokalen Honoratioren-schichten; (3) die unionsnahe politische Sozialisation der Nachkriegszeit, die bei vielenWählern zu einer starken lebenslangen Unionsprägung geführt hatte, wurde spätestensin der Phase der »68er« durch neue Prägungen abgelöst.
Die SPD konnte bis zum Ende der Achtzigerjahre von der zunehmenden Mobilisie-rungsschwäche der Union jedoch nicht profitieren, im Gegenteil: Auch sie war vom ge-sellschaftlichen Wandel betroffen9 und zudem blieben die in den späten Siebziger- undfrühen Achtzigerjahren sich verschärfenden innerparteilichen Spannungen nicht ohneAuswirkungen auf ihre Wählerschaft. Ein wesentlicher weiterer Grund für die Schwä-chung der SPD war die Veränderung der Konfliktstrukuter des Parteiensystems. Durchdie Veränderung der Erwerbsstruktur, den Wertewandel, die Säkularisierung, die Bil-dungsexpansion, die Mobilitätssteigerung und die Individualisierung der Gesellschafthatten sich die beiden traditionellen Konfliktlinien seit Ende der Sechzigerjahre einerseitsimmer mehr zu reinen Wertekonflikten entwickelt10 und andererseits an Bedeutung ver-loren. Seit Ende der Siebzigerjahre begann sich jedoch eine neue gesellschaftspolitischeKonfliktlinie herauszubilden, die als Konflikt zwischen libertären und autoritären Wer-
6 Bei dieser Wahl wirkten die kurzfristigen personellen und inhaltlichen Einflussfaktoren auf dasWahlverhalten optimal zugunsten der SPD: Die nach einem gescheiterten konstruktiven Miss-trauensvotum der Union gegen Willy Brandt vorgezogene Bundestagswahl wurde zum Ver-trauensvotum der Wähler für den beliebten Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger sti-lisiert, und die thematische Ausrichtung des Wahlkampfes auf die neue Ostpolitik führte zueiner starken Mobilisierung der Bevölkerung mit der höchsten Wahlbeteiligung der bundes-deutschen Geschichte.
7 Vor allem wegen des wirtschaftspolitischen Positionswandels der SPD, der sie auch für Wählerder neuen Mittelschicht salonfähig machte, und wegen der von Willy Brandt propagierten Re-formpolitik, welche die 68er-Generation und die Intellektuellen an die Seite der SPD brachte.
8 Auf die Mandatsverteilung schlug diese Entwicklung bis Mitte der Neunzigerjahre wegen dereinseitigen Verteilung der Überhangmandate zugunsten der CDU nicht voll durch.
9 Sie hatte sich zwar teilweise neue Wählerschichten erschlossen, aber ihre traditionelle Kern-wählerschaft verringerte sich durch den Wandel der Berufsstruktur und die Ende der Sechzi-gerjahre einsetzende Erosion der traditionellen Milieus.
10 Die ökonomische Konfliktlinie äußerte sich jetzt in Form eines Sozialstaatskonflikts, der alsWertekonflikt um die Rolle des Staates in der Ökonomie zwischen marktliberalen und an so-zialer Gerechtigkeit orientierten, staatsinterventionistischen Positionen ausgetragen wurde,durch die in der Regel positive Wirtschaftsentwicklung aber an Schärfe verloren hatte.
269 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 269
ZfP 57. Jg. 3/2010

tesystemen bezeichnet werden kann.11 Teilaspekte des traditionellen konfessionell-reli-giösen Konflikts wurden in diese neue Konfliktlinie einbezogen und sie wurde partei-politisch organisiert: Der libertäre Pol wurde durch die Grünen repräsentiert, die sich1980 erstmals an Bundestagswahlen beteiligten und 1983 in den Bundestag einzogen.12
Für die SPD erwiesen sich die Grünen als Konkurrenzpartei, die ihr einen Teil der durchihre gesellschaftspolitische Öffnung in der Willy-Brandt-Ära gewonnenen Wähler wie-der abspenstig machte.
Nach der Vereinigung verstärkten sich die langfristigen Probleme der Union: (1) Dietraditionelle Kernwählerschaft wurde durch das Hinzukommen der ostdeutschen katho-lischen Diaspora noch deutlich kleiner und der Säkularisierungsprozess setzte sich fort.(2) Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes entfiel der Antikommunismus als verbin-dende Klammer der verschiedenen bürgerlichen Wählerschichten. (3) In Ostdeutschlandhatte die CDU deutliche Organisationsprobleme und wurde von vielen Wählern für dieNichterfüllung der mit der Wiedervereinigung geweckten hohen Erwartungen verant-wortlich gemacht. Diese Entwicklungen ließen die nachfragebedingte Asymmetrie zu-gunsten der Union bis Ende der Neunzigerjahre weitgehend zerfallen und schufen so dielängerfristigen Voraussetzungen für eine offene Wettbewerbssituation zwischen denbeiden Volksparteien.
Dass die SPD bei der Bundestagswahl von 1998 diese Ausgangslage optimal nutzenund die Union nach einem Vierteljahrhundert erstmals wieder überflügeln konnte, lagan ihrem spezifischen Politikangebot bei dieser Wahl. Hinsichtlich ihres inhaltlichenPolitikangebots braucht jede Partei einen Markenkern, d.h. eine politische Kernkompe-tenz, mit der sie verbunden wird, aus der sie ihre Identität schöpft und deretwegen sieprimär gewählt wird. Volksparteien brauchen zum einen in ihrem Markenkern die Kom-petenzführerschaft und zum anderen muss ein breites Profil an so genannten Sekundär-kompetenzen in anderen Politikbereichen hinzukommen, um ihre immer heterogenerwerdende Wählerklientel optimal anzusprechen. Der Markenkern der beiden Volkspar-teien wird durch ihre Positionierung im Sozialstaatskonflikt gebildet, der seit den Neun-zigerjahren immer mehr an Bedeutung gewann, da die Verstärkung des Globalisierungs-prozesses, der demographische Wandel in Gestalt der zunehmenden Alterung der Ge-sellschaft und die vereinigungsbedingten finanziellen Lasten den deutschen Wohlfahrts-staat zunehmend an die Grenzen seiner Finanzierbarkeit gelangen ließen. Der Marken-kern der SPD liegt in ihrer Sozialkompetenz, die Kernkompetenz der Union ist ihreWirtschaftskompetenz. Um ihren Volksparteicharakter zu erhalten, ist es für die SPD
11 Die Pole dieser Konfliktlinie werden gebildet durch libertäre Werthaltungen wie ein modernesErziehungs-, Frauen- und Familienbild, Betonung von Selbstverwirklichung, Toleranz gegen-über Minderheiten, Bejahung von Multikulturalität und Unterstützung nonkonformistischerLebensstile und autoritäre Werte wie ein traditionelles Erziehungs-, Frauen- und Familienbild,Unterordnung unter Autoritäten, Intoleranz gegenüber Minoritäten, kulturelle Abschottung,Fremdenfeindlichkeit und Unterstützung konformistischer Lebensstile.
12 Mitte der Achtzigerjahre wurde der bisher allein durch die NPD repräsentierte autoritäre Poldurch die Republikaner und die Deutsche Volksunion (DVU) verstärkt. Bis heute ist der au-toritäre Pol im Parteiensystem auf der Bundesebene jedoch nicht parlamentarisch repräsentiert.
270 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 270

jedoch notwendig, im ökonomischen Bereich ihre Sozialkompetenz durch Wirtschafts-kompetenz zu ergänzen.
Mit dem durch das Duo Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine verkörperten Slogan»Innovation und soziale Gerechtigkeit« suggerierte die SPD eine optimale Verbindungvon sozialer Kern- und wirtschaftlicher Sekundärkompetenz. Den Wählern wurde derEindruck vermittelt, es gäbe ein sozialdemokratisches Konzept eines innovativen undsozialverträglichen Umbaus des Sozialstaates unter Vermeidung sozialer Einschnitte fürweite Kreise der Bevölkerung. Die damit geweckten hohen Erwartungen konnten nachder Regierungsübernahme jedoch nicht eingelöst werden, da hinter dem Wahlverspre-chen keine ausgearbeitete und unstrittige Politikkonzeption stand, die man jetzt in Re-gierungshandeln hätte umsetzen können. Dies führte zu deutlichen Verlusten sowohl anSozial- als auch an Wirtschaftskompetenz und damit zu einer Akzeptanzkrise der SPD.Dieser Glaubwürdigkeitsverlust wurde 2003 durch die bei vielen Wählern mit der Zeitimmer stärker zum Synonym für soziale Ungerechtigkeit werdende Agenda 2010 nochdeutlich verstärkt und führte einerseits zu einer Erosion des Markenkerns und anderer-seits zu einer Erosion der wirtschaftspolitischen Sekundärkompetenz. Zudem erzeugtedie SPD-Politik eine Repräsentationslücke, die 2007 durch eine Strukturveränderung desParteiensystems in Gestalt der Bildung der Linkspartei geschlossen wurde. Damit wurdedie bisherige ostdeutsche Regionalpartei PDS zur relevanten gesamtdeutschen Konkur-renzpartei zur SPD, die ihr einen Teil ihres Wählerpotenzials streitig machte und we-sentlich zu dem regelrechten Absturz der SPD bei der Bundestagswahl 2009 beitrug.13
Existierte Ende der Neunzigerjahre eine prinzipiell offene Wettbewerbssituation zwi-schen den beiden Volksparteien, so hat die durch das Politikangebot der SPD bewirkteStrukturveränderung des Parteiensystems die Wahrscheinlichkeit einer erneuten – nunangebotsbedingten – strukturellen Asymmetrie zugunsten der Union deutlich erhöht.
Mit der Bildung der Linkspartei existieren im deutschen Parteiensystem hinsichtlichdes Sozialstaatskonflikts zwischen sozialer Gerechtigkeit und Marktfreiheit zwei ge-samtdeutsch relevante Parteien, die die beiden Pole des Konflikts repräsentieren. Durchdie Politik der beiden Volksparteien enttäuschte sozialstaatsaffine oder wirtschaftslibe-rale Wähler haben daher neben der Wahlenthaltung auch die Wahl der Linkspartei bzw.der FDP als Handlungsoption. Eine solche Akteurskonstellation mit einer relevantenWahlalternative auf beiden Seiten gibt es in keinem anderen westeuropäischen Parteien-system14 und die hierdurch bestehenden Probleme betreffen nicht nur die SPD.15 Gemäß
13 Die SPD musste mit einer Mobilisierung von nur noch 16,1 % der Wahlberechtigten das mitAbstand schlechteste Ergebnis ihrer bundesrepublikanischen Geschichte hinnehmen (1949:22,2 %).
14 Vgl. hierzu Oskar Niedermayer, »Das deutsche Parteiensystem im westeuropäischen Ver-gleich« in dem von Heinrich Oberreuter herausgegebenen Band zur Analyse der Bundestags-wahl 2009 (im Erscheinen).
15 Ein Teil der wirtschaftsliberal orientierten Unionsanhänger interpretierte 2009 die von derFinanzkrise erzwungene staatsinterventionistische Politik als Abkehr vom Markenkern derUnion und verlieh ihrem Widerspruch durch die Wahl der FDP Ausdruck. Dies führte dazu,dass die Union mit einer Mobilisierung von 23,6 % der Wahlberechtigten auf das Niveau von
271 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 271
ZfP 57. Jg. 3/2010

den Kriterien einer für den Vergleich von Parteiensystemen entwickelten Strukturtypo-logie16 hat das bundesrepublikanische Parteiensystem 2009 zum ersten Mal in seiner Ge-schichte einen Typwechsel vollzogen. Gehörte es von Anfang an zu den Systemen mitZweiparteiendominanz, so ist es jetzt zu den pluralistischen Systemen zu zählen.
2. Die Entwicklung der koalitionsstrategischen Relevanz der Volksparteien
Der Verlust der Zweidrittelmehrheit der Mandate im Bundestag bedeutet eine qualitativeVeränderung der Entscheidungskompetenzen der beiden Volksparteien, da sie damit ihreverfassungsändernde Mehrheit verlieren.17 Für den normalen politischen Prozess vielwichtiger ist jedoch die Frage, wie sich über die Zeit hinweg die Veränderung der Zahlund Mandatsanteile der parlamentarisch repräsentierten Parteien auf die Relevanz derVolksparteien für die Regierungsbildung auswirkt. Seit den Sechzigerjahren vollzog sichauf der Bundesebene die Regierungsbildung in Form von so genannten »minimalen Ge-winnkoalitionen« (MGK). Darunter wird im Rahmen der Koalitionstheorien eine Ko-alition verstanden, die zum einen über eine Regierungsmehrheit verfügt (im Gegensatzzu einer Minderheitskoalition) und zum anderen eine minimale Größe in dem Sinnebesitzt, dass jede Koalitionspartei zum Erreichen der Mehrheit benötigt wird (im Ge-gensatz zu einer übergroßen Koalition).18 Kann mit einer Partei rein rechnerisch eineminimale Gewinnkoalition gebildet werden, so ist die Partei koalitionsstrategisch rele-vant, da die für eine solche Koalition in Frage kommenden anderen Parteien die Parteiin ihre prinzipiellen Koalitionsüberlegungen einbeziehen und eine positive oder negativeKoalitionsentscheidung treffen müssen. Ist dies nicht der Fall, dann spielt die Partei fürKoalitionsüberlegungen keinerlei Rolle und ist daher für Regierungsbildungsprozessevollkommen irrelevant.
1949 zurückfiel. Auf der parlamentarischen Ebene sorgten nur die 24 von CDU und CSUerrungenen Überhangmandate dafür, dass der Mandatsanteil der Union sich gegenüber 2005nicht verringerte, sondern leicht erhöhte.
16 Vgl. Oskar Niedermayer, »Parteiensysteme« in: Oscar W. Gabriel / Sabine Kropp (Hg.), DieEU-Staaten im Vergleich, Wiesbaden 2008, S. 360. In Systemen mit Zweiparteiendominanzmüssen die beiden größten Parteien zusammen eine bestimmte Mindestgröße, in ihremGrößenverhältnis untereinander keine allzu große Asymmetrie und einen genügend großenAbstand zur drittstärksten Partei aufweisen. Als theoretisch angeleitete und empirisch be-währte Operationalisierung dieser Erfordernisse kann gelten, dass die beiden Großparteien imParlament je über mehr als ein Viertel und zusammen über mindestens zwei Drittel der Sitzeverfügen und die nächst kleinere Partei weniger als die Hälfte der Sitze der kleineren der beidenGroßparteien erreicht. Bei der Wahl von 2009 erhielt die Union 38,4 %, die SPD 23,5 % unddie FDP als drittstärkste Partei 15 % der Mandate.
17 Allerdings ist für eine Verfassungsänderung auch eine 2/3-Mehrheit im Bundesrat notwendig.18 Eine spezielle Form der MGK ist die Koalition der knappsten Mehrheit, bei der sich diejenigen
Parteien zusammenschließen, deren gemeinsame Anzahl an Parlamentssitzen am nächsten ander Mehrheitsschwelle liegt. In den Fünfzigerjahren gab es zwei übergroße Regierungskoali-tionen, da die Union aus strategischen Gründen 1953 mit der FDP, der DP und dem GB/BHEund 1957 – trotz absoluter Mehrheit – mit der nur durch Wahlkreis-Absprachen mit der CDUin den Bundestag gelangten DP koalierte.
272 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 272

Für jede Partei lässt sich jedoch nicht nur feststellen, ob sie koalitionsstrategisch rele-vant ist oder nicht, sondern auch wie stark ihre koalitionsstrategische Relevanz ist, indemman den Anteil ihrer aufgrund der gegebenen Mandatsverteilung rechnerisch möglichenKoalitionsoptionen (d.h. MGK mit ihrer Beteiligung) an der Gesamtzahl der Koaliti-onsoptionen über alle Parteien hinweg berechnet.19
Der Konsolidierungsprozess in den Fünfzigerjahren führte zu einem zwei Jahrzehnteüberdauernden Parteiensystem mit drei parlamentarisch vertretenen und auch koaliti-onsstrategisch relevanten Parteien, das oft als »Zweieinhalbparteiensystem« gekenn-zeichnet wurde, da den beiden Volksparteien, die zusammen 87-94 Prozent der Mandateauf sich vereinigten, die kleine FDP mit einem Mandatsanteil von 6-13 Prozent gegen-überstand. Koalitionsstrategisch waren jedoch alle drei Parteien gleich relevant, da beidrei MGK (Union/SPD, Union/FDP und SPD/FDP) jede Partei 2 mögliche Koaliti-onsoptionen hatte.20 In den Sechziger- und Siebzigerjahren hatte die FDP somit bei derRegierungsbildung eine weit über ihre jeweiligen Mandatsanteile hinaus gehende Macht-position. Das gleiche traf 2002, als die FDP koalitionsstrategisch nicht relevant war, fürdie Grünen zu. Mit dem Hinzukommen der Grünen in den Achtziger- und der PDS/Linkspartei in den Neunzigerjahren gab es 1983-1998 jeweils vier relevante Parteien imBundestag.21 Dies berührte mit Ausnahme von 1998 die koalitionsstrategische Relevanzder Union nicht, da weiterhin Zweierkoalitionen mit den nun drei anderen Parteien zuihren Optionen gehörten, während die SPD nun nur noch durch eine Große Koalition(unter Unionsführung) oder eine Dreierkoalition mit den zwei kleineren Parteien theo-retisch eine Regierungsmehrheit erreichen konnte und damit an Relevanz verlor,22 sodassdie Relevanz der Volksparteien für die Regierungsbildung bei diesen Wahlen insgesamtgeringer war. Das gleiche trifft für die Wahl von 2009 zu, sodass auch bei der neuestenWahl die SPD koalitionsstrategisch im Nachteil war.
Bei der Wahl von 2005 hatten wir ein Parteiensystem mit fünf koalitionsstrategischgleich relevanten Parteien. Bei sieben möglichen MGK hatten alle fünf Parteien jeweilsvier theoretische Koalitionsoptionen und damit eine koalitionsstrategische Relevanz von4/20 = 0,2. Von 1949 abgesehen, war die koalitionsstrategische Relevanz der beidenVolksparteien bei dieser Wahl somit am geringsten. Vor allem konnte die traditionellebundesrepublikanische Koalitionsvariante einer Zweierkoalition aus einer der Volks-parteien mit einer der kleineren Parteien nicht gebildet werden. Hinzu kam, dass sich beiden Sondierungen nach der Wahl zeigte, dass nur eine einzige Variante – die Große Ko-
19 Zu beachten ist dabei, dass es sich hier um die Relevanz für die aufgrund der jeweiligen Man-datsverteilung theoretisch möglichen Alternativen der Regierungsbildung handelt. Welchedieser Alternativen jeweils auch politisch möglich sind, hängt immer von der prinzipiellen Ko-alitionsbereitschaft der einzelnen Parteien ab.
20 D.h. die Gesamtzahl der Koalitionsoptionen war 6 und jede Partei hatte eine koalitionsstrate-gische Relevanz von 2/6 = 0,33.
21 Bei den Wahlen von 1983, 1987 und 1994-2005 waren dies die Grünen, 1990 und 2009 war dieLinkspartei koalitionsstrategisch relevant.
22 Die Gesamtzahl der Koalitionsoptionen über alle Parteien hinweg betrug immer 9, die Unionhatte damit immer einen Wert von 3/9 = 0,33, die SPD wie die zwei kleineren Parteien jedochnur 2/9 = 0,22.
273 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 273
ZfP 57. Jg. 3/2010

alition – tatsächlich gebildet werden konnte. Alle Dreierkoalitionen waren aufgrund derpolitischen Unvereinbarkeiten von Union bzw. FDP und Grünen, Union bzw. FDP undLinken sowie SPD bzw. Grünen und Linken nicht möglich. Diese Situation führte füralle Parteien zu einem starken machtstrategischen Anreiz, ihre politisch möglichen Ko-alitionsoptionen zu erweitern, sodass seither die koalitionspolitische Landschaft stärkerin Bewegung ist.23
3. Die Entwicklung der gesellschaftlichen Verankerung der Volksparteien
Zusätzlich zur elektoralen und parlamentarischen Dominanz hat sich auch die gesell-schaftliche Verankerung der Volksparteien im Zeitablauf verringert, wie eine Analyseder Mitgliederentwicklung zeigt.24 Auch dies wirkt sich im politischen Wettbewerb ne-gativ aus, da Mitglieder in diesem Prozess eine Reihe von wichtigen Funktionen erfüllen.
Die SPD hatte in ihrer Hochzeit Mitte der Siebzigerjahre über ein Million Mitglieder,die CDU erreichte ihren Höchststand Mitte der Achtzigerjahre mit über 730 Tsd. Mit-gliedern. Beide Parteien verloren bis zur Wiedervereinigung je etwa ein Zehntel ihrerMitglieder. Nach der Vereinigung, die der CDU einen deutlich höheren Mitgliederzu-wachs bescherte als der SPD, verlor die CDU bis Ende 2009 nochmals über ein Drittelihrer Mitglieder, die SPD sogar 46 Prozent. Die CSU, die 1990 mit 186 Tsd. Mitgliedernihren Höchststand erreicht hatte, musste einen Verlust von 14 Prozent ihrer Mitgliederhinnehmen. Ende 2009 hatte die CDU 521 Tsd., die SPD 513 Tsd. und die CSU 159 Tsd.Mitglieder.
Allerdings sind die absoluten Mitgliederzahlen zur Analyse der tatsächlichen Fähig-keit der Parteien, aus der Bevölkerung Mitglieder zu rekrutieren, weder für Längs-schnittsbetrachtungen noch für Vergleiche zwischen den Parteien optimal geeignet, weilsich zum einen die Gesamtbevölkerung über die Zeit auch ändert und zum anderen dieGrundgesamtheit zwischen den Parteien unterschiedlich ist. Die Grundgesamtheit, ausder die SPD ihre Mitglieder rekrutieren kann, ist seit Anfang der Siebzigerjahre die Be-völkerung im gesamten Deutschland ab 16 Jahren, seit 1998 schon ab 14 Jahren, währendbei der CDU und CSU die Altersgrenze immer noch bei 16 Jahren liegt und zudem dieCDU nur außerhalb Bayerns und die CSU nur in Bayern Mitglieder gewinnen kann.Damit ist deren Grundgesamtheit deutlich geringer und damit ihre Rekrutierungsfähig-keit bei gleicher absoluter Mitgliederzahl höher. Die SPD war bis zum Frühjahr 2008 die
23 Auf der Landesebene hat dies schon zu einer Aufweichung der Trennungslinie zwischen Unionbzw. FDP und Grünen geführt (schwarz-grüne Koalition in Hamburg und »Jamaika«-Koali-tion im Saarland). Allerdings zeigt das Scheitern der Sondierungsgespräche zwischen SPD,Grünen und FDP nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Frühjahr 2010, dass dieGräben noch nicht überall überwunden sind.
24 Zur Analyse der Entwicklung und sozialstrukturellen Zusammensetzung der Mitgliedschaftenaller Parteien vgl. Oskar Niedermayer, »Der Wandel des parteipolitischen Engagements derBürger« in Steffen Kühnel / Oskar Niedermayer, Oskar / Bettina Westle (Hg.), Wähler inDeutschland. Sozialer und politischer Wandel, Gender und Wahlverhalten, Wiesbaden 2009,S. 82-134.
274 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 274

mitgliederstärkste Partei Deutschlands. Hinsichtlich der Fähigkeit zur Mitgliederrekru-tierung wurde die SPD allerdings schon viel früher, nämlich 1999 von der CDU überholt,wobei beide Parteien wiederum weit hinter der CSU zurückliegen. In der CSU warenEnde 1986 2 Prozent der bayerischen Bevölkerung ab 16 Jahren organisiert, Ende 2008waren es noch 1,5 Prozent. Die CDU rekrutierte Ende 1986 1,7 Prozent und Ende 2008noch 0,9 Prozent der nichtbayerischen Bevölkerung ab diesem Alter, während die SPDEnde 1986 1,8 Prozent der gesamtdeutschen Bevölkerung ab 16 Jahren und Ende 20080,7 Prozent der gesamtdeutschen Bevölkerung ab 14 Jahren für sich gewinnen konnte.
Sorge bereitet den Volksparteien zudem die zunehmende Überalterung ihrer Mit-gliedschaften, die in Schaubild 3 deutlich wird.
Schaubild 3: Repräsentation der Älteren und Jüngeren in den Volksparteien 1986-2008
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
CDU: Ältere CSU: ÄltereSPD: Ältere CDU: JüngereCSU: Jüngere SPD: Jüngere
Quelle: eigene Berechnungen (Parteimitgliederdatenbank des Verfassers).
In allen drei Parteien sind die Jüngeren25 in der Mitgliedschaft gegenüber ihrem Anteilan der jeweiligen beitrittsberechtigten Bevölkerung deutlich unterrepräsentiert und dieÄlteren zunehmend überrepräsentiert.26 So beträgt Ende 2008 der Anteil der Jüngeren
25 Da die Parteien bis 2007 leicht unterschiedliche Altersgruppeneinteilungen hatten, umfassendie Jüngeren bei der CDU die Gruppe der 16-29-Jährigen, bei der SPD bis 1997 die 16-29-Jährigen, ab 1998 die 14-29-Jährigen und bei der CSU die 16-30-Jährigen. Im Jahr 2008 wurdedie Einteilung vereinheitlicht, sodass die obere Grenze jetzt überall bei 30 Jahren liegt.
26 »Ältere« bis 2007: CDU und SPD ab 60 Jahre, CSU ab 61 Jahre, 2008: alle ab 61 Jahre. Um dasAusmaß der Unter- oder Überrepräsentation zu messen, wurde ein so genannter Proportio-nalitätsquotient (PQ) gebildet, indem der Anteil einer Altersgruppe an den Parteimitgliederndurch den Anteil dieser Gruppe an der jeweiligen beitrittsberechtigten Bevölkerung dividiertwurde. PQ-Werte über 1 bedeuten daher eine Überrepräsentation der Altersgruppe bei
275 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 275
ZfP 57. Jg. 3/2010

an den Mitgliedschaften der Volksparteien nur etwa ein Viertel des Anteils der Jüngerenan der beitrittsberechtigten Bevölkerung27 und der Anteil der Parteimitglieder, die über60 Jahre alt sind, ist in allen Volksparteien etwa 1,6 mal so groß wie in der beitrittsbe-rechtigten Bevölkerung.
4. Fazit
An der Erosion der Volksparteien besteht kein Zweifel: Sie verlieren seit einiger Zeit anelektoraler bzw. parlamentarischer Dominanz und gesellschaftlicher Verankerung. Vonihrem Ende kann jedoch noch nicht gesprochen werden, auch wenn die SPD von ihrerWählerverankerung her mit der Wahl von 2009 Gefahr läuft, ihren Volksparteistatus zuverlieren. Der Absturz 2009 ist jedoch auch kurzfristigen Faktoren geschuldet, d.h. siekonnte ihre strukturelle Benachteiligung nicht durch ein gutes personelles und inhaltli-ches Politikangebot wenigstens teilweise kompensieren. Zudem ist ein beachtlicher Teilder mit der SPD unzufriedenen Wahlberechtigten noch nicht zu anderen Parteien abge-wandert, sondern zu Hause geblieben und daher durchaus noch wiederzugewinnen.Kalkuliert man daher für die SPD zumindest eine leichte Erholung mit ein, so ist für dieüberschaubare Zukunft sowohl vom Wählerzuspruch als auch von der Mandatsvertei-lung her immer noch von einem deutlichen Unterschied zwischen CDU, CSU und SPDauf der einen und den drei kleineren Parteien auf der anderen Seite auszugehen, auchwenn die Hochzeit der Volksparteien-Dominanz mit einer Mobilisierung von über 80Prozent der Wahlberechtigten und Mandatsanteilen von über 90 Prozent unwieder-bringlich der Vergangenheit angehören dürfte. Zu beachten ist auch, dass selbst 2005, zurZeit der geringsten koalitionsstrategischen Relevanz von Union und SPD, die drei klei-neren Parteien von der rechnerischen Möglichkeit einer Regierungsbildung gegen dieVolksparteien noch sehr weit entfernt waren, sodass diese immer noch eindeutig die»Kanzlerparteien« darstellen. Berücksichtigt man schließlich, dass CDU, CSU und SPDzusammen immer noch sechsmal soviele Mitglieder haben als die FDP, die Grünen unddie Linkspartei, so wird auch bei der gesellschaftlichen Verankerung der Unterschieddeutlich. Das deutsche Parteiensystem steuert somit nicht auf ein stark fragmentiertesSystem mit fünf in etwa gleich starken Parteien zu.
Zusammenfassung
Der Beitrag untersucht die Entwicklung der Volksparteien in Deutschland anhand einerReihe von Indikatoren. Betrachtet werden das Ausmaß der Unterstützung durch dieWähler (elektorale Dominanz), die Stellung im Bundestag (parlamentarische Dominanz
den Parteimitgliedern und PQ-Werte unter 1 eine Unterrepräsentation, die umso stärker ist,je kleiner der Wert ist.
27 Der Anteil der 16-30-Jährigen an der bayerischen Bevölkerung ab 16 Jahren ist z.B. 21,2 Pro-zent, der Anteil dieser Altersgruppe an der Mitgliedschaft der CSU 5,1 Prozent, sodass der PQ= 0,24 ist.
276 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 276

und koalitionsstrategische Relevanz) und die gesellschaftliche Verankerung (Mitglieder-entwicklung). Die Analyse zeigt, dass an der Erosion der Volksparteien kein Zweifelmehr besteht, da sich ihre elektorale bzw. parlamentarische Dominanz und gesellschaft-liche Verankerung seit längerer Zeit abschwächt. Vom Ende der Volksparteien kann je-doch nicht gesprochen werden.
Summary
The article analyses the development of the German »catch-all parties« using a series ofempirical indicators:. The amount of support by the voters (electoral dominance), therole in the parliament (parliamentary dominance and strategical relevance concerningcoalitions) and the social entrenchment. The analysis shows, that there is no doubt aboutthe erosion of the catch-all parties. For a considerable time, they are loosing electoralsupport, their dominance in the parliament is declining and their membership is decreas-ing. However, on cannot speak of the end of the catch-all parties.
Oskar Niedermayer, The Erosion of the Catch-All-Parties
277 Oskar Niedermayer · Die Erosion der Volksparteien 277
ZfP 57. Jg. 3/2010
Bitte bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei unter www.nomos-shop.de
Polizei unter dem GrundgesetzHerausgegeben von Dieter Kugelmann2010, 129 S., brosch., 29,– €, ISBN 978-3-8329-5406-2(Sicherheit. Polizeiwissenschaft und Sicherheits-forschung im Kontext, Bd. 1)
Nach 60 Jahren Grundgesetz werden in dem Band verfassungs- und europarechtliche Fra-gen der Sicherheit von führenden Rechtsexper-ten erörtert. Die Beiträge verdeutlichen die Strukturen und Grundlagen der deutschen Ver-fassungsordnung und beziehen interdiszipli-näre sowie europäische Entwicklungen und Ansätze mit ein.
Nomos
Polizei unter dem Grundgesetz
Dieter Kugelmann [Hrsg.]
Sicherheit. Polizeiwissenschaft und Sicherheitsforschung im Kontext | 1

Carsten Reinemann
Medialisierung ohne Ende?
Zum Stand der Debatte um Medieneinflüsse auf die Politik
1. Einleitung
Medialisierung ist en vogue.1 Schwerpunktprogramme, Forschergruppen und universi-täre Zentren werden ins Leben gerufen, die sich mit dem mutmaßlich wachsenden Ein-fluss der Medien auf die Gesellschaft beschäftigen. In den Blick genommen werden dabeinicht nur Veränderungen in der Politik, sondern in nahezu allen gesellschaftlichen Teil-bereichen der Wirtschaft, der Religion, dem Recht und dem Sport bis zur Wissenschaft.Die Annahme einer wachsenden Relevanz medialer bzw. massenmedialer Kommunika-tion findet dabei zunehmend nicht nur in der Kommunikations-, sondern auch in ande-ren Geistes- und Sozialwissenschaften ihren Widerhall. Allerdings sind die zahlreichenderzeit anlaufenden Forschungsvorhaben ein deutlicher Hinweis darauf, dass es in derMedialisierungsforschung noch viel zu tun gibt. Die Kritik am derzeitigen Forschungs-stand ist dementsprechend einhellig und massiv. So zog die ehemalige Präsidentin dergrößten internationalen kommunikationswissenschaftlichen Fachgesellschaft (ICA)Sonja Livingstone in ihrem Beitrag »On the mediation of everything« das ernüchterndeFazit: »In short, establishing the degree, nature, and consequences of the mediatizationof anything or everything – politics, education, family, religion, self, – is a task largelyahead of us.« 2
Vor allem im Hinblick auf die Politik, die im Weiteren im Mittelpunkt dieses Beitragsstehen soll, muss dieses Fazit überraschend. Denn der wachsende Einfluss der Medienund dessen vermeintliche Folgen werden hier schon seit mehr als zwei Jahrzehnten auchaußerhalb des wissenschaftlichen Diskurses debattiert.3 Dennoch werden auch im Hin-blick auf die Medialisierung der Politik sowohl der Stand der Theoriediskussion als auchdie Menge und Überzeugungskraft der empirischen Nachweise sehr kritisch beurteilt.So bemängeln Pfetsch und Marcinkowski (2009) in ihrem kürzlich erschienen Vorwortzu einem PVS-Sonderheft, dass es im Hinblick auf die Medialisierung an einem »breitangelegten, überzeugenden Forschungsprogramm« fehle und die Situation im Hinblick
1 Der vorliegende Beitrag ist eine überarbeitete Fassung der Antrittsvorlesung, die der Autor am12. November 2009 vor der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Uni-versität München gehalten hat.
2 Sonja Livingstone, »On the mediation of everything: ICA presidential address 2008« in: Journalof Communication, Jg. 59, H. 1, (2009), S. 7.
3 Z.B. Heinrich Oberreuter, »Mediatisierte Politik und politischer Wertewandel« in: Frank E.Böckelmann, (Hg.), Medienmacht und Politik, Berlin 1989, S. 38.

auf die empirischen Nachweise »prekär« sei: »Insbesondere stehen empirische Studienaus, die zeigen, dass die Medialisierung (…) nicht die Ausnahme, sondern die Regel derMedienperformanz und ihrer Verschränkung mit der Politik ist.«4
Zu dieser sehr skeptischen Einschätzung des Forschungsstandes trägt sicherlich dieUnübersichtlichkeit des Forschungsfeldes bei, in dem sehr unterschiedliche Begriffsde-finitionen und Konzeptualisierungen konkurrieren und in dem vor dem Hintergrundganz verschiedener theoretischer Ansätze eine Vielzahl empirischer Indikatoren ver-wendet werden. Das wichtigste Anliegen des vorliegenden Beitrags ist es deshalb, diebisherige Forschung vor allem im Hinblick auf ihre Begrifflichkeiten zu systematisieren,um dadurch zu einer klareren Konzeption von Medialisierung zu kommen. Sie soll eineSystematisierung und Aufarbeitung bisheriger Studien erleichtern und die künftige em-pirische Forschung von Ursachen, Indikatoren und Folgen der Medialisierung der Politikvorbereiten. Die eigentlich notwendige, umfassende Aufarbeitung bisheriger empirischerStudien kann hier nicht geleistet werden.
Jedoch sei der Hinweis erlaubt, dass wir auch empirisch eigentlich sehr viel mehr überdie Medialisierung der Politik wissen, als es die oben zitierten, sehr pessimistischen Stim-men vermuten lassen. Allerdings werden die empirischen Befunde der deutschen undinternationalen Forschung bisher nur ungenügend rezipiert. Dies liegt vermutlich nichtzuletzt daran, dass viele Studien nicht unter dem Label der »Medialisierung der Politik«publiziert wurden, sondern unter ganz anderen Schlagwörtern wie dem des »Agenda-building« oder dem des »CNN-Effekts«. Doch selbst Studien, die den Terminus im Titelverwenden, werden kaum beachtet.5 Wir werden uns einer entsprechenden Aufarbeitungder empirischen Untersuchungen jedoch an anderer Stelle widmen und bemühen unsstattdessen hier darum, den Medialisierungsbegriff klarer zu konturieren.
2. Die Medialisierung der Politik als Prozess
Der Terminus Medialisierung wird in verschiedenen Disziplinen unterschiedlich ver-wendet. Verwirrung entsteht auf einer grundsätzlichen Ebene schon dadurch, dass mitMedialisierung unterschiedliche Medien-Begriffe und zeitliche Perspektiven verbundenwerden.
Im Hinblick auf den Medienbegriff stehen auf der einen Seite Autoren, die Medien alstechnische Kommunikationsmittel verstehen. Sie interessieren sich für alle Formen dieserKommunikation, unabhängig davon, ob sie öffentlich ist oder redaktionell von Journa-listen der Massenmedien produziert wird. Hierunter fällt dann beispielsweise auch dieprivate interpersonale Kommunikation über Mobiltelefone oder Emails und die oftmalsgeistes- oder kulturwissenschaftlich orientierte Forschung richtet sich unter anderem auf
4 Barbara Pfetsch, / Frank Marcinkowski, »›Problemlage der Mediendemokratie‹. Theorien undBefunde zur Medialisierung der Politik« in: ders. (Hg.), Politik in der Mediendemokratie, PVSSonderheft 42, Wiesbaden 2009, S. 17.
5 Z.B. Daniel Pontzen, Nur Bild, BamS und Glotze? Medialisierung der Politik aus Sicht der Ak-teure, Berlin/Hamburg/Münster 2006.
279 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 279
ZfP 57. Jg. 3/2010

die Folgen der technischen Vermittlung von Kommunikation für Kultur, Alltag undIdentität der Menschen.6 Auf der anderen Seite stehen Autoren, die Medien als Mittelder Massenkommunikation verstehen und sich dementsprechend auf Prozesse öffentli-cher Kommunikation konzentrieren, in denen redaktionell von Journalisten produzierteMedieninhalte eine zentrale Rolle spielen.7 In der Diskussion um die Medialisierung derPolitik wird der Begriff der Medien in aller Regel in diesem Sinne verwendet.
Im Hinblick auf die zeitliche Perspektive wird von Medialisierung in einem statischenund in einem dynamischen Sinn gesprochen. In seiner statischen Verwendung bezeichnetder Begriff schlicht die Verarbeitung und Präsentation von Ereignissen, Themen oderPersonen in und durch Massenmedien. Mit dem Medialisierung wird also beispielsweisedarauf verwiesen, dass Ereignisse durch die spezifischen Regeln medialer Selektion, Pro-duktion und Präsentation in einer spezifischen Weise sozial konstruiert werden. Durchihre Medialisierung wird Realität zu Medienrealität. In diesem Sinne wird der Begriffoftmals im außereuropäischen, vor allem im US-Kontext verwendet. Altheide &Snow8 etwa sprechen von »mediation«, Bennett & Entman9 sowie Nimmo & Combs10
von »mediated politics«, Louw11 von »media-ization«. In seiner dynamischen Verwen-dung bezeichnet Medialisierung dagegen einen Prozess sozialen Wandels, in dessen Ver-lauf sich der Einfluss »der Medien« auf Akteure, Institutionen, deren Handeln und In-teraktionen vergrößert bzw. größer geworden ist als derjenige anderer, nicht-medialerAkteure oder Institutionen. Oftmals ist hier von einer Anpassung an die »Logik derMedien« die Rede. Sie führe dazu, dass sich die Kriterien und Rationalitäten verändern,nach denen Akteure handeln und entscheiden. In diesem Sinne wird Medialisierung12
oder – meist synonym – Mediatisierung bzw. mediatization13 vor allem im europäischenKontext verwendet (Abbildung 1).
6 Z.B. Friedrich Krotz, Mediatisierung. Fallstudien zum Wandel von Kommunikation, Wiesba-den 2007.
7 David L. Altheide, / Robert P. Snow, »Toward a theory of mediation« in: James A. Anderson,(Hg.), Communication Yearbook. Newbury Park/Beverly Hills/London/New Delhi 1988,Bd. 11, S. 194-223; undPatrick Donges, »Medialisierung der Politik – Vorschlag einer Differenzierung« in: PatrickRössler, / Friedrich Krotz, (Hg.), Mythen der Mediengesellschaft – The media society and itsmyths, Konstanz 2005, S. 321-339.
8 David L. Altheide, / Robert P. Snow, Media logic, Beverly Hills 1979.9 W. Lance Bennett, / Robert M. Entman, Mediated politics: Communication in the future of
democracy, Cambridge 2001.10 Dan Nimmo, / James E. Combs, Mediated political realities, 2. Auflage, New York/London
1990.11 Eric Louw, The media and the political process, London/Thousand Oaks/New Delhi 2005.12 Z.B. Winfried Schulz, Politische Kommunikation: Theoretische Ansätze und Ergebnisse empi-
rischer Forschung, Wiesbaden 2008; und Michael Meyen, »Medialisierung« in: Medien & Kom-munikationswissenschaft, Jg. 57, H. 1 (2009), S. 23-38.
13 Z.B. Ulrich Sarcinelli, »Mediatisierung« in: Otfried Jarren, / Ulrich Sarcinelli, / Ulrich Saxer,(Hg.), Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft, Opladen 1998,S. 678-679; Gianpetro Mazzoleni, / Winfried Schulz, » ›Mediatization‹ of politics: A challengefor democracy?« in: Political Communication, Jg. 16, H. 3 (1999), S. 247-261; Gerhard Vowe,»Mediatisierung der Politik? Ein theoretischer Ansatz auf dem Prüfstand« in: Publizistik, Jg.
280 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 280

Abbildung 1: Verwendungsweisen der Begriffe Medialisierung/Mediatisierung
Medienbegriff
Mittel technischvermittelter Kom-munikation(privat oder öffent-lich)
Mittel derMassenkommunika-tion (öffentlich)
Zeitliche Perspektive
statisch(Ist-Zustand)
z.B. Krotz (2007) z.B. Altheide & Snow1987; Bennet & Ent-man (2001); Louw(2005)
dynamisch(Wandel)
z.B. Krotz (2007) z.B. Sarcinelli 1998;Vowe 2006; Kepplin-ger 2008; Schulz 2008
Eigene Darstellung.
Wir werden uns im Folgenden auf Medialisierung als dynamischen Prozess konzentrie-ren, in dem öffentliche Kommunikation in Massenmedien eine zentrale Rolle spielt. Esstellt sich dann in einem nächsten Schritt die Frage, wer oder was sich denn »medialisiert«,wenn von einer Medialisierung der Politik die Rede ist. Sarcinelli hat in diesem Zusam-menhang eine recht weitreichende Verwendungsweise des Begriffs vorgeschlagen. Dem-nach bezeichnet Medialisierung dreierlei, nämlich die wachsende Verschmelzung vonMedienwirklichkeit und politischer wie sozialer Wirklichkeit, die zunehmende Wahr-nehmung von Politik im Wege medienvermittelter Erfahrung sowie die Ausrichtungpolitischen Handels und Verhaltens an den Gesetzmäßigkeiten der Medien.14
In Erweiterung bzw. Präzisierung dieser Definition halten wir es für sinnvoll, die Me-dialisierung der Politik an den drei Akteursgruppen festzumachen, die in modernenMassendemokratien das Dreieck politischer Kommunikation und Meinungsbildung dar-stellen. Als Objekte der Medialisierung können demnach Bürger, Medien und politischeAkteure verstanden werden. Dem entsprechend lassen sich Medialisierungsphänomeneauf der Mikro-, der Meso- und/oder der Makroebene konzeptualisieren und empirischanalysieren. Für alle drei Gruppen steigt im – angenommenen – Prozess der Medialisie-rung die Bedeutung von Massenmedien, massenmedialer Berichterstattung und/oderMedienlogik. Die drei genannten Elemente des Medienbegriffs sollen dabei auf institu-tionelle (Massenmedien), inhaltliche (Berichterstattung) bzw. die Handlungsrationalität
51, H. 4 (2006), S. 433-436; Stig Hjarvard, »The mediatization of society. A theory of the mediaas agents of social and cultural change« in: Nordicom Review, Jg. 29, H. 2 (2008), S. 105-134;Jesper Strömbäck, »Four phases of mediatization: An analysis of the mediatization of polit-ics« in: The Harvard International Journal of Press/Politics, Jg. 13, H. 3 (2008), S. 228-246; undHans Mathias Kepplinger, »Was unterscheidet die Mediatisierungsforschung von der Medi-enwirkungsforschung?« in: Publizistik, Jg. 53, H. 3 (2008), S. 326-338.
14 Vgl. Sarcinelli, Mediatisierung, aaO. (FN 13), S. 678 f.
281 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 281
ZfP 57. Jg. 3/2010

betreffende Aspekte (Medienlogik) verweisen. Medialisierung der Politik kann also ver-standen werden:
(1) als steigende Bedeutung von Medien, massenmedialer Berichterstattung und/oderMedienlogik für die Wahrnehmung und Beurteilung von Politik durch die Bürger sowieeine daraus vermutlich resultierende wachsende Bedeutung von Medien für die politi-schen Entscheidungen der Bürger, etwa für politische Partizipation, Wahlteilnahme oderdie Richtung von Wahlentscheidungen.15
(2) als steigende Bedeutung von Medien, massenmedialer Berichterstattung und/oderMedienlogik für Selektions- und Präsentationsentscheidungen im Rahmen der politi-schen Berichterstattung der Massenmedien selbst. Damit ist beispielsweise gemeint, dasspolitische Überzeugungen oder Gemeinwohlorientierung zugunsten solcher Entschei-dungskriterien in den Hintergrund gedrängt werden, die letztlich ökonomischen Erfolgsichern sollen, also die zunehmende Orientierung an Nachrichtenwerten wie Aktualität,Konflikt und Negativismus oder auch die Selbstreferentialisierung von Berichterstat-tung.16
(3) als steigende Bedeutung von Medien, massenmedialer Berichterstattung und/oderMedienlogik für die Wahrnehmungen und das Handeln politischer Akteure, wobei hierpolitische Akteure im engeren Sinn gemeint sind, also nicht die Bürger in ihren politi-schen Rollen, sondern vornehmlich Regierungen, Parteien, Interessenverbände und ihreRepräsentanten, aber durchaus auch Verwaltungen, Ministerien etc.
Auf Basis der bisherigen Überlegungen kann man die Medialisierung der Politik alsowie folgt definieren:
Mit »Medialisierung der Politik« ist ein Prozess sozialen Wandels gemeint, in dessenVerlauf die Bedeutung von Massenmedien, massenmedialer Berichterstattung und/oder massenmedialer Logik für die politisch relevanten Wahrnehmungen und Hand-lungen von Bürgern, Medien und/oder politischen Akteuren zunimmt.
Wir werden uns im Folgenden vor allem mit der Medialisierung der Wahrnehmung unddes Handelns politischer Akteure im engeren Sinne beschäftigen. Diesen Prozess wollenwir auch als Medialisierung politischer Akteure bezeichnen. Die Seite der Medien undRezipienten werden wir nur in dem Maße berücksichtigen, in dem sie für die Verände-rungen auf Seiten der Politik unmittelbar relevant ist. Will man nun die Medialisierungpolitischer Akteure als Prozess beschreiben und erklären, dann stellen sich vor allem dreiFragen: 1. Was sind die Ursachen der Medialisierung? 2. Was sind die Indikatoren der
15 Z.B. Sarcinelli, Mediatisierung, aaO. (FN 13); und Winfried Schulz, / Reimar Zeh, / OliverQuiring, »Voters in a changing media environment: A data-based retrospective on conse-quences of media change in Germany« in: European Journal of Communication, Jg. 20, H. 1(2005), S. 55-88.
16 Vgl. Kurt Imhof, »Mediengesellschaft und Medialisierung« in: Medien und Kommunikations-wissenschaft, Jg. 54, H. 2 (2006), S. 191-215; Otfried Jarren, / Werner A. Meier, (Hg.), Ökono-misierung der Medienindustrie: Ursachen, Formen und Folgen. Themenheft Medien & Kom-munikationswissenschaft 49/2, Baden-Baden 2001; und Carsten Reinemann, / Jana Huismann,»Beziehen sich Medien immer mehr auf Medien? Dimensionen, Belege, Erklärungen« in: Pu-blizistik, Jg. 52, H. 4 (2007), S. 465-484.
282 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 282

Medialisierung, d.h. woran erkennt man eine veränderte Bedeutung von Medien, Medi-enberichterstattung oder Medienlogik? 3. Was sind die Folgen der Medialisierung?
Wie Donges deutlich macht, sind Ursachen, Indikatoren und Folgen oftmals Bestand-teil der Definitionen von Medialisierung.17 Dies führt zum Teil dazu, dass Ursachen undFolgen als bekannt vorausgesetzt und nicht mehr hinterfragt werden. Genau dies aberwollen wir im Folgenden tun. Dabei wird deutlich werden, dass die Medialisierungsfor-schung vor allem im Hinblick auf die Konzeptualisierung und empirische Untersuchungvon Ursachen und Folgen der Medialisierung noch am Anfang steht. Es dominierenvielmehr Thesen und Vermutungen auf recht dünner empirischer Basis.
3. Ursachen der Medialisierung politischer Akteure
Im Hinblick auf die Ursachen eines verstärkten Medieneinflusses stellen sich vor allemzwei Fragen, die bislang nicht hinreichend differenziert und geklärt worden sich. Zumeinen, welchen Beitrag zur Medialisierung die Medien selbst und welchen Beitrag andereProzesse gesellschaftlichen Wandels geleistet haben. Zum zweiten, wenn man einen kau-salen Einfluss des Medienwandels annimmt, welche Veränderungen der Medien, derMedienberichterstattung oder der Medienlogik es denn nun genau sein sollen, die einenstärkeren Medieneinfluss bedingen. Die Unklarheit über die Ursachen der Medialisie-rung wird dabei auch darin deutlich, dass sich in der Literatur ganz unterschiedlicheEinschätzungen dazu finden, ab wann überhaupt von einer Medialisierung der Politikgesprochen werden kann. Während einige Autoren diese am Aufkommen des Fernse-hens18 oder später bei der Einführung des dualen Rundfunks ansetzen,19 sehen anderebereits mit dem Aufkommen der Massenpresse erste Medialisierungsschübe.20
Die Kommunikationswissenschaft neigt in der Medialisierungsdiskussion dazu, Ver-änderungen der Medien als ursächlich für Medialisierungsprozesse zu betrachten.21
Manche Autoren bezeichnen nur das als Medialisierung, was sich tatsächlich durch me-diale Veränderungen erklären lässt. Hat man allerdings die veränderte Bedeutung vonMedien für politische Akteure als abhängige Variable im Blick – also etwa einen Wandelihrer Handlungsrationalität oder eine stärkere Beachtung von Medienberichterstattung–, dann könnte eine solche Medialisierung ihres Handelns natürlich auch völlig ohne
17 Vgl. Donges, Medialisierung der Politik – Vorschlag einer Differenzierung, aaO. (FN7), S. 324;Michael Meyen, »Medialisierung« in: Medien & Kommunikationswissenschaft, Jg. 57, H. 1(2009), S. 23-38; Winfried Schulz, Politische Kommunikation: Theoretische Ansätze und Er-gebnisse empirischer Forschung, Wiesbaden 2008; und Hjarvard, The mediatization of society.A theory of the media as agents of social and cultural change, aaO. (FN 13), S. 105-134.
18 Winfried Schulz, »Reconstructing mediatization as an analytical concept« in: European Journalof Communication, Jg. 19, H. 1 (2004), S. 87-101.
19 Imhof, Mediengesellschaft und Medialisierung, aaO. (FN16), S. 191-215.20 Frank Bösch, / Norbert Frei, »Die Ambivalenz der Medialisierung. Eine Einführung« in: ders.
(Hg.), Medialisierung und Demokratie im 20. Jahrhundert, Göttingen 2006, S. 7-23.21 Vgl. Meyen, Medialisierung, aaO. (FN 17), S. 23-38; und Andrea Schrott, »Dimensions: Catch-
All Label OR Technical Term« in: Knut Lundby, (Hg.), Mediatization. Concept, Changes,Consequences, New York 2009, S. 41-61.
283 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 283
ZfP 57. Jg. 3/2010

mediale Veränderungen zustande gekommen sein. So könnten sich politische Akteure inihrem Handeln an journalistische Kriterien der Selektion und Präsentation von Nach-richten allein schon deshalb angepasst haben, weil sich infolge des sozialen Wandels dietraditionellen Parteiloyalitäten auflösen und es die Politik mit einer wachsenden Zahlvon Wechselwählern und Spätentscheiden zu tun hat, von denen man annimmt, dass siefür Wirkungen massenmedial vermittelter politischer Kommunikation besonders anfäl-lig sind.22
Es ist also nach wie vor eine offene empirische Frage, ob der Medienwandel die primäreUrsache der Medialisierung ist, ob dieser eine unter mehreren Ursachen darstellt oderob medialer und politischer Wandel nur parallel verlaufen. Ja, vermutlich gibt es einenBeitrag medialer Veränderungen zur Medialisierung der Politik. Wahrscheinlich ist aberauch, dass Entwicklungen wie beispielsweise die Auflösung traditioneller Milieus unddie damit einhergehende Abnahme von Parteibindungen in der Bevölkerung sowie diezunehmende Volatilität politischer Stimmungen wohl immensen Einfluss auf die Me-dialisierung des Handelns politischer Akteure gehabt haben. Um es auf den Punkt zubringen: Angesichts abnehmender politischer Loyalitäten hätte sich die Politik wohl auchdann stärker an die Medien angepasst, wenn sich die Medien selbst gar nicht veränderthätten. Realistischerweise ist deshalb davon auszugehen, dass sich medialer, gesellschaft-licher und politischer Wandel wechselseitig bedingen und in ihrer Interaktion für Me-dialisierungsprozesse verantwortlich sind.23 Eine theoretische Rekonstruktion dieser ge-genseitigen Einflussprozesse steht allerdings noch aus.
Unbefriedigend ist bislang auch die Frage beantwortet, welche Aspekte medialenWandels in welche Weise mit welchen Medialisierungsphänomenen in Beziehung stehensollen. In der Literatur wird Medialisierung häufig relativ abstrakt auf einen »Struktur-wandel des Mediensystems«, »den Medienwandel« oder auch schlicht auf »gesellschaft-lichen Wandel« zurückgeführt.24 Zuweilen wird Medialisierung aber auch als Metapro-zess charakterisiert, der sich eigentlich gar nicht recht erklären ließe. Für die sozialwis-senschaftliche Analyse eines gesellschaftlichen Phänomens wäre der Begriff damit aberweitgehend unbrauchbar.25 Im Hinblick auf die Medialisierung politischer Akteure solltein jedem Fall intensiver diskutiert werden, welche Aspekte des Medienwandels denn nungenau zu welchen Veränderungen auf Seiten der politischen Akteure geführt haben sol-len?
Ist die Ursache der Medialisierung politischer Akteure die allgemeine Medienexpan-sion, die sich in der enormen Ausweitung und Differenzierung von Medienangeboten
22 Carsten Reinemann, / Marcus Maurer, / Olaf Jandura, / Thomas Zerback, »Die Spätentschei-der. Wer sind sie und wie entscheiden sie sich?« in Heinrich Oberreuter, (Hg.), Der Bundes-tagswahlkampf 2009 (Arbeitstitel), München 2010 (im Vorbereitung).
23 Z.B. Christina Holtz-Bacha, »Professionalisation of politics in Germany« in: Ralph Negrine, /Paolo Mancini, / Christina Holtz-Bacha, / Stylianos Papathanassopoulos, (Hg.), The profes-sionalisation of political communication, Chicago 2007, S. 63-79; und Schulz, Politische Kom-munikation: Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung, aaO. (FN 17).
24 Schrott, Dimensions: Catch-All Label OR Technical Term, aaO. (FN 21), S. 41-61.25 Vgl. z.B. Krotz, Mediatisierung. Fallstudien zum Wandel von Kommunikation, aaO (FN 6).
284 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 284

zeigt? Sind es bestimmte technische Innovationen (z.B. Digitalisierung)? Ist es der Sie-geszug des Fernsehens oder neuerdings der Online-Medien? Ist es die Deregulierung imRundfunkbereich, die zur Entstehung des dualen Rundfunksystems geführt hat? Sind eswachsende Konkurrenz, Ökonomisierung und Publikumsorientierung im Journalis-mus? Sind es die infolgedessen sich verändernden inhaltlichen Strukturen der Medien-angebote, die mit Schlagwörtern wie Unterhaltungsorientierung, Visualisierung, Perso-nalisierung, Negativismus oder Konfliktorientierung umschrieben werden? Sind es dieveränderten journalistischen Arbeitsweisen, die sich etwa in einer wachsenden Beschleu-nigung und Selbstreferentialisierung des Journalismus zeigen? Oder ist es gar nicht pri-mär der Medienwandel selbst, sondern vor allem die Veränderung der Bedeutung derMedien als Quelle politischer Information der Bürger? Oder ist es die Veränderung derNutzungsmuster, die zunehmende Zersplitterung des Publikums oder die durch verän-derte Berichterstattungsmuster sich verändernden Kriterien der Bürger bei der Beurtei-lung von Politik? Und vor allem: In welcher Art und Weise wurden diese Veränderungenvon den politischen Akteuren wahrgenommen und wie haben sie zu welchen konkretenVeränderungen von Handlungsweisen oder organisatorischen Strukturen geführt?
Angesichts der unklaren Ursachen einer möglichen Medialisierung ist es sinnvoll, diesemöglichen Ursachen nicht zum Bestandteil einer Definition von Medialisierung zu ma-chen. Vielmehr halten wir es für sinnvoll, in Erweiterung der oben vorgeschlagenen De-finition von einer Kausalkette auszugehen, die die Ursachen der Medialisierung zunächstoffen lässt und stattdessen die Wahrnehmungen der politischen Akteure in den Blicknimmt. Eine solche Kausalkette regt einerseits dazu an, ein breites Spektrum möglicherFaktoren als Ursachen der Medialisierung in den Blick zu nehmen und richtet anderer-seits den Blick auf das mögliche Missverhältnis von wahrgenommenen und realen Me-dieneinflüssen. In diesem Sinne kann man davon ausgehen, dass die Ursachen der Me-dialisierung sich folgendermaßen beschreiben lassen:
Die Ursache der Medialisierung politischer Akteure besteht in der Annahme der Ak-teure, dass die Wirkungschancen von Medien auf sie selbst, auf Wähler, auf politischeFreunde oder Gegner größer geworden sind. Sie neigen daher eher dazu, möglicheWirkungen von Medienberichterstattung zu antizipieren und sie richten ihr Handelnbei der Darstellung und/oder Herstellung von Politik deshalb verstärkt an massen-medialer Berichterstattung und/oder Medienlogik aus.
Folgt man dieser Sichtweise, dann ist der Ausgangspunkt der Medialisierung nicht not-wendiger ein tatsächlicher Wandel von Medien oder Medieneinflüssen, sondern zunächsteinmal die veränderte Wahrnehmung von Medieneinflüssen. Medialisierung ergibt sichalso zunächst daraus, dass politische Akteure Medien als wirkungsvoll bzw. wirkungs-voller wahrnehmen26 und diese Vorstellungen handlungsleitend werden. Dementspre-chend sind die bei politischen Akteuren auftretenden Verzerrungen in der Wahrneh-mung von Medienberichterstattung (z.B. Hostile Media Phenomenon), in den Annah-men über Medieneffekte (z.B. Third-Person-Effekt) sowie dies daraus resultierenden
26 Vgl. Altheide, / Snow, Media logic, aaO. (FN 8), S. 236 f.
285 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 285
ZfP 57. Jg. 3/2010

Auswirkungen auf politisches Handeln von zentraler Bedeutung für die Medialisie-rungsforschung. Nicht umsonst werden diese psychologischen Konzepte zunehmendzum Gegenstand kommunikationswissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung(z.B. reziproke Effekte;27 Theory of presumed media influence).28
4. Indikatoren der Medialisierung politischer Akteure
Definiert man die Medialisierung politischer Akteure in der skizzierten Weise, dann stelltsich in einem nächsten Schritt die Frage, wie politische Akteure auf die wahrgenommeneBedeutungssteigerung der Medien konkret reagieren? Was also sind die Indikatoren derMedialisierung? Sucht man nach solchen Indikatoren, dann wird man nicht nur in derLiteratur zur Medialisierung, sondern auch in vielen Beiträgen fündig, die sich generellmit dem Verhältnis von Politik und Medien auseinandersetzen.
Auf einer relativ abstrakten Ebene wird oftmals von einer Anpassung der Politik andie Medienlogik29 oder von einer Ausrichtung der Politik an der Medienlogik30 gespro-chen. Andere Autoren bevorzugen den Begriff der Reaktion, um deutlich zu machen,dass politische Akteure und Organisationen verschiedene Möglichkeiten haben, mit denAnforderungen der Mediengesellschaft umzugehen.31 Eher abstrakte Indikatoren wer-den auch in verschiedenen Phasenmodellen genannt, die die Entwicklung der Mediali-sierung der Politik beschreiben wollen.32 Betrachtet man konkretere Indikatoren, dannfinden sich darunter sowohl solche, die sich primär auf die Darstellung von Politik be-ziehen, als auch solche, die sich auf die Herstellung von Politik beziehen, also auf dieinhaltliche Substanz und damit den Kern des politischen Prozesses.
Zu den Indikatoren für eine Medialisierung der Darstellung von Politik gehören unteranderem (a) eine generell größere »Offenheit« für Medien und Journalisten; (b) die Zu-nahme von Medienaktivitäten bzw. des dafür aufgewandten zeitlichen oder finanziellenBudgets (z.B. für Kontakte zu Journalisten, Medienauftritte, Medienmonitoring, Pres-searbeit, Inszenierung von Kampagnen); (c) die Professionalisierung von Medienaktivi-täten, die sich in individuellen Aktivitäten wie Medientrainings, aber auch in strukturel-len Änderungen wie der Einrichtung von Pressestellen oder Rapid-Response Units, de-ren organisatorischer Verortung (etwa als Stabsstelle), der Personalrekrutierung und derHinzuziehung externer Experten niederschlagen kann; (d) die zunehmend medienge-rechte öffentliche Kommunikation, die sich beispielsweise in einer Vereinfachung, Ver-
27 Hans Mathias Kepplinger, »Politiker als Protagonisten der Medien« in: Zeitschrift für Politik,Jg. 54, S. S. 274-295.
28 Jonathan Cohen, / Yariv Tsfati, / Tamir Sheafer, »The influence of presumed media influencein politics: Do politicians' perceptions of media power matter?« in : Public Opinion Quarterly,Jg. 1 (2008), S. 1-14.
29 Schulz, Reconstructing mediatization as an analytical concept, aaO. (FN 18), S. 87-101.30 Vgl. Sarcinelli, Mediatisierung, aaO. (FN 13), S. 678-679.31 Patrick Donges, Medialisierung politischer Organisationen. Parteien in der Mediengesell-
schaft, Wiesbaden 2008, S. 218.32 Z.B. Jesper Strömbäck, »Four phases of mediatization: An analysis of the mediatization of
politics« in: The Harvard International Journal of Press/Politics, Jg. 13, H. 3 (2008), S. 228-246.
286 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 286

kürzung, Zuspitzung etc. von Sachverhalten, Argumentationen und Entscheidungspro-zessen zeigen kann.
Zur Systematisierung der Indikatoren, die sich unmittelbar auf die Herstellung vonPolitik, also den Kern politischer Personal- und Policy-Entscheidungen beziehen, kannman typische Modelle von Politik-Zyklen heranziehen. Dann kann sich eine Mediali-sierung politischer Akteure nicht »nur« in der (a) Problemdefinition und (b) der The-mensetzung für die Politik, sondern auch in der (c) Formulierung und Auswahl vonPolicy-Alternativen sowie deren (d) Implementation und (e) Evaluation zeigen. Dasssolche Einflüsse von Medien auf politische Akteure nicht nur in der Theorie, sondernauch in der Praxis prinzipiell bestehen, dies zeigen nicht nur diverse internationale Stu-dien, die sich ganz unterschiedlicher Methoden und Designs bedienen und unterschied-liche Akteure, Politikebenen, Politikfelder und Ländern untersuchen.33 Auch fürDeutschland gibt es deutliche Hinweise auf solche substanziellen Einflüsse. Sie stammennicht nur aus Anekdoten, die sich immer wieder in der alltäglichen Medienberichter-stattung finden. Auch wissenschaftliche Studien sind hier zu nennen. So gab ein Drittelder Bundes- und Landtagsabgeordneten in einer Befragung aus dem Jahr 2005 an, dieMedien hätten bei der Themensetzung für die Politik mehr Einfluss als diese selbst. Einweiteres Drittel der Abgeordneten sah hier ein Gleichgewicht von Politik und Medien.Ein weiterer Befund: Fast die Hälfte der Befragten war der Ansicht, die Chancen eineskomplexen und nicht medientauglichen Themas, überhaupt in den Gesetzgebungspro-zess zu kommen, seien heute geringer als früher.34
Leider werden die unterschiedlichen Facetten von Medialisierung oftmals nicht hin-reichend differenziert. Dann wird zuweilen von einer Medialisierung der Darstellung aufeine Medialisierung der Herstellung von Politik geschlossen oder umgekehrt eine Me-dialisierung ihrer Herstellung a priori ausgeschlossen.35 Für die Frage der gesellschaftli-chen Relevanz der Medialisierungsforschung, aber auch für normative Beurteilung einerMedialisierung des Handelns politischer Akteure, ist die Differenzierung zwischen derForm und dem Inhalt von Politik dabei jedoch von fundamentaler Bedeutung. Beziehtsich eine Medialisierung allein auf die im Zweifel professionellere Darstellung von Poli-tik, dann sind die Folgen einer Medialisierung wohl bei weitem nicht so relevant oderauch problematisch, als wenn sich die Substanz der Politikherstellung den Gesetzmä-
33 Z.B. Matthew A. Baum, Soft news goes to war. Public opinion and American foreign policy inthe new media age, Princeton 2003; Cohen et al., The influence of presumed media influencein politics: Do politicians' perceptions of media power matter? aaO. (FN 29), S. 1-14.; BryanD. Jones, / Frank R. Baumgartner, The politics of attention: How government prioritizes pro-blems, Chicago/London 2005; Martin Linsky, Impact: How the press affects federal policy-making, New York 1986; Stefaan Walgrave, / Peter van Aelst, »The contingency of the massmedia's political agenda setting power. Toward a preliminary theory« in: Journal of Commu-nication, Jg. 56, H. 1 (2006), S. 88-109; und Stefaan Walgrave, »Again, the almighty mass media?The media's political agenda-setting power according to politicians and journalists in Bel-gium« in: Political Communication, Jg. 25, H. 4 (2008), S. 445-459.
34 Vgl. Pontzen, Nur Bild, BamS und Glotze? Medialisierung der Politik aus Sicht der Akteure,aaO. (FN 5), S. 93.
35 Vgl. Karl-Rudolf Korte, / Manuel Fröhlich, Politik und Regieren in Deutschland: Strukturen,Paderborn 2006. S. 15.
287 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 287
ZfP 57. Jg. 3/2010

ßigkeiten medialen Erfolgs oder den Konjunkturen medialer Berichterstattung unter-werfen würde. Wir wollen deshalb in Abhängigkeit davon, ob die Medialisierung dieHerstellung oder die Darstellung von Politik betrifft, von unterschiedlichen Graden derMedialisierung sprechen (Abbildung 2):
Die Medialisierung politischer Akteure kann sowohl die Darstellung als auch die Her-stellung von Politik betreffen. Je eher sich die Medialisierung auch auf Handlungenbezieht, die der Herstellung von Politik zuzurechnen sind, desto höher ist der Gradder Medialisierung des politischen Handelns. Je eher sich die Medialisierung vor allemauf Handlungen bezieht, die vor allem der Darstellung von Politik zuzurechnen sind,desto niedriger ist der Grad der Medialisierung der Politik.
Abbildung 2: Indikatoren für die Medialisierung politischer Akteure
13
Abbildung 2: Indikatoren für die Medialisierung politischer Akteure
Eigene Darstellung
• Orientierung bei Policy-Entscheidungen
• Orientierung bei Personalentscheidungen
• Orientierung bei Themenauswahl
• Orientierung bei öffentlichen Aussagen
• Zunahme von Medienaktivitäten/Inszenierungen
• Professionalisierung von Medienaktivitäten
• Offenheit gegenüber Medien
Darstellung (Form) Herstellung (Substanz)
Grad der Medialisierung
der Politik
Dimension von Politik
hoch
niedrig
Eigene Darstellung
5. Folgen der Medialisierung politischer Akteure
In der Diskussion um die Medialisierung politischer Akteure werden vor allem negativeFolgen dieser Entwicklung befürchtet. Die möglichen Folgen beziehen sich auch auf dieRückwirkungen der Medialisierung politischen Handelns auf Medien und Rezipienten,insbesondere in der politikwissenschaftlichen Diskussion überwiegt jedoch eine The-matisierung von Medialisierungsfolgen für die Politik selbst. So ist nicht nur von einemAutonomie-, sondern auch von einem Machtverlust der Politik gegenüber den Mediendie Rede. Allerdings finden sich durchaus auch Stimmen, die zwar eine Anpassung derPolitik an die Medienlogik konstatieren, damit aber nicht unbedingt einen Machtverlustder Politik verbunden sehen wollen. Für diese Autoren ist die Antizipation von Medi-enlogik durch politische Akteure zuvorderst ein Mittel zum Machterhalt und eine Mög-lichkeit, die Chancen zur Instrumentalisierung von Medien zu erhöhen. Wer die Selek-
288 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 288

tions- und Präsentationsregeln der Medien kennt und antizipiert, so die Argumentation,kann dieses Wissen durch geschicktes Kommunikationsmanagement zum eigenen Vor-teil nutzen. Er verliert dadurch nicht etwa an Autonomie und an Macht über die Medienund deren Publikum, sondern bringt sich in eine bessere Position zur Erreichung seinerZiele.36 Am überzeugendsten ist eine solche Argumentation dann, wenn sie sich auf dieDarstellung von Politik bezieht. Geht es um die Substanz von Politik, wird Anpassungsehr viel eher mit Machtverlust einhergehen.
Dass die Medialisierung des Handelns politischer Akteure nicht unbedingt mit einemMachtverlust einhergehen muss, legen im übrigen auch parallel ablaufende Wandlungs-prozesse in Medien und Journalismus nahe, die den Erfolg von Instrumentalisierungs-versuchen wahrscheinlicher machen. So werden deutsche Journalisten angesichts deswachsenden ökonomischen Drucks und schwindender Ressourcen für die journalisti-sche Arbeit (z.B. Recherche) zunehmend abhängig von ihren Quellen in Wirtschaft, Po-litik, Gesellschaft und anderen Medien.37 Nicht zwingend ist die Annahme eines Macht-verlusts durch Medialisierung auch deshalb, weil ihr zumindest implizit eine linear-de-terministische Vorstellung von sozialem Wandel zugrunde liegt. Sie lässt mögliche Ge-genreaktionen von Akteuren unberücksichtigt. So kann die Antizipation von Medien-logik oder Medienberichterstattung auch dazu führen, dass politische Akteure Vorhaben,Überlegungen oder Handlungsalternativen nicht öffentlich kommunizieren. Dies wäreaus Sicht mancher realistischer Demokratietheorie vielleicht als notwendig und funktio-nal anzusehen, aus Sicht anderer demokratietheoretischer Vorstellungen jedoch ein pro-blematischer Verlust an politischer Transparenz.38 Schließlich bleibt in dem scheinbarenNullsummenspiel der Einflussverschiebung von der Politik auf die Medien unberück-sichtigt, dass die eigentlichen Einflusszuwächse in den letzten Jahren unter Umständengerade bei jenen neuen Akteuren zu suchen sind, die die Governance-Forschung in denBlick nimmt und die an politischer Öffentlichkeit unter Umständen gar kein oder nurdann Interesse haben, wenn sie die Politik unter Druck setzen wollen (z.B. Unternehmen,Verbände, NGOs).
Zusätzlich zur eher recht abstrakten These einer generellen Machtverschiebung zuden Medien werden noch weitere negative Folgen der Medialisierung befürchtet. So fin-det sich die Annahme, dass Medienkompetenz anstelle von Sachkompetenz zum zen-tralen Erfolgsfaktor für Politiker würden;39 dass die Parteien sich zunehmend zentrali-
36 Z.B. Daria W. Dylla, »Der Einfluss politischer Akteure auf die Politikberichterstattung. Selbst-medialisierung der Politik?« in: Thomas Jäger, / Henrike Viehrig, (Hg.), Die amerikanischeRegierung gegen die Weltöffentlichkeit?: Theoretische und empirische Analysen der Public Di-plomacy zum Irakkrieg, Wiesbaden 2008, S. 53-76.
37 Z.B. Siegfried Weischenberg, / Maja Malik, / Armin Scholl, Die Souffleure der Mediengesell-schaft. Report über die Journalisten in Deutschland, Konstanz. 2006.
38 Dazu Philip Baugut, / Maria-Theresa Grundler, Politische (Nicht-)Öffentlichkeit in der Me-diendemokratie. Eine Analyse der Beziehungen zwischen Politikern und Journalisten in Ber-lin. Baden-Baden 2009.
39 Z.B. Danilo Zolo, Die demokratische Fürstenherrschaft, Göttingen 1997, S. 200 f.
289 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 289
ZfP 57. Jg. 3/2010

sieren und von ihrem Spitzenpersonal abhängig machen würden;40 dass die Etablierungder Medien als neue Politikarenen zu einer Sinnentleerung der Parlamente beitrügen.41
Aber auch massive Auswirkungen auf die Strukturen des politischen Prozesses werdenbefürchtet. So ist von einer geringeren Thematisierungskompetenz der Politik und einerzunehmenden Hinwendung zu medien-adäquaten Themen die Rede.42 Befürchtungenbetreffen außerdem die Frage, ob politische Akteure überhaupt noch den Versuch ma-chen, politische Konzepte und Entscheidungen öffentlich zu erklären bzw. die Bürgervon ihnen zu überzeugen. Und die Befürchtungen reichen auch in den Kern politischerEntscheidungen, wenn die These vertreten wird, symbolische Politik und Populismuskönnten als Folge der Medialisierung um sich greifen und die Medialisierung führe zueiner Abnahme der Qualität politischer Entscheidungen.43
Allerdings gibt es bislang keinerlei Studien, die den Versuch machen, solche weit rei-chenden Folgen der Medialisierung auch empirisch nachzuweisen. Ebenso wenig werdenmögliche positive Folgen einer Medialisierung der Politik diskutiert, etwa im Sinne einerSteigerung von kommunikativer Kompetenz auf Seiten der politischen Akteure oder imSinne von gesteigerter Responsivität. Dies liegt vor allem daran, dass zuweilen übersehenwird, dass der Grund für eine möglicherweise gewachsene Medienorientierung in ersterLinie nicht die Medien selbst, sondern deren Wirkungen auf andere politische Akteureoder die Bürger sind. Auch hier liegt noch ein großes Potential für künftige Forschung.
6. Ausblick: Theoretische und empirische Herausforderungen
Nachdem wir der Vielzahl von Diskussionsbeiträgen zur Medialisierung der Politik ei-nen weiteren hinzugefügt haben, möchten wir in der gebotenen Kürze noch einen Aus-blick auf die theoretischen und empirischen Herausforderungen werfen, vor denen dieMedialisierungsforschung derzeit steht:
Aus theoretischer Sicht stecken in der Medialisierungsdiskussion eine Fülle von An-nahmen: Über Wahrnehmungsprozesse von Akteuren; über die Antizipation von Me-dienwirkungen, die Einfluss auf die Darstellung oder Herstellung von Politik nehmenkönnen; über grundsätzliche Veränderungen der Handlungsrationalität politischer Ak-teure; über Dynamiken sozialen Wandels und über mögliche Folgen der Medialisierung
40 Z.B. Ulrich von Alemann / Stefan Marschall, »Parteien in der Mediendemokratie – Medien inder Parteiendemokratie« in: ders. (Hg.), Parteien in der Mediendemokratie, Wiesbaden 2002,S. 28ff.
41 Z.B. Stefan Marschall, »Das Parlament in der Mediengesellschaft – Verschränkungen zwischenparlamentarischer und massenmedialer Arena« in: Politische Vierteljahresschrift, 42, 3 (2001),S. 407.
42 Z.B. Wolfgang Hüning, / Jens Tenscher, »Medienwirkungen von Parteistrategien. Agenda-Building-Prozesse im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf 2000« in: Ulrich Sarcinel-li, / Heribert Schatz, (Hg.), Mediendemokratie im Medienland?, Opladen 2002, S. 289-317; undWalgrave, / van Aelst, The contingency of the mass media's political agenda setting power.Toward a preliminary theory, aaO. (FN 35), S. 88-109.
43 Pfetsch / Marcinkowski, ›Problemlage der Mediendemokratie‹. Theorien und Befunde zurMedialisierung der Politik, aaO. (FN4), S. 11-33.
290 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 290

auf Mikro-, Meso- und Makroebene. Ein theoretischer Rahmen, innerhalb dessen sichMedialisierungsprozesse sinnvoll beschreiben und erklären lassen, muss idealerweise dieMöglichkeit bieten, alle diese Annahmen zu konzeptualisieren und in empirische For-schung zu überführen. Dabei sollte er anschlussfähig sein an kommunikations- und po-litikwissenschaftliche Konzepte der Journalismus-, Rezeptions-, Medienwirkungs-,Wahl- und Einstellungs- sowie der Policy-Forschung. Die in der Literatur bislang be-vorzugten handlungs-,44 institutionen-45 und systemtheoretischen Ansätze46 erfüllendiese Kriterien unterschiedlich gut. Wir plädieren hier für die Anwendung eines ak-teursorientiterten Paradigmas wie dem des strukturell-individualistischen Ansatzes.47
Einer der Vorteile dieses Ansatzes ist, dass er ein ausdifferenziertes Konzept sozialenWandels bereithält, das sich als Heuristik für die Rekonstruktion der mit der Mediali-sierungsannahme verbundenen Prozesse und Interaktionen eignet. Zudem ermöglicht erdie Explizierung von Mikro-, Meso-, Makro-Links und erlaubt es, die Differenzen vonAkteuren und Situationen zu konzeptualisieren. Diese Möglichkeit ist außerordentlichbedeutsam. Denn wenn es ein halbwegs konstantes Ergebnis der bisherigen empirischenForschung zur Medialisierung politischer Akteure gibt, dann dies, dass es offensichtlich(1) erhebliche stabile Differenzen zwischen der Her- und Darstellung von Politik, zwi-schen Akteuren, Politikfeldern und Phasen des Politik-Zyklus gibt sowie (2) erheblichesituationale Differenzen bestehen, etwa in Abhängigkeit davon, ob man sich in Wahl-kämpfen befindet oder nicht oder wie sich die Bevölkerungsmeinung zu einem Themaoder Akteur darstellt. Der Grad der Medialisierung des Handelns politischer Akteureschwankt dabei offenbar von immens bis kaum vorhanden. Diese Dynamiken und Rand-bedingungen medialer Einflüsse auf die Politik müssen künftig sehr viel stärker beachtetwerden. Sie müssen beschrieben und erklärt werden. Nur so kann auch ihr langfristigerWandel befriedigend erklärt werden.
Aus empirischer Sicht verlangt ein dynamisches Verständnis von Medialisierung na-türlich vor allem Längsschnittstudien. Sie liegen bislang nur sehr vereinzelt vor, was auchdaran liegt, dass die methodischen Möglichkeiten retrospektiver Untersuchungen na-turgemäß beschränkt sind. Die vorliegenden Längsschnittstudien konzentrieren sichdeshalb in erstere Linie auf Medieninhalte oder schriftliche Quellen, die z. B. Aussagenüber organisatorische Veränderungen von Parteien oder die Entwicklung parlamentari-
44 Z.B Schrott, Dimensions: Catch-All Label OR Technical Term, aaO. (FN 21), S. 41-61.45 Z.B. Donges, Medialisierung politischer Organisationen. Parteien in der Mediengesellschaft,
aaO. (FN 32).46 Z.B Frank Marcinkowski, / Adrian Steiner, »Was heißt ›Medialisierung‹? Autonomiebeschrän-
kung oder Ermöglichung von Politik durch Massenmedien?« in: Klaus Arnold, / ChristophClassen, / Egard Lersch, / Susanne Kinnebrock, / Hans-Ulrich Wagner, (Hg.), Von der Poli-tisierung der Medien zur Medialisierung des Politischen? Zum Verhältnis von Medien und Po-litik im 20. Jahrhundert, Leipzig 2010.
47 Z.B. Hartmut Esser, Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 1: Situationslogik und Handeln,Frankfurt/New York 1999.
291 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 291
ZfP 57. Jg. 3/2010

scher Aktivitäten erlauben.48 In einigen Untersuchungen werden politische Akteure auchum retrospektive Einschätzungen von Veränderungen und Urteilen über die Ursachender Medialisierung gebeten.49 Das bedeutet aber nicht, dass Querschnittsstudien, die denStatus quo von Medieneinflüssen auf die Politik untersuchen, für die Medialisierungs-forschung unnütz seien. Denn auch eine Zusammenschau entsprechender Befunde ausverschiedenen Zeiten kann über den Stand und die Entwicklung der MedialisierungAuskunft geben. Für die künftige Forschung bedeutet dies nicht nur, dass bisherige Stu-dien zu Medieneinflüssen auf die Politik systematisch aufgearbeitet werden und neueQuellen und Indikatoren erschlossen werden müssen. Es bedeutet vor allem, dass eineMedialisierungsforschung, die sozialen Wandel in den Interaktionen von Medien undPolitik über längere Zeit nachzeichnen will, heute beginnen und über einen längerenZeitraum fortgeführt werden muss.
Zusammenfassung
Über eine mögliche Medialisierung der Politik wird schon geraume Zeit diskutiert. Den-noch werden immer wieder erhebliche theoretische und empirische Defizite der For-schung bemängelt. Wesentliche Ursachen dafür sind begriffliche Unschärfen und kon-zeptuelle Mängel. Diese abzubauen, das Konzept der Medialisierung schärfer zu kontu-rieren und für die künftige Forschung besser greifbar zu machen, ist das Ziel des vorlie-genden Beitrags. Ausgangspunkt ist ein Verständnis von Medialisierung als dynamischerProzess sozialen Wandels auf Seiten von politischen Akteuren, Bürgern und/oder Me-dien. Im Anschluss daran werden die möglichen Ursachen, Indikatoren und Folgen derMedialisierung des Handelns politischer Akteure in den Blick genommen und diskutiert.Dabei wird u.a. dafür plädiert, in stärkerem Maße außerhalb der Medien verortete Ur-sachen der Medialisierung zu berücksichtigen, die Wahrnehmungen der Akteure in denBlick zu nehmen, sich stärker mit Medieneinflüssen auf die Substanz politischer Ent-scheidungen zu beschäftigen und die Frage der Medialisierung im Rahmen akteursori-entierter, struktur-individualistischer Theorien zu bearbeiten.
Summary
The mediatisation of politics has been discussed for a fairly long time. However, therestill is a lot of criticism pointing to both theoretical and empirical deficits of research.
48 Z.B. Hans Mathias Kepplinger, »Kleine Anfragen. Funktionale Analyse einer parlamentari-schen Praxis« in: Werner J. Patzelt, / Uwe Kranenpohl, / Martin Sebaldt, / Heinrich Oberreuter,(Hg.), Res publica semper reformanda. Wissenschaft und politische Bildung im Dienste des Ge-meinwohls; Festschrift für Heinrich Oberreuter zum 65. Geburtstag, Wiesbaden 2007,S. 304-319; und Vowe, Mediatisierung der Politik? Ein theoretischer Ansatz auf dem Prüfstand,aaO. (FN 13), S. 433-436.
49 Z.B. vgl. Pontzen, Nur Bild, BamS und Glotze? Medialisierung der Politik aus Sicht der Ak-teure, aaO. (FN 5); Donges, Medialisierung politischer Organisationen. Parteien in der Medi-engesellschaft, aaO. (FN 32).
292 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 292

Those deficits can at least partly be explained by the terminological fuzziness and con-ceptual problems related to the mediatisation thesis. The purpose of this paper is to ad-dress those shortcomings. It tries to make the concept of mediatisation more concreteand easier to handle in future research. The starting point of the article, then, is a definitionof mediatisation as a dynamic process of social change among political actors, citizensand/or the media. In the following, possible causes, indicators and effects of the medi-atisation of political actors’ actions are focussed and discussed. Among other things theauthors argue that research should look more into possible causes of mediatisation out-side the media, to take the role of individual perceptions more seriously, to focus moreon media effects on the substance of political decisions and to discuss the mediatisationof political actors in the context of actor-centered, structural-individualistic approaches.
Carsten Reinemann, Mediatisation without end? Reflecting the debate about media in-fluences on politics
293 Carsten Reinemann · Medialisierung ohne Ende? 293
ZfP 57. Jg. 3/2010
Bitte bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei unter www.nomos-shop.de
Politik und ReligionReligion als politischer Faktor?Eine Untersuchung am Beispiel der Frage des politischen Konfessionalismus in LibanonVon Mayssoun Zein Al Din2010, 290 S., brosch., 44,– €, ISBN 978-3-8329-5360-7(Religion – Konflikt – Frieden, Bd. 2)
Im Zentrum der Studie steht die umstrittene Machtverteilungsproblematik des politischen Sys-tems Libanons mit der Erfahrung von Krieg und permanenter Instabilität. Die Autorin schlägt einen ganzheitlichen Erklärungsansatz des libane-sischen Konfessionalismus vor und leistet einen Beitrag zur Erforschung der Funktion von Religion in multikonfessionellen Gesellschaften.
Nomos
Religion als politischer Faktor?Eine Untersuchung am Beispiel der Frage des politischen Konfessionalismus in Libanon
Mayssoun Zein Al Din
Religion – Konflikt – Frieden | 2

Heinrich Pehle / Roland Sturm
Die europäische Integration – ein relevanter Bezugsrahmen desnationalen Parteienwettbewerbs?
1. Einleitung
Der fortlaufende Prozess der europäischen Integration relativiert zunehmend den Aus-schließlichkeitsanspruch des Nationalstaats als Bezugsrahmen politischen Handelns.Dies geschieht vor allem durch die Ausweitung des Geltungsbereichs der Gemeinschafts-beziehungsweise Unionspolitiken, aber auch durch die schrittweise Umgestaltung desinstitutionellen Gefüges auf europäischer Ebene. Nationale politische Strukturen werdensowohl durch ihre Ausrichtung auf die europäische Ebene als auch im Hinblick auf diedurch die EU beeinflussten Voraussetzungen politischen Entscheidens substantiell ver-ändert. Es liegt die Vermutung nahe, dass dies auch und gerade für die politischen Parteienals den »dominierenden Trägern der politischen Willensbildung«1 gelten müsste. Die seiteinigen Jahren für viele beinahe schon zur Selbstverständlichkeit gewordene Rede voneiner »Europäisierung der Parteienlandschaft«2 scheint diese Vermutung zum Ausdruckbringen zu wollen.
Die empirische Forschung zum Themenbereich »Europäisierung nationaler Parteien«hat sich zum einen darauf konzentriert zu fragen, ob die interne Organisation der na-tionalen Parteien in Europa sich als Folge ihrer »Europäisierung« verändert habe.3 Dieermittelte Distanz der Parteiführung zur Basis in europäischen Angelegenheiten, insbe-sondere wenn die Führung Regierungsfunktionen wahrnimmt, ist allerdings kein Son-derfall, sondern ein ubiquitäres Phänomen auch in anderen Politikfeldern. Aussagekräf-tiger für die parteipolitische Nebenrolle Europas in den nationalen Parteiensystemen derEU-Mitgliedstaaten ist die geringe Zahl von EU-Spezialisten in den Parteiorganisationen
1 Richard Stöss, »Parteienstaat oder Parteiendemokratie?« in: Oscar W. Gabriel/ Oskar Nieder-mayer/ Richard Stöss (Hg.), Parteiendemokratie in Deutschland, Wiesbaden2, S. 13-36, hierS. 32.
2 Oskar Niedermayer, »Europäische Parteienzusammenschlüsse«, in: Lexikon der Politik Band5. Die Europäische Union, München 1996, S. 84-90, hier S. 84.
3 Insbesondere das Projekt «Europeanisation of National Political Parties« an der UniversitätKeele (UK) (2003-2006). Vgl. u.a. Thomas Poguntke u.a. (Hg.), The Europeanization of NationalPolitical Parties, London 2007. Tomas Poguntke u.a., «The Europeanisation of National PartyOrganisations: A Conceptual Analysis« in: European Journal of Political Research 46 (2007),S. 747-771. Robert Ladrech, «National Political Parties and European Governance: The Con-sequences of ›Missing in Action‹«, in: West European Politics 30 (2007), S. 945-960. ElisabethCarter/ Thomas Poguntke, »How European Integration Changes National Parties: Evidencefrom a 15-Country Study« in: West European Politics 33(2010), S. 297-324.

und deren Fehlen in wichtigen Parteiämtern. Eine weitere Forschungsfrage richtete sichan die europapolitischen Präferenzen der Parteien.4 Der Befund (für die Jahre 1984bis 1996), dass die weltanschauliche Verortung von Parteien für europapolitische Wei-chenstellungen ausschlaggebender zu sein scheint als die Strategien des Parteienwettbe-werbs, Nationalität, Regierungsbeteiligung oder die Präferenzen der Parteimitgliedermag überraschend klingen. Er könnte aber wiederum mit der Nebenrolle von EU-Fragenin der nationalen Parteipolitik bzw. dem Mangel an innerparteilicher Auseinander-setzung mit dem Thema »europäische Integration« zu tun haben.
Es bleibt ohne weitere Erläuterung unklar, was unter einer »europäisierten Parteien-landschaft« konkret gemeint sein könnte. Wenn damit eine durch den europäischen In-tegrationsprozess induzierte Veränderung des nationalen Parteiensystems angesprochenwerden soll, handelt es sich jedenfalls um ein Missverständnis. In den Mitgliedstaaten derEuropäischen Union zeigt sich nämlich ein weitgehend identisches Muster, das auf einefortdauernde Resistenz des Formats der nationalen Parteiensysteme gegenüber der Ent-wicklung der Europäischen Union verweist. Zwar haben sich in den 1980er und 1990erJahren in fast allen mitgliedstaatlichen Parteiensystemen bedeutende Veränderungen er-geben, aber es ist nicht das »issue Europa«, welches dieselben verursacht hat. Peter Mairidentifizierte EU-weit insgesamt nur drei im Zeitraum von 1979 bis 1999 neu gegründeteParteien, deren Formierung unmittelbar auf den europäischen Integrationsprozess zu-rückzuführen war.5 Es handelte sich dabei durchgängig um Parteien, die bestrebt warenbzw. sind, die EU-Gegner in den jeweiligen Mitgliedstaaten zu organisieren, ein Versuch,der bislang nirgends von Erfolg gekrönt war. Weder bei nationalen Parlamentswahlennoch bei den Europawahlen kamen diese Parteien über einen Stimmanteil von maximal1,5 Prozent hinaus.6
Eine dieser drei Parteien wurde im Januar 1994 in Deutschland von einem ehemaligenKabinettschef bei der EG-Kommission, Manfred Brunner, gegründet. Der Bund FreierBürger (BFB), dessen Programmatik sich weitgehend in einer Kritik des Vertrages vonMaastricht und der Einführung der gemeinsamen europäischen Währung erschöpfte, er-reichte bei der Europawahl im Jahr 1994 1,1 Prozent der Stimmen. Bei der Bundestags-wahl von 1998 betrug sein Anteil an den Zweitstimmen nur noch 0,2 Prozent. Nach demParteiaustritt Brunners 1999 glitt der BfB völlig ins rechtsextreme Sektierertum ab undlöste sich im Jahre 2000 auf.7 Nachdem weitere Neugründungen politischer Parteien miteinem programmatischen Fokus auf die Europäische Union unterblieben, gilt der Be-fund, dass »Europa« das deutsche Parteiensystem als Ganzes bislang weitgehend unbe-
4 Gary Marks/ Carole J. Wilson/ Leonard Ray, »National Political Parties and European Inte-gration« in: American Journal of Political Science 46 (2002), S. 585-594.
5 Vgl. Peter Mair, »The Limited Impact of Europe on National Party Systems«, in: West EuropeanPolitics 23 (2000), S. 27-51, hier S. 30 f.
6 Inzwischen muss dieser Befund etwas relativiert werden. So erreichte beispielsweise die britischeUKIP bei den Europawahlen 2004 15,6 % und bei der britischen Parlamentswahl 2005 3,2 %.
7 Vgl. Florian Hartleb, »Bund Freier Bürger – Offensive für Deutschland« in: Frank Decker/ ViolaNeu (Hg.), Handbuch der deutschen Parteien, Wiesbaden 2007, S. 197-200.
295 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 295
ZfP 57. Jg. 3/2010

rührt gelassen hat,8 also nach wie vor. Die in der Literatur9 zu findende Einordnung derCSU als »soft Euro-critic« hat eher mit kurzfristigen Themenkonjunkturen als mit einergrundsätzlichen Positionierung der Partei zu tun.
2. Europäische politische Parteien
Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich die einzelnen politischen Parteien dem Prozessder europäischen Integration entziehen bzw. ihn ignorieren könnten oder würden. Deut-lich wird dies schon rein äußerlich durch die Mitgliedschaft aller im Bundestag vertre-tenen Parteien in den »Europäischen Politischen Parteien«. Ihre Ursprünge haben letz-tere in den im Vorfeld der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments von 1979gegründeten Parteibünden der Sozialdemokraten, Konservativen und Liberalen. Siewurden organisatorisch zu festeren Gebilden – eben europäischen Parteien – weiterent-wickelt und fanden Nachahmer im grünen und linken Parteienspektrum. Heute sind diebeiden Unionsparteien Mitglied in der Europäischen Volkspartei – Christliche Demo-kraten (EVP-CD), die SPD gehört der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) anund die FDP der Europäischen Liberalen und Demokratischen Reformpartei (ELDR).Die Europäische Grüne Partei (EGP) zählt Bündnis 90/Die Grünen zu ihren Mitgliedernund die Europäische Linkspartei Die Linke aus Deutschland.
Die europäischen politischen Parteien fanden im Vertrag von Maastricht, der am1. November 1993 in Kraft trat, erstmalig Erwähnung im Primärrecht der EuropäischenUnion. Seitdem der Vertrag von Lissabon in Kraft ist, lautet die entsprechende Bestim-mung: »Politische Parteien auf europäischer Ebene tragen zur Herausbildung eineseuropäischen politischen Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens der Bürgerinnenund Bürger der Union bei« (Artikel 10 EUV). Allerdings können sie diese Funktionallenfalls vermittelt erfüllen, denn ihr gemeinsames und zentrales Merkmal ist nach wievor, dass sie nicht als Personalkörperschaften konzipiert wurden. Weil ihre Mitgliederselbst Parteien sind, ist grundsätzlich eine Mitgliedschaft natürlicher Personen ausge-schlossen.10
Sven Mirko Damm führt die Besonderheiten in der Mitgliedsstruktur der europäischenParteien auf den eigentlichen Zweck ihrer Gründung zurück: Sie seien konzipiert wor-den, um eine »programmatische Bündelung« ihrer Mitgliedsparteien zu ermöglichen und
8 Vgl. Oskar Niedermayer, »The Party System: Structure, Policy, and Europeanization« in:Kenneth Dyson/ Klaus H. Goetz, (Hg.), Germany, Europe and the Politics of Constraint,Oxford 2003, S. 129-146, hier S. 137.
9 Vgl. Paul Statham/ Ruud Koopmans, »Political Party Contestation over Europe in the MassMedia: Who Criticizes Europe, How and Why?« in: European Political Science Review1(2009), S. 435-463, hier S. 453.
10 Formal gesehen macht hier zwar die EVP eine Ausnahme, da ihre Statuten auch die Möglichkeiteiner individuellen Mitgliedschaft vorsehen. Doch wird diese Bestimmung durch die Ge-schäftsordnung der Partei konterkariert, der zufolge Einzelmitgliedern bei den Parteikongres-sen weder Rede- noch Stimmrecht zukommt.
296 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 296

nicht, um auf nationaler Ebene in Konkurrenz zu einzelnen Parteien zu treten.11 IhreFunktion könne also gerade nicht darin bestehen, wie die nationalen Parteien direkt zurWillensbildung der Bevölkerung beizutragen. Dies bedeutet nichts anderes, als dass diefür politische Parteien zentrale Funktion der Kommunikation mit den Bürgern durchdie europäischen Parteien offenbar weder geleistet werden soll noch kann.
Stimmt man dieser Interpretation zu, wird man nicht umhin können, den Artikel 10EU-Vertrag wie schon seine Vorläufer lediglich als Programmsatz zu qualifizieren, alseine Aussage also, die »lediglich eine Zielvorstellung, den Soll-Zustand der EuropäischenGemeinschaft«12 beschreibt. Sie hat im Wesentlichen legitimatorische Funktion, dennder wohl wichtigste Beweggrund für die vertragsrechtliche Anerkennung der europä-ischen Parteien bestand darin, auf ihrer Basis zu einer Finanzierung derselben aus Mittelndes EG-Haushalts zu gelangen.13 Hier diente der deutsche Parteienartikel und die deut-sche Begründung der Parteienfinanzierung als Vorbild. Die Praxis der »versteckten« Fi-nanzierung der europäischen Parteien aus Haushaltsmitteln des Europäischen Parla-ments, die eigentlich den Fraktionen vorbehalten waren, blieb davon allerdings zunächstunberührt. Überwunden werden konnte sie erst durch die Verabschiedung des »Partei-enstatuts« der Europäischen Union (ABL.EU L 297/1) das seit den Europawahlen desJahres 2004 die Finanzierung der europäischen Parteien regelt.14
Zur Rechtfertigung staatlicher bzw. öffentlicher Parteienfinanzierung werden im We-sentlichen zwei miteinander verbundene Argumente herangezogen. Sie basieren auf dervom Nationalstaat auf die Europäische Union übertragenen Prämisse, dass das Volk je-derzeit, also auch in der Zeit zwischen den Wahlen, Einfluss auf die politischen Ent-scheidungen nehmen können muss.15 Politische Parteien, die Anspruch auf eine (Teil-)Finanzierung aus öffentlichen Mitteln erheben, müssen daher der Rechtsprechung durchdas Bundesverfassungsgericht zu Folge nicht nur als Wettbewerber bei den Wahlen auf-treten, sondern auch im permanenten Wettstreit »die Bürger von der Richtigkeit ihrerPolitik zu überzeugen« versuchen.16 Weder das eine noch das andere kann von deneuropäischen Parteien in ihrer derzeitigen Gestalt geleistet werden. Für diesen Befundsprechen nicht nur die bereits dargestellte Mitgliedsstruktur und die natürliche Distanzder europäischen Parteien von der Wahlbevölkerung in den einzelnen Mitgliedstaaten,sondern auch die programmatische Heterogenität ihrer nationalen Mitgliedsparteien.
11 Vgl. Sven Mirko Damm, »Die europäischen politischen Parteien: Hoffnungsträger europäi-scher Öffentlichkeit zwischen nationalen Parteien und europäischen Fraktionsfamilien« in:Zeitschrift für Parlamentsfragen 30 (1999), S. 395-423, hier S. 410.
12 Vgl. Volker Neßler, »Deutsche und europäische Parteien. Beziehungen und Wechselwirkun-gen im Prozeß der Demokratisierung der Europäischen Union« in: Europäische Grundrech-tezeitschrift 1998, S. 191-196, hier S. 193.
13 Vgl. Dimitris Tsatsos/ Gerold Deinzer, Europäische politische Parteien. Dokumentation einerHoffnung, Baden-Baden 1998, S.19.
14 Vgl. auch Gerrit Manssen, Die Finanzierung von politischen Parteien in Europa: Bestandsauf-nahme und europäische Perspektive, Frankfurt a.M. etc. 2008.
15 Vgl. Dieter Grimm, »Politische Parteien« in: Ernst Benda/ Werner Maihofer/ Hans-JochenVogel (Hg.), Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Berlin/ NewYork 19942, S. 599-656, hier S. 608.
16 BVerfGE 85: 264 (285.).
297 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 297
ZfP 57. Jg. 3/2010

Die mittlerweile beschlossene Finanzierung der europäischen Parteien aus Mitteln desEU-Haushalts sieht sich also mit dem Dilemma konfrontiert, dass diese die Funktionen,die ihre öffentliche Finanzierung allein rechtfertigen könnten, nicht zu erfüllen vermö-gen. Noch immer gilt: »Europäische Politische Parteien existieren zwar, sie entfalten aberbisher keine nennenswerte Wirkung«,17 denn »einen sichtbaren Beitrag zur Vermittlungeuropäischer Politik an die Bürger« leisten sie kaum.18 Europäische Parteipolitik findetdeshalb noch immer vorwiegend in den jeweiligen nationalen Parteiorganisationen statt,denen damit nicht nur die Aufgabe zukommt, direkt zur europabezogenen politischenWillensbildung der Bürger beizutragen, sondern die auch das Abstimmungsverhalten»ihrer« Europaabgeordneten entscheidend beeinflussen.19 Mit anderen Worten: Die Fra-ge, inwieweit sich die deutschen politischen Parteien »europäisiert« haben, ist mit demHinweis auf ihre Mitgliedschaft in europäischen Parteien so lange nicht zu beantworten,wie letztere beim Bürger so gut wie nicht sichtbar sind. Zu prüfen bleibt damit, welcheBedeutung dem Thema »Europa« bei der Tätigkeit der politischen Parteien in der Bun-desrepublik zukommt. Der Maßstab für diese Prüfung kann aus Ermangelung eineseuropäischen Raumes der politischen Willensbildung nicht mehr im europäischen Ver-tragswerk, sondern nur im nationalen Verfassungskontext gefunden werden.
3. Politische Willensbildung, innerparteiliche Demokratie und Europawahlen
Das Grundgesetz schreibt den Parteien in Artikel 21 Absatz 1 die Aufgabe zu, an derpolitischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Diese Formulierung ist insofernirreführend, als sie suggeriert, die Tätigkeit der Parteien sei auf die Sphäre der Volkswil-lensbildung begrenzt. Demokratische Ordnungen zeichnen sich jedoch gerade dadurchaus, dass sie keine vom Volkswillen geschiedene »Staatswillensbildung« kennen. Artikel20 Absatz 2 führt alle Staatsgewalt auf das Volk zurück, lässt sie von diesem allerdingsnur in Form von »Wahlen und Abstimmungen« ausüben und delegiert sie ansonsten an»besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtspre-chung«. Angesichts dessen besteht die zentrale und unersetzliche Funktion der politi-schen Parteien darin, zwischen Volk und Staatsorganen zu vermitteln.20
Das wichtigste Element in diesem Vermittlungsprozess ist die Wahl, und die Aufgabeder Parteien besteht darin, das Volk zur Wahl erst fähig zu machen, indem sie die ge-sellschaftliche Vielfalt in einem Prozess fortschreitender Selektion auf wenige entschei-
17 Vgl. Volker Nessler, a.a.O (FN 12), S. 191.18 Oskar Niedermayer, »Die europäischen Parteienbünde« in: Oscar W. Gabriel/ Oskar Nie-
dermayer/ Richard Stöss (Hg.), Parteiendemokratie in Deutschland, Wiesbaden 2002,S. 428-446, hier S. 446.
19 Vgl. Simon Hix, »Parliamentary Behaviour with Two Principals: ›Preferences, Parties andVoting in the European Parliament‹« in: American Journal of Political Science 46 (2002),S. 688-698, hier S. 696.
20 Heinrich Oberreuter, »Politische Parteien: Stellung und Funktion im Verfassungssystem derBundesrepublik«, in: Alf Mintzel/ Heinrich Oberreuter (Hrsg.): Parteien in der Bundesrepu-blik Deutschland, Bonn 1992: S. 28.
298 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 298

dungsfähige Alternativen reduzieren.21 Die Beteiligung an den Wahlen zu den staatlichenParlamenten in Bund und Ländern ist demnach die zentrale Funktion der politischenParteien. Paragraph 2 Absatz 2 des Parteiengesetzes bringt dies dadurch zum Ausdruck,dass er eine mehr als sechsjährige Abstinenz von Bundes- bzw. Landtagswahlen (nichtaber von den Europawahlen!) mit einem Verlust der Rechtsstellung als Partei für diejeweilige Organisation sanktioniert. Hinsichtlich des auf die Wahlkampfkostenerstat-tung bezogenen Teils der staatlichen Parteienfinanzierung allerdings werden die Stim-men, welche die Parteien bei Europawahlen erzielen, genauso hoch prämiert wie dieje-nigen, die sie bei den Wahlen zu den staatlichen Parlamenten auf nationaler Ebene er-reichen (Paragraph 18 Absatz 3 Parteiengesetz). Der deutsche Gesetzgeber erkennt damitimplizit an, dass die Beteiligung an den Europawahlen zu den Aufgaben der nationalenParteien gehört.22 Dies rechtfertigt es, die Erfüllung der aus ihrer Beteiligung an denWahlen resultierenden, weiteren Funktionen der politischen Parteien hinsichtlich desThemas »Europäische Integration« am selben Maßstab zu messen wie ihre auf den na-tionalen Rahmen bezogene Aufgabenwahrnehmung.
Die im Wahlakt zum Ausdruck kommende Rückkopplung zwischen Staatsorganenund Volk erschöpft sich nicht in den periodisch wiederkehrenden Parlamentswahlen.Legitimitätsschaffend wirken kann diese Rückkopplung nur als permanenter, wechsel-wirksamer Prozess.23 Auch wenn die auf eine dauerhafte Mitwirkung der Parteien an derWillensbildung des Volkes ausgelegten Funktionen in der Teilnahme derselben an denParlamentswahlen also gleichsam »aufgehen«, bleibt ihre Erfüllung für den demokrati-schen Prozess doch unverzichtbar. In dieser Perspektive kommt nicht nur der Einschal-tung der jeweiligen Mitgliedschaft in die innerparteiliche Willensbildung herausragendeBedeutung zu, sondern auch der nach außen gerichteten Tätigkeit der Parteien, die so-wohl darauf abzielt, die in der Bevölkerung vorfindlichen Meinungsbilder zu erkunden,als auch letztere durch die Präsentation entscheidungsfähiger Alternativen zu struktu-rieren.
Die EU ist als politischer Raum unterentwickelt. Empirische Untersuchungen habengezeigt, dass für die Zeit von 1976 bis 2004 nationales Wahlverhalten sich nicht drama-tisch von europäischem Wahlverhalten unterscheidet. Die EU wurde von der Wähler-schaft nicht als eigenständiger Bezugsraum der Politik wahrgenommen. Dies gilt in be-sonderer Weise für Österreich und Deutschland.24 Es fehlt der Europapolitik zudemweitgehend an parteipolitisch zuordnungsfähigen, inhaltlich unterscheidbaren Konzep-ten. In zentralen Fragen der Europapolitik gibt es in Deutschland unter den im Bundestagvertreten Parteien einen breiten Konsens. Er schließt grundsätzlich auch Die Linke ein,wenngleich mit erheblichen Abstrichen, wie daran deutlich wird, dass ihre Fraktion imBundestag das Ratifizierungsgesetz zum Vertrag von Lissabon einhellig ablehnte. Dieses
21 Vgl. Dieter Grimm a.a.O. (FN 15), S. 605.22 Vgl. Gregor Stricker, Der Parteienfinanzierungsstaat, Baden-Baden 1998, S. 26.23 Vgl. Richard Stöss, a.a.O. (FN 1), S. 30 f.24 Vgl. Daniele Caramani, »Is There a European Electorate and What Does It Look Like? Evi-
dence from Electoral Volatility Measures, 1976-2004« in: West European Politics 29 (2006),S. 1-27, hier S. 6 und S. 10.
299 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 299
ZfP 57. Jg. 3/2010

Beispiel weist schon darauf hin, dass der Schluss von dem zweifellos mangelhaften eu-ropapolitischen Differenzierungspotenzial des deutschen Parteiensystems25 auf das Feh-len jedweder programmatischer Differenzen zwischen den im Deutschen Bundestagvertretenen Parteien voreilig wäre.26
Das Problem besteht nicht darin, dass die politischen Parteien keine spezifischen Vor-stellungen über die Gestalt der Europäischen Union und den Inhalt der von ihr betrie-benen Politiken entwickelt hätten, sondern dass sie es unterlassen, der Wählerschaft dieRelevanz des Themas Europa in der gebührenden Intensität zu vermitteln. WelcheGründe hat dieses Versäumnis?
Analysen der Europawahlen der Jahre 1999, 2004 und 2009, die von der Forschungs-gruppe Wahlen erstellt wurden, ist unter anderem zu entnehmen, dass etwa drei Viertelaller Wahlberechtigten in Deutschland sich nicht für europapolitische Fragen interes-sierten. Die Wahlbeteiligung sank 1999 im Vergleich zu den Europawahlen von 1994 um14,8 Prozent auf 45,2 Prozent. 2004 erreichte sie das historische Tief von 43,0 Prozent,das 2009 mit 43,3 Prozent bestätigt wurde. Über das vergangene Jahrzehnt hinweg hatsich nichts daran geändert, dass europäische Fragen für die Entscheidung der meistenWähler nur eine deutlich nachgeordnete Bedeutung haben. Nur etwa jeder Dritte, dersich an der Wahl beteiligte, gab an, dass er sich bei seiner Entscheidung an europapoli-tischen Kriterien orientiert hätte, wohingegen über die Hälfte die Bundespolitik als denfür ihre Entscheidung maßgeblichen Faktor benannte.27 Mindestens genauso bemer-kenswert ist die Tatsache, dass die Europawahlen »aufgrund ihrer gering eingeschätztenBedeutung noch stärker zur Sanktionswahl einladen als die Landtagswahlen«.28 Messenlässt sich die Tendenz, den etablierten Parteien durch die Wahl einer Kleinpartei, die manbei »Hauptwahlen« nicht unterstützen würde, einen »Denkzettel auszustellen, an demAnteil der gültigen Stimmen für die »sonstigen«, nicht im Deutschen Bundestag vertretenParteien. Bei der Europawahl des Jahres 2004 vereinten sie 9,8 Prozent der Stimmen aufsich, fünf Jahre darauf wuchs ihr Anteil gar auf 10,8 Prozent.29 Zum Vergleich: bei derBundestagswahl 2009 kamen die sonstigen Parteien insgesamt auf einen Anteil von nur2,8 Prozent der gültigen Zweitstimmen.30
25 Vgl. Jürgen Mittag/ Claudia Hülsken, »Von Sekundärwahlen zu europäisierten Wahlen? 30Jahre Direktwahlen zum Europäischen Parlament« in: Integration 32 (2009), S. 105-122, hierS. 109.
26 Ein genauerer Blick auf die Programme, die die Parteien anlässlich der Europawahl von 2009präsentierten, der diesen Befund bestätigen würde, kann hier aus Platzgründen nicht geleistetwerden.
27 Vgl. Süddeutsche Zeitung, 15.6.1999, S. 5, 15.6.2004, S. 10, 9.6.2009, S. 5.28 Frank Decker, »Parteiendemokratie im Wandel« in: ders./ Viola Neu (Hg.), Handbuch der
deutschen Parteien, Wiesbaden 2007, S. 19-61, hier S. 31. Für die Europawahl 2009 vgl. OskarNiedermayer, »Die Wahl zum Europäischen Parlament vom 7. Juni 2009 in Deutschland: SPD-Debakel im Vorfeld der Bundestagswahl« in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 40 (2009),S. 711-731.
29 Angaben nach http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_Bund_09/ergebnisse/bundesergebnisse/index.html (Stand 16.2.2010).
30 http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/bun-desergebnisse/index.html (Stand 4.3.2010).
300 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 300

Die Ergebnisse der Europawahlen von 1994, 1999, 2004 und 2009 (in %)
1994 1999 2004 2009
SPD 32,2 30,7 21,5 20,8
CDU 32,0 39,3 36,5 30,7
CSU 6,8 9,4 8,0 7,2
Bündnis 90/DieGrünen 10,1 6,4 11,9 12,1
Die Linke(bis 2004 PDS) 4,7 5,8 6,1 7,5
FDP 4,1 3,0 6,1 11,0
Wahlbeteiligung 60,0 45,2 43,0 43,3
Diese Zahlen machen deutlich, dass man mit dem Thema Europa bislang keine Wahlen– nota bene auch keine Europawahlen – gewinnen kann. Die für die Ausgestaltung derEuropawahlkämpfe in den politischen Parteien Verantwortlichen reagieren auf das skiz-zierte Meinungsbild nicht etwa mit einer Intensivierung ihrer auf die Europäische Unionbezogenen Programmarbeit, sondern im Gegenteil seit jeher in der Form, dass auch sieEuropa nur als »Randthema« behandeln.31 Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern inallen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, gab und gibt es eine ausgeprägte Tendenzzur »Instrumentalisierung der Europawahlen zu innenpolitischen Zwecken«.32 Die Eu-ropawahlen werden als nationale »Nebenwahlen« (second order elections) wahrgenom-men, bei denen es um »weniger« als bei nationalen Parlamentswahlen geht.33 Dies fördertdie Tendenz zur Zweckentfremdung des in fünfjährigem Rhythmus stattfindenden Ur-nengangs. In Deutschland stellte sich dies zum Beispiel bei der Wahl von 1999 als letztlicherfolgreiche »Abrechnung« der Oppositionsparteien mit der Arbeit der acht Monatezuvor ins Amt gelangten »rot-grünen« Bundesregierung dar. Auch im Jahr 2004 wurdeder Europawahlkampf primär mit innenpolitischen Themen geführt,34 was sich jedochnicht für das gesamte Regierungslager negativ auswirkte, denn massiven Verlusten derSPD standen deutliche Gewinne von Bündnis 90/Die Grünen gegenüber. Auch der Eu-ropawahlkampf des Jahres 2009 war alles andere als supranational orientiert, denn erstand deutlich unter den Vorzeichen der im September desselben Jahres anstehendenBundestagswahl. Die Unionsparteien und die FDP werteten sie als »Generalprobe« für
31 Oskar Niedermayer, »Die Europawahl in der Bundesrepublik im Kontext des Superwahljahres1994« in: Integration 18 (1995), S. 22-30, hier S. 22.
32 Oskar Niedermayer, a.a.O. (FN 2), S. 89.33 Vgl. Andreas M. Wüst/ Markus Tausendpfund, »30 Jahre Europawahlen«, in: Aus Politik und
Zeitgeschichte, B 23-24/ 2009, S., 3-9, hier S. 5.34 Vgl. Roland Sturm, »Verlierer Europa – Die verpasste Chance der Europawahlen«, in: Gesell-
schaft – Wirtschaft – Politik 53 (2004), S. 287-289.
301 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 301
ZfP 57. Jg. 3/2010

die nationale Parlamentswahl, die den Beleg dafür erbringen sollte, dass die »bürgerlicheMehrheit« im Bundestag erreichbar sei, während die SPD, Grüne und Linke bestrebtwaren, den Gegenbeweis anzutreten.35
Dass die Tradition des »Missbrauchs« der Europawahlen durch die Parteien zu na-tionalen Zwecken36 weiter gepflegt wird, zeigt sich auch daran, dass deren Schatzmeisterauf »Zurückhaltung« im Europawahlkampf hinwirken, um durch den geringeren Mit-teleinsatz ein finanzielles Plus für die Parteikasse in Folge nicht verbrauchter Zuschüsseaus der Wahlkampfkostenerstattung zu erwirtschaften. So wurde etwa in Bezug auf denWahlkampf der SPD von 1999 von einem »zweistelligen Millionengewinn« gespro-chen.37 Für den Europawahlkampf 2004 wurde ermittelt, dass die Budgets der Parteienweniger als die Hälfte der Beträge enthielten, die für den Bundestagswahlkampf von 2002verausgabt worden waren.38 Für das Wahljahr 2009 gilt Erhebungen der »Wirtschafts-woche« zufolge Ähnliches.39
4. Der defizitäre Parteienwettbewerb im Europäischen Parlament
Die Tatsache, dass die Europawahlen im Vergleich zu nationalen Parlamentswahlen vonWählern und Parteien gleichermaßen deutlich geringer gewichtet werden, mag angesichtsder in den Verträgen von Maastricht, Amsterdam und nunmehr auch Lissabon vorge-nommenen Aufwertung des Europäischen Parlaments verwundern, hat sich dieses dochdurch die Einführung des Mitentscheidungsverfahrens in vielen Bereichen zum gleich-berechtigten Mitspieler des Rates in den europäischen Entscheidungsprozessen ent-wickelt. Doch in dieser Hinsicht ist die »Zurückhaltung« der Parteien rationaler als esauf den ersten Blick erscheinen mag, denn dass sich das Europäische Parlament als Ganzesgegenüber dem Rat mittlerweile so beachtlich emanzipieren konnte, bedeutet nichtgleichzeitig, dass auch die Gestaltungschancen der in seinen Fraktionen vertretenen Par-teien im gleichen Maße gestiegen sind. Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe.
Erstens schränkt die politisch-ideologische Heterogenität der Fraktionen im Europä-ischen Parlament die Durchsetzung der Prioritäten nationaler Parteien entscheidend ein.Zum Zwang, sich innerhalb der einzelnen Fraktionen auf den kleinsten gemeinsamenNenner zu einigen, tritt, zweitens, der Umstand hinzu, dass das Parlament sich im Mit-entscheidungsverfahren nur dann Geltung verschaffen kann, wenn es gemäß der Be-stimmungen des früheren Artikels 251 EG-Vertrag – heute Artikel 294 AEUV – im
35 Vgl. Süddeutsche Zeitung 6./7.6.2009, S. 5 unter Berufung auf »eine Stimme aus der CDU-Führung«.
36 Frank Decker, »Demokratie und Demokratisierung jenseits des Nationalstaats« in: Zeitschriftfür Politikwissenschaft 10 (2000), S. 585-629, hier S. 605.
37 Hans Leyendecker, »Spaß am Abstrafen. Das Desaster der Sozialdemokraten ist auch hausge-macht«, in: Süddeutsche Zeitung, 15. 6.1999, S. 7.
38 Vgl. Andreas Wüst/ Markus Tausendpfund a.a.O. (FN 33), S. 5, und Jürgen Mittag/ ClaudiaHülsken, a.a.O. (FN 25), S. 110.
39 Vgl. http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/cdu-knausert-bei-der-europawahl-397843/,abgerufen am 16.2.2010.
302 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 302

Stande ist, die absolute Mehrheit seiner Mitglieder zu mobilisieren. Weil in der bisherigenGeschichte der Europäischen Union noch keine Fraktion allein über die absolute Mehr-heit verfügte, kam es in der Vergangenheit häufig zu einer »Großen Koalition« der Frak-tionen der Europäischen Volkspartei (EVP) und der Sozialdemokratischen Partei Euro-pas (SPE), die nicht selten auch von der Fraktion der Liberalen (ELDR) unterstütztwurde. In dieser Perspektive erscheint die fehlende sachpolitische Profilierung der na-tionalen Parteien im Europawahlkampf also als Reflex der parteiübergreifenden Koope-rationszwänge im Europäischen Parlament.
Stellt man einen Vergleich der Ausgangsbedingungen für die Europawahlen in deneinzelnen Mitgliedstaaten an, offenbart sich für die deutschen Parteien und ihre poten-tiellen Wähler ein weiteres, das Wahlkampfengagement beeinträchtigendes Moment: AufGrund der disproportionalen Verteilung der Mandate im Europäischen Parlament aufdie Mitgliedstaaten haben die deutschen Parteien bei einem wegen der Größe des deut-schen Elektorats vergleichsweise hohen Aufwand relativ wenig zu gewinnen. Die deut-schen Parteien konkurrieren um insgesamt 99 (bzw. nach dem Vertrag von Lissabon96)40 Sitze, die der Bundesrepublik im Europäischen Parlament zugewiesen sind; einAbgeordneter repräsentiert damit mehr als 800.000 Einwohner. Auch wenn die Bundes-republik Deutschland damit die meisten Abgeordneten in das Europäische Parlamententsenden darf, ist das Zahlenverhältnis Abgeordnete – Wähler für Deutschland immernoch deutlich schlechter als andernorts. Zum Vergleich: In Österreich beispielsweise liegtdie Repräsentationsdichte fast doppelt so hoch. Die sechs Abgeordneten aus Luxemburgrepräsentieren im Durchschnitt gar nur knapp 68.000 Einwohner.
Die politischen Prämien, die den Parteien nach erfolgreich gestalteten Europawahl-kämpfen winken, sind schon unter den bislang genannten Gesichtspunkten denkbar be-scheiden. Und sie erscheinen noch geringer, wenn die reale Gewichtsverteilung zwischenSupranationalismus und Intergouvernementalismus in der Europäischen Union mit inden Blick genommen wird. Nationale Parteien, die wirklich gestaltend auf die Politikender Europäischen Union einwirken wollen, haben noch immer andere Zielorte als dasEuropäische Parlament. Es sind dies der Europäische Rat und der Rat der EuropäischenUnion (Ministerrat). An die eigentlichen »Schaltstellen der Macht« innerhalb derEuropäischen Union gelangen die Parteien also nicht über die Europawahlen, sondernüber eine durch die Wahlen zum Deutschen Bundestag vermittelte Regierungsbeteili-gung. Nimmt man den Befund ernst, dass dem Europäischen Rat – und damit den dortvertretenen Staats- und Regierungschefs – mittlerweile eine Schlüsselfunktion für dieEntscheidungsfindung der Europäischen Union zukommt,41 dann lässt sich diese Aus-sage noch dahingehend zuspitzen, dass die Partei, die den Kanzler stellt, den höchst-möglichen Gewinn in Bezug auf die Beeinflussung der EU-Politiken verbuchen kann.
Die Klage über die Instrumentalisierung der Europawahlen zu innenpolitischen Zwe-cken erscheint zwar verständlich, ist aber gleichzeitig geeignet, über das eigentliche
40 Artikel 14 Absatz 2 EUV legt u.a. fest: » Kein Mitgliedstaat erhält mehr als 96 Sitze.«.41 Vgl. z. B. Wolfgang Wessels, Das politische System der Europäischen Union, Wiesbaden 2008,
S. 182-185.
303 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 303
ZfP 57. Jg. 3/2010

Problem hinwegzutäuschen. Die »Zweckentfremdung« der Europawahlen hat ihre Ur-sache letztlich darin, dass den nationalen Parteien bei diesen Wahlen kein realer Macht-gewinn in Aussicht steht. Was eine wirkliche Europäisierung der nationalen Parteienbislang verhindert, ist primär nicht die mangelnde Bereitschaft derselben die europä-ischen »Nebenwahlen« zu »Hauptwahlen« aufzuwerten, die es mittels finanzieller An-reize zu stimulieren gälte,42 sondern die Tatsache, dass durch das Entscheidungssystemder Europäischen Union faktisch nur diejenigen Parteien belohnt werden, die im natio-nalen Wettbewerb reüssieren.
5. Fazit
Wer der – zumindest partiell nachvollziehbaren – Rationalität der europapolitischen Zu-rückhaltung der politischen Parteien Einhalt gebieten will, wird sich nicht damit begnü-gen können, die Europawahlen mittels institutioneller Reformen wie der Schaffung eineseinheitlichen Wahlsystems in allen Mitgliedstaaten ihres nationalen Charakters zu ent-kleiden.43 Die politikwissenschaftliche Diskussion der vergangenen Jahre hat gezeigt,dass die umgekehrte Perspektive ungleich wichtiger wäre. In ihr geht es darum, das po-litische System der Europäischen Union so zu reformieren, dass die nationalen Parla-mentswahlen ihrer »versteckten«, aber für die Machtverteilung innerhalb der Unionletztlich allein ausschlaggebenden Dimensionen beraubt werden. Dies würde eine für dieWähler sicht- und erfahrbare Aufwertung der Europawahlen voraussetzen. Erreichbarwäre sie, wenn das Wahlergebnis bei Europawahlen wie auf nationaler Ebene direktenEinfluss auf die Regierungsbildung hätte. Im politischen System sui generis der EU richtetsich der Blick damit auf die Europäische Kommission. Entsprechende Reformvorschlägewurden im Zuge der europäischen »Verfassungsdiskussion« und im Vorfeld der Verab-schiedung des Vertrags von Lissabon diskutiert. Sie bezogen sich auf den Modus derBestellung des Kommissionspräsidenten. Zur Debatte stand, den Präsidenten derEuropäischen Kommission entweder aus der Mitte des Parlaments wählen,44 oder, we-sentlich weniger realistisch, ihn in einem eigenen Wahlakt unmittelbar von der Bevöl-kerung der Europäischen Union bestimmen zu lassen.45 Beide Vorschläge zielten mitdieser zusätzlichen Personalisierung auf europäischer Ebene darauf ab, die Mitgliederder europäischen Parteien zur Verständigung auf entsprechende Spitzenkandidaten zunötigen. Mit einem personellen (und programmatischen) Gesamtangebot wären dieeuropäischen Parteien bei den Europawahlen für den Wähler tatsächlich sichtbar in Er-scheinung getreten, so dass das Kunststück hätte gelingen können, »die Einmischung
42 So etwa Frank Decker (FN 36), hier S. 605 f.43 Vgl. ebd. Zur Relativierung dieses Arguments vgl. Dieter Nohlen: »Wie wählt Europa? Das
polymorphe Wahlsystem zum Europäischen Parlament« in: Aus Politik und Zeitgeschichte B17/ 2004, S. 29-37.
44 Vgl. Bertelsmann Europa-Kommission, Europas Vollendung vorbereiten. Forderungen an dieRegierungskonferenz, Gütersloh 2000, S. 18.
45 Vgl. Frank Decker, »Mehr Demokratie wagen; Die Europäische Union braucht einen institu-tionellen Sprung nach vorn« in: Aus Politik und Zeitgeschichte B5/ 2001, S. 33-37, hier S. 37.
304 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 304

nationaler Parteien und Themen [in die Europawahlkämpfe, die Verf.] zu verhin-dern«. 46
Mit dem Vertrag von Lissabon ist man in Bezug auf die eben referierten Vorschlägeauf halber Strecke stecken geblieben. Artikel 17 Abs. 7 EUV regelt nunmehr: »Der Eu-ropäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament nach entsprechenden Konsultationenmit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommis-sion vor; dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament.Das Europäische Parlament wählt diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner Mitglie-der.« Die Hoffung, dass dieses Verfahren eine »Personalisierung beziehungsweise Poli-tisierung des Wahlkampfs«47 bewirken könnte, hat sich, wie gezeigt, zumindest bei derEuropawahl des Jahres 2009 nicht erfüllt. Der europäische Integrationsprozess hat dasnationale Parteiensystem schon deshalb nicht unter Anpassungsdruck setzen können,weil er den Parteien, die als macht- und ämterorientierte Organisationen agieren, wederetwas verspricht, noch etwas abverlangt.48 Das politische System der BundesrepublikDeutschland als Ganzes hat sich zweifellos spürbar europäisiert, wobei seine Subsystemedavon in unterschiedlicher Weise betroffen sind.49 Das Parteiensystem ist von dem Eu-ropäisierungsprozess noch am wenigsten betroffen.
Zusammenfassung
Die Europäisierung der deutschen Politik hat die Parteien nur am Rande durch ihre Mit-wirkung in europäischen Parteien erfasst. In Deutschland waren EU-feindliche Parteienbei Wahlen bisher nicht erfolgreich. Die Parteien sehen in europäischen Wahlen bis heuteNebenwahlen, die mit nationalen Themen bestritten werden. Ein willkommener Ne-beneffekt sind die zusätzlichen Einnahmen aus der staatlichen Parteienfinanzierung. In-nerorganisatorisch ist in den Parteien kein »Europäisierungseffekt« nachzuweisen. Die-ser ist generell nicht zu erwarten solange auf europäischer Ebene für die nationalen Par-teien sich nicht die Perspektive des Macht- und Ämtererwerbs bietet.
Summary
German political parties have only been marginally affected by the Europeanization ofGerman politics. The most visible change they have gone through is their engagement inEuropean political parties. Anti-Europe parties have so far had no electoral success inGermany. German parties still regard European elections as »secondary elections«. Con-troversies in election campaigns focus on national issues. German parties welcome, of
46 Simon Hix, »Parteien, Wahlen und Demokratie in der EU« in: Markus Jachtenfuchs/ BeateKohler-Koch (Hg.), Europäische Integration, Opladen 2003², S. 151-180, hier S. 173.
47 Vgl. Jürgen Mittag/ Claudia Hülsken a.a.O. (FN 25), S. 121.48 So auch Robert Ladrech, a.a.O. (FN 3), S. 948.49 Vgl. dazu ausführlich Roland Sturm/ Heinrich Pehle, Das neue deutsche Regierungssystem. Die
Europäisierung von Institutionen, Entscheidungsprozessen und Politikfeldern in der Bundes-republik Deutschland, Wiesbaden 20052.
305 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 305
ZfP 57. Jg. 3/2010

course, the additional income created by the state-financing of political parties based onEuropean election results. They have, however, not adjusted their organisational struc-ture to make it more responsive to European issues. This is no surprise, because nationalparties’ electoral concerns, i.e. vote-maximisation and office-seeking, are mostly un-touched by EU policy debates and struggles.
Heinrich Pehle / Roland Sturm, What is the significance of European integration forparty competition in Germany?
306 Heinrich Pehle/Roland Sturm · Die europäische Integration 306
Bitte bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei unter www.nomos-shop.de
Politika. Passauer Studien zur Politikwissenschaft
Politikberatung auf parlamentarischer EbeneEine Analyse der Enquete-Kommission zur Föderalismusreform im Bayerischen LandtagVon Tobias Lang2010, Band 3, 290 S., brosch., 39,– €, ISBN 978-3-8329-5014-9
Das Buch untersucht die internen Arbeitsläufe einer Enquete-Kommission und bietet so einen Blick von innen heraus und nicht wie üblich von außen auf die Arbeit eines solchen Gremiums. Untersucht werden dabei die Phasen von der Ein-setzung über die Ergebnisfindung bis zum Schlussbericht mit einem Schwerpunkt auf dem Verhältnis von Politik und Wissenschaft.

Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann
Der Parteienstaat – ein immerwährendes demokratischesÄrgernis? Ideologiekritische und empirische Anmerkungen zu
einer aktuellen Debatte1
Parteienstaatskritik als ritualisierte Verkündung: Demokratischer Purismus in derveröffentlichten Meinung
Das Tun und (Unter)Lassen von Parteipolitikern zieht seit jeher besondere und beson-ders kritische Aufmerksamkeit auf sich. In Geschichte und Gegenwart repräsentativerparlamentarischer Systeme genießt das grundlegende Strukturprinzip dieser Systeme, derParteienstaat, das zweifelhafte Privileg, wegen seiner tatsächlichen und vermeintlichenFehlentwicklungen nicht nur in breiten Schichten der Bevölkerung, sondern auch inTeilen der Geisteseliten auf tief sitzendes Misstrauen und erklärte Ablehnung zu stoßen.Nicht nur in Deutschland, aber hier besonders ausgeprägt, ruft allein die Erwähnung vonParteipolitik reflexhafte Distanzierung hervor. Wohlgemerkt: Dass Parteien und Partei-politiker unter kritischer Beobachtung einer wachsamen Öffentlichkeit stehen, verstehtsich als ein Gebot funktionierender Demokratie von selbst. Denn das in heutigen De-mokratien parteienstaatlich mediatisierte staatliche Gewaltmonopol stellt unbestritteneine Zusammenballung gesellschaftlicher und staatlicher Macht dar, die steter externerKontrolle, aufmerksamer öffentlicher Beobachtung und, wo nötig, auch korrigierenderIntervention durch institutionelle Gegengewalten (beispielsweise durch die Verfassungs-gerichtsbarkeit) bedarf. Andernfalls blieben jene persönlichen Verfehlungen und Fällemissbräuchlicher Nutzung von übertragener Macht, die jeder Parteienstaat aus sich her-aus immer wieder erzeugt, ohne ein wirksames Gegengewicht. Es gäbe dann für deninneren Bereich der staatlichen Entscheidungsgewalt und Verfügung über öffentlicheRessourcen keine echte Chance zu nachhaltiger Fehlerkorrektur.
Was indes auffällt, ist die rigorose Schärfe der Parteienkritik, wie sie in der politischenPublizistik des deutschen Sprachraums vorgetragen wird. Die latent schlechte öffentlicheMeinung von Parteipolitik erhielt um die Jahreswende 1999/2000 nochmals einen regel-rechten Schub, als die mit den schwarzen Kassen des »Systems Kohl« verbundene Par-teispendenaffäre der CDU aufflog. Der abschätzige Tenor der Kritik wurde danach
1 Eine erste Fassung dieses Beitrages wurde veröffentlicht von: Oscar W. Gabriel / EverhardHoltmann, »Der Parteienstaat – Gefahrengut für die Demokratie? Ideologiekritische undempirische Anmerkungen zu einer aktuellen Debatte« in: Antonius Liedhegener / ThorstenOppelland (Hg.), Parteiendemokratie in der Bewährung. Festschrift für Karl Schmitt zum 65.Geburtstag. Baden-Baden 2009, S. 189-209. Der Beitrag wurde für die Publikation in der ZfPüberarbeitet und aktualisiert.
ZfP 57. Jg. 3/2010

durch regionale Spendenskandale, in die weitere Parteien verwickelt waren, und Debat-ten um Diäten und Nebeneinkünfte von Politikern immer wieder neu befeuert. Mancherhetorische Abrechnung, die in meinungsbildenden Blättern abgedruckt wurde, erinnertan demagogische Anti-Parteien-Affekte der Weimarer Republik. Parteien sehen sichheute neuerlich als Grablegen des Gemeinwohls beschrieben, und ihre führenden Funk-tionsträger werden als von Grund auf egoistisch, machtversessen, inkompetent und cli-quenhaft verwoben dargestellt. Solche verbale Aburteilung der Parteiendemokratie aufdem Markt der veröffentlichten Meinung wurde und wird auch von Wissenschaftlernprominent bedient.
Die Stoßrichtung der Anklagen gegen den Parteienstaat ist nicht neu. Als Belege fürdas Schattenreich, in dem Parteibonzen vorgeblich ungeniert herrschen, müssen altbe-kannte Verdächtigungen herhalten. Das erleichtert immerhin die ideologische Einord-nung der meisten parteikritischen Stimmen. Angeprangert werden die »nachhaltige Ko-lonisierung der Politik durch die Parteien«2 und das »ungehemmte Streben nach Postenund Vorteilen«.3 Wir vernehmen ferner, dass der Parteienstaat zu einem »Moloch« aus-gewachsen ist, der unsere politische Ordnung hat »verkommen« lassen.4 Parteien, solautet ein anderes Stereotyp, haben sich »zu einer Herrenkaste aufgeschwungen«,5 derenMitglieder lediglich eigene Interessen verfolgen und daher blind für das Gemeinwohlsind. Deshalb müsse zwischen »demokratiebewußten Bürgern« und »demokratieent-wöhnten Politikern«6 eine sehr deutliche Moralgrenze gezogen werden. Der »ausuferndeParteienstaat«, so befand zu Beginn des 21.Jahrhunderts ein angesehener Leitartikler derRepublik, sei »kein zukunftsweisendes Modell, sondern die Beschreibung einer Verir-rung«.7
Die Auswahl der Zitate ließe sich bis in die jüngste Gegenwart hinein unschwer ver-mehren. Wohl heißt es mitunter beschwichtigend, die Kritik gelte nur den Auswüchsendes Parteienregimes. Doch wenn an eine solche reservatio mentalis unmittelbar anschlie-ßend der Parteienstaat als ein Struktur gewordener Inbegriff des politischen Skandalsdargestellt wird, mutet jene eher wie eine rhetorische Pflichtübung an. Ein demokrati-scher Purismus, der aus Anti-Partei-Affekten gespeist wird, stellt hierzulande offenbareine intellektuelle Versuchung von schier unerschöpflicher Lebenskraft dar, und dieseVersuchung macht, wie obige Zitate illustrieren, vor den Pforten der Wissenschaft kei-neswegs immer Halt. Kennzeichnend ist ein normativ aufgeladener Gestus grundsätzli-cher Abstandshaltung gegenüber Parteipolitik und Parteipolitikern. Unter generellemVerdacht des Amtsmissbrauchs steht ein »etatisiertes« Politikerkollektiv, welches den»Staat als Beute« vereinnahmt habe. Der wertende Sprachgebrauch zeigt an, dass Vor-
2 Robert Leicht, »Die Parteien haben immer Recht«, in: Die Zeit Nr. 25, 13.6.2002.3 Klaus Stern, »Warum prüft ein Parteipolitiker die Rechenschaftsberichte der Parteien?«, in:
FAZ vom 16.2.2000.4 Christine Landfried, »Die Restsumme Volk. Moloch Parteienstaat: Geld stiftet nicht die Qualität
der Politik«, in: FAZ vom 5.2.2000,.5 Editorial in der FAZ vom 11.2.2000, S.44.6 Landfried, Die Restsumme Volk, aaO. (FN 4).7 Heribert Prantl, »Hier steht er, kann er anders?« in: Süddeutsche Zeitung vom 6.10.2003.
308 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 308

eingenommenheit und (politik)wissenschaftliche Analyse nicht immer auseinanderge-halten werden. Anreize hierfür gibt es immerhin: Wer das Rollenverständnis und Amts-handeln von Parteipolitikern als zutiefst sittenwidriges Gebaren anprangert, bewegt sichim Einklang mit dem breiten Hauptstrom von Volkes Stimme und hat außerdem denVorteil, auf der moralisch guten Seite der Regimekritik zu sein.
Es könnte eingewandt werden, man möge derlei aufgeregte Stimmen nicht allzu wich-tig nehmen. Entrüstung ersetze schließlich nicht das rationale Argument. Auch enthüllesich antipluralistische Parteienkritik von selbst als anachronistisch, soweit sie jede orga-nisierte Vermittlung politischer Interessen mit dem Argwohn belegt, derartige Vermitt-lertätigkeit entferne sich »vom Volk«. Dem Politikwissenschaftler erschließen sich ein-gebaute Denkfehler wie diese leicht. Doch eine derartige Parteienkritik verbleibt nichtim inneren Mauerring akademischer Diskurse. Coram publico wird vielmehr eine Teil-elite, nämlich die im »Parteienkartell« verbrüderte »Kaste« der Politiker, mittels öffent-licher Verkündungen von Vertretern anderer Führungsschichten, aus Wissenschaft,Wirtschaft und Medien, moralisch ausgebürgert. Wenn aber im öffentlichen Raum eineParteienfeindlichkeit dominiert, die gleichsam wissenschaftlich autorisiert auftritt, ge-reicht dies der politischen Kultur der Demokratie zum Schaden. Offenbar werden inDeutschland historische Pfade anti-parteienstaatlichen Denkens neuerlich begangen, dielängst verschüttet geglaubt waren.
Parteienwettbewerb und »suboptimale« Problembearbeitung – politikwissenschaftlicheKritik am Parteienstaat
Nun gibt es, fern jeden Ressentiments, auch eine wissenschaftlich seriöse Variante kri-tischer Einschätzung von Parteipolitik. Diese parteienkritische Sichtweise ist angesiedeltim Umfeld politikwissenschaftlicher Analysen staatlicher Steuerung und datiert aus den1980er und 1990er Jahren. Hier werden Zweifel geäußert an der hinreichenden Pro-blemlösungsfähigkeit solcher Akteurskonstellationen im Feld des Regierens, die ihrHandeln nach parteipolitischen Prioritäten ausrichten. Diese Parteienkritik ist theorie-geleitet und auch nahe der Empirie. Ansatzpunkt der Kritik sind Selbstblockaden staat-lichen Entscheidens, als deren Risikofaktor die konfliktorische Handlungsorientierungvon Parteien benannt wird. Obgleich sich diese Forschungsrichtung von moralisierendenUntertönen fernhält, trägt sie zu einem fehlgehenden Verständnis von Voraussetzungenund Folgen parteibezogenen Handelns bei – unterstellt sie doch, ausgehend von reali-tätsfremden Prämissen, das parteipolitische Handlungsmuster an sich sei nur tauglich für»suboptimale« Problemlösungen in den Arenen staatlichen Entscheidens.8
8 Vgl. Fritz W. Scharpf, »Verhandlungssysteme, Verteilungskonflikte und Pathologien der poli-tischen Steuerung« in: Manfred G. Schmidt (Hg.), Staatstätigkeit, (PVS-Sonderheft 19, 1988),S. 61 – 87; ders., »Nötig, aber ausgeschlossen. Die Malaise der deutschen Politik« in: FAZ vom5.6.1997; ferner die auf die sogenannte Strukturbruchthese Gerhard Lehmbruchs fokussiertenkritischen Debattenbeiträge in Everhard Holtmann / Helmut Voelzkow (Hg.), »Das Regie-rungssystem der Bundesrepublik Deutschland zwischen Wettbewerbsdemokratie und Ver-handlungsde-
309 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 309
ZfP 57. Jg. 3/2010

Zwischen dieser kritisch-analytischen Einschätzung des parteipolitischen Faktors unddessen populistischer Herabwürdigung liegen intellektuelle Welten. Trüge man die un-terschiedlichen Varianten der Kritik am Parteienstaat auf einer Achse ab, fände man mit-hin an einem Pol eine Problemsicht, die wissenschaftlichen Maßstäben genügt. Den ent-gegengesetzten Pol bilden gepflegte Vorurteilsstrukturen. Von dort aus wird moralischargumentiert. Als Merkmale eines wünschenswerten Gegenmodells zum Parteienstaatbeschrieben werden die »wahre« Demokratie, also eine »authentische« Manifestation desVolkswillens, die nicht durch intermediäre Zwischengewalten verfälscht wird, ferner ein»echter« Parlamentarismus, in welchem das freie Mandat der Abgeordneten nicht demJoch des »Fraktionszwangs« unterliegt, sowie ein überparteiliches Staatshandeln, dasnicht von partikularen Interessen unterwandert, sondern am gemeinen Nutzen ausge-richtet ist. In derartigen Deutungsmustern lebt eine pluralismusfeindliche und daher imKern antidemokratische, seinerzeit von prominenten Vertretern der deutschen Staats-rechtslehre tradierte Denktradition der Weimarer Republik fort.9
Nicht die enge gedankliche Kopplung des parteipolitischen Faktors mit Macht undpolitischer Moral an sich ist hierbei das Problem, sondern die gleichsam ontologischeSichtweise, aus der heraus das Wesen des Parteienstaates mit Machtmissbrauch undunmoralischem bzw. ausnahmslos eigensüchtigem Politikerhandeln gleichgesetzt wird.Einmal als ein (ab)wertender Tendenzbegriff eingeführt, ist der tatsächliche Erklärungs-gehalt der Kategorie Parteienstaat dann naturgemäß gering. Zudem fällt auf, dass dermoralische Bannstrahl, der gegen die Strukturen und Mechanismen des Parteienregimesgeschleudert wird, zwar reich an Emphase, aber in aller Regel erstaunlich dünn empirischfundiert ist. Stattdessen knüpft diese Spielart der Kritik, ausdrücklich oder unerklärt, anältere ideologische Deutungen und sozialromantische Mythen an, die ungeachtet ihresvordemokratischen Ursprungs den Übertritt in das demokratische Zeitalter scheinbarmühelos geschafft haben (dazu gleich mehr).
Wiederkehrende Argumentationsfiguren der Kritik am Parteienstaat
Konkret kennzeichnend für überschießende Parteienstaatskritik sind nach unseren Be-obachtungen folgende regelmäßig wiederkehrende Argumentationsfiguren:1. Der Parteienstaat ist seinem Wesen nach expansiv; sein Drang, seinen Einflussbereich
in Gesellschaft und Wirtschaft auszudehnen, kennt keine Grenzen.2. An den Hebeln und »Futterkrippen« des Parteienstaates sitzt ein Kollektivsubjekt
besonderer Art, die »politische Klasse«.10
mokratie«, Wiesbaden 2000, S. 9 – 21.9 Siehe Arnold Köttgen, Die Krise der kommunalen Selbstverwaltung, Tübingen 1931; Ernst
Forsthoff, Die Krise der Gemeindeverwaltung im heutigen Staat, Berlin 1932.10 Hans Herbert von Arnim, Fetter Bauch regiert nicht gern. Die politische Klasse – selbstbezogen
und abgehoben, München 1997; ders. »Demokratie vor neuen Herausforderungen« in: Lan-deszentrale für Politische Bildung Schleswig-Holstein (Hg.), Die schwierige Demokratie, Kiel1997, S.13 – 25; kritisch: Everhard Holtmann »Die Politische Klasse: Dämon des Parteienstaa-
310 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 310

3. Diese personifiziert das »ungehemmte Streben nach Posten und Vorteilen« (sieheoben), das für den Parteienstaat systemtypisch ist.11
4. Im Gefolge parteienstaatlicher Durchdringung alles öffentlichen Lebens wird dieTrennlinie zwischen Gesellschaft und Staat auf doppelte Weise verwischt: einmaldurch parteipolitisch angeleitete Ämterpatronage im staatlichen und para-staatlichenSektor, und zum anderen durch zwischen Parteipolitikern getroffene informelle Ab-sprachen, welche die formale Kompetenzordnung des staatlichen Institutionengefü-ges unterlaufen.12
5. Parteien vertreten partikulare Interessen, und Parteipolitiker verfolgen ihren persön-lichen Vorteil. Folglich bleibt im Prozess parteienstaatlich organisierter politischerWillensbildung das Gemeinwohl als ein Kriterium politischen Wägens auf der Stre-cke.
6. Da der Parteienwettbewerb das Lebenselixier des Parteienstaates ist, verstellen bzw.verengen ideologische Präferenzen und Verteilungsinteressen die Räume der Politik,sachlich angemessene Problemlösungen zu finden.13
7. Als ein Antidot gegen das »lastende (und lasterhafte) Übergewicht der Parteien«14 imallgemeinen und gegen das verkrustete Machtkartell der politischen Klasse im be-sonderen ist die Ausweitung direktdemokratischer Instrumente zwingend geboten.
Moral, Politik und soziale Ordnung – tradierte Kulturmuster als Bezugspunkteparteienkritischen Denkens
Alle genannten Argumentationsfiguren lassen sich auf eines – oder auf mehr als eines –von drei altbekannten Kulturmustern sozialer und politischer Ordnung zurückführen.Diese Kulturmuster sind in sich jeweils dichotomisch angeordnet: Gemeinschaft versusGesellschaft, Einheit statt Differenz, Sachpolitik anstelle von Interessentenstandpunktund Parteienideologie. Mit diesen Gegensatzpaaren werden im heutigen parteienkriti-schen Denken in unterschiedlicher Weise ältere Bilder einer organischen Soziallehre undholistischen politischen Theorie aufgenommen. Alle drei Dichotomien sind ihrem geis-tesgeschichtlichen Ursprung zufolge Variationen der großen Erzählung einer identitären
tes? Zum analytischen Nutzen eines geflügelten Begriffs« in: Stefan Marschall / ChristophStrünck (Hg.), Grenzenlose Macht. Politik und Politikwissenschaft im Umbruch, Festschrift fürUlrich von Alemann zum 60. Geburtstag, Baden-Baden 2004, S. 41-60.
11 Hans Herbert von Arnim, Staat ohne Diener. Was schert die Politiker das Wohl des Volkes?,München 1993.
12 Vgl. hierzu, das Element der Informalität positiv würdigend, die rechtswissenschaftliche Pio-nierstudie von Helmuth Schulze-Fielitz, Der informale Verfassungsstaat. Aktuelle Beobach-tungen des Verfassungslebens der Bundesrepublik Deutschland im Lichte der Verfassungstheo-rie, Berlin 1984; kritisch: Dieter Grimm, Die Verfassung und die Politik – Einsprüche zu Stör-fällen, München 2001.
13 Gerhard Lehmbruch, Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Regelsysteme und Spannungslagenim politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 2000.
14 Robert Leicht, »Wir sind das Volk. Gegen den Parteienstaat helfen nur noch Volksentscheide«in: Die Zeit, Nr.9, 24.2.2000.
311 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 311
ZfP 57. Jg. 3/2010

Beziehung von Regierenden und Regierten, wie sie in Rousseaus Contrat Social ebensobrillant wie wirklichkeitsfremd erdacht worden ist.15 Auf diesem ideellen Grund ergibtsich die politische Formel der Demokratie »eigentlich ganz einfach«. Sie lautet, mit einemSatz Hans Herbert von Arnims, »Mitentscheidung des Volkes und sachliche Richtig-keit«.16
Wie von unsichtbarer Hand geführt, ergänzen sich die dichotomen Rasterungen »gu-ter« und »schlechter« sozialer Ordnung und politischer Systemstrukturen in ihrer aufdie Gegenwart bezogenen Adaption dort, wo angesichts des heute erreichten komplexenEntwicklungsstandes von Gesellschaft und Politik die Erklärungskraft eines dieser Topoiallein versagt. »Gemeinschaft« bildet hierbei die Vorstellung eines natürlichen Sozialzu-sammenhangs ab, der homogen und mit sich selbst eins und im Reinen realiter vielleichtnicht immer ist, aber doch sein kann, so man ihm originäre Rechte nicht vorenthält; ingemeinschaftlichem Rund lassen sich Bedürfnisse demnach unmittelbar konsoziativ re-geln. Von diesem sozialen Organismus führt der Weg zur Projektion einer egalitären und»autonomen« Ermittlung des Volkswillens, die gut – oder auch ganz – ohne Beimischungparteiförmiger Elemente auskommt. In der Verlängerung dieses Denkens ist der insti-tutionelle Hebel für zeitgemäße Systemreform auch aus heutiger Sicht die direkte De-mokratie. Nicht abschaffen, aber doch wenigstens substantiell ergänzen soll sie das ver-fassungsrechtlich geltende Basisprinzip der politischen Repräsentation.17
Indessen wird von jenen, die heutzutage für mehr plebiszitäre Rechte eintreten, dieinterne Differenzierung moderner Staatsgesellschaften – nach sozialen Lagen und Dis-paritäten, nach individuell divergierenden Interessen und Vorlieben sowie nach regio-nalen Unterschieden – nicht negiert. Auch Kritiker des Parteienstaats, die diesen direkt-demokratisch transformieren wollen, räumen gewöhnlich ein, dass es infolge der terri-torial wie sektoral gesteigerten Komplexität politischer Entscheidungslagen bestimmterKoordinationsleistungen von Parteien zwingend bedarf. Normativ aufgewertet wirdheute die Zivilgesellschaft. Diese ist nunmehr das geborene politische Subjekt, das ple-biszitäre Instrumente einfordern kann, um den allgemeinen politischen Willen unver-fälscht auszudrücken. Bürgerinitiativen, neue soziale Bewegungen sowie neuestens Pu-blic Interest Groups (wie etwa attac) erhalten die höheren Weihen einer alternativen undobendrein »guten« Repräsentation. Die demokratische Legitimierung der Zivilgesell-schaft setzt also die Anerkennung sozialer Differenz, die sich im politischen Raum kon-trär artikuliert, zwingend voraus.
Konsequent wäre es da eigentlich, das Bild einer homogenen sozialen Gemeinschaftaufzugeben. Doch lässt sich dieses Konstrukt wegen seines stilisierbaren Moralgehalts
15 Everhard Holtmann » Rousseau auf der Reise durch Deutschland. Vom instrumentellen Ge-brauch der politischen Utopie direkter Demokratie« in: Martin Kühnel / Walter Reese-Schäfer / Axel Rüdiger (Hg.), Modell und Wirklichkeit. Anspruch und Wirkung politischenDenkens. Festschrift für Richard Saage zum 60.Geburtstag, Halle 2001, S. 189 – 197.
16 Von Arnim, Demokratie vor neuen Herausforderungen, aaO. (FN. 10).17 Theo Schiller / Volker Mittendorf (Hg.), Direkte Demokratie – Forschung und Perspektiven,
Wiesbaden 2002; Peter Neumann, Sachunmittelbare Demokratie im Bundes- und Landesver-fassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der neuen Länder, Baden-Baden 2009.
312 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 312

gut weiter verwenden. Tatsächlich werden heute in der kritischen Auseinandersetzungmit dem Parteienstaat bei dem Begriffspaar Gemeinschaft/ Gesellschaft die positiven undnegativen Vorzeichen einfach umgekehrt: »Gesellschaft« steht nunmehr idealiter für denAnspruch selbstbestimmter und unvermittelter Partizipation einer Sozietät individuali-sierter Bürger, die sich über ihre Interessen und Vorlieben in Formen und Foren einerberatenden Demokratie austauschen. In der modernen Bürgergemeinde werden somitdie dem alten Gemeinschaftsideal zugeschriebenen guten Seiten, d.h. die Erfahrbarkeitdirekter sozialer Beziehungen einschließlich ihrer solidarischen und konsensstiftendenWirkkräfte, positiv aufgehoben. Demgegenüber erhält jetzt »Gemeinschaft« eine nega-tive Chiffre: Sie ist heute das verschworene Kartell der Parteipolitiker, das durch einexklusives Kollektivinteresse zusammengeschweißt und nach außen hermetisch abge-riegelt wird. So lässt sich mit Hilfe der alten, aber umgewerteten Dichotomie von Ge-meinschaft und Gesellschaft die Antithese zum Parteienstaat neu aufbauen.
Ein anderer ideeller Gegenstoß, der gegen die Parteiendemokratie geführt wird, ope-riert mit dem verwandten Gegensatzpaar von Einheit und Differenz. Obgleich derselbenideologischen Familie zugehörig, werden aus dieser Sicht der Parteienstaatskritik, ab-weichend von der zuerst beschriebenen Variante, differente Interessen weiterhin als po-litisches Gefahrengut deklariert, jedenfalls in ihrer Verbindung mit organisiertem »Par-teigeist«. Kern allen Übels ist demzufolge, dass Sonderinteressen, die von Parteien ein-gefangen werden, »auswuchern« zu parteipolitisch organisierten Partikularansprüchenund einmünden in den Machttrieb eigensüchtiger Parteipolitiker, die sich des Staatswil-lens, und damit des höchstmöglichen Ausdrucks überparteilicher Einheit, in Gänze be-mächtigen. Der Dynamik des Parteienregimes korrespondiert, dieser Lesart zufolge, aufder Ebene der verbandlich organisierten Interessen der »Verbändestaat«. Die parteipo-litische Durchdringung des Staates wird folglich durch das parallele Kartell korporatis-tischer Steuerung flankiert, mit dem Effekt, dass umso stärker »die Pflicht zur Beachtungdes Gemeinwohls verblasst«.18
Wie aber kann die Staatswillensbildung aus dem Zugriff der verselbständigten partei-politischen Partikularwillen gelöst und wie kann eine interessenunabhängige, »unierte«staatliche Handlungsfähigkeit gewahrt bzw. wiederhergestellt werden? – An diesemPunkt setzt die dritte, im engeren Sinne wissenschaftliche Variante der Parteienstaats-kritik an. Ohne in alarmistische Warnungen vor schädlichen Partikularinteressen miteinzustimmen, plädiert sie für den Primat der Sachpolitik. Auch diese parteienkritischeVariante hat im deutschen politischen Denken eine lange Tradition. Im Kern wird ar-gumentiert, es gebe stets eine Alternative der politischen Problemlösung, die sich aus derSache heraus begründe und folglich der programmatisch festgelegten bzw. ideologischbefangenen Perspektive der Parteiräson und des Parteipolitikers überlegen sei. Gelingtes, ideologische Präferenzen zugunsten »der Sache« zurückzustellen, nimmt die gefun-dene Lösung folgerichtig einen Platz ganz nahe am Gemeinwohl ein. Hier sollen fest-stellbare Funktionsschwächen der Parteiendemokratie auf eine erkennbar technokrati-sche Weise behoben werden. Neutrale Experten, »Sachverständige« also, erscheinen prä-
18 Peter Graf Kielmannsegg, »Wenn das Gemeinwohl aus dem Blick gerät« in: FAZ vom 8.2.2000.
313 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 313
ZfP 57. Jg. 3/2010

destiniert als Geburtshelfer staatlicher politischer Entscheidungen. Angesichts solcherAussichten von mehr Effizienz und Professionalität, sieht sich der Parteienstaat einmalmehr ins Abseits bestenfalls zweitbester Lösungen gestellt.
Die Bedeutung der Parteienkritik für die deutsche Demokratie
Für die Gewährleistung einer lebendigen Parteiendemokratie übernimmt die wissen-schaftliche und publizistische Parteienstaatskritik eine wichtige Wächterfunktion. Ge-rade weil die Strukturmuster und die Handlungslogik parteienstaatlichen Tuns dem par-teipolitischen Faktor eine Schlüsselrolle nicht nur der Vermittlung zwischen Gesellschaftund Staat, sondern auch in Kernbereichen staatlichen Handelns selbst zuweisen, undgerade weil Parteipolitik auf der Bandbreite zwischen Parteienfinanzierung und Patro-nage permanent für Grenzüberschreitungen anfällig ist, kann das containment, d.h. dieEingrenzung des parteipolitischen Elements, nicht dessen Selbststeuerung und Selbst-kontrolle allein überlassen bleiben.
In der empirischen Demokratieforschung ist es seit langem üblich, zwischen den Ein-stellungen zur Idee der Demokratie und zum Funktionieren der Demokratie zu unter-scheiden. Diese zweidimensionale Unterscheidung lässt sich auf die hier diskutierte Fragenach Reichweite und Grenzen von Parteienkritik übertragen: Diese ist zulässig und de-mokratieverträglich, soweit und solange sie Funktionsstörungen und Praxisdefizite desParteienstaates thematisiert. Sie ist problematisch, sofern sie – explizite oder unausge-sprochen – darauf zielt, die Funktionsbedingungen des demokratischen Parteienstaates,zu welchen beispielsweise Berufspolitiker und ein Fraktionenparlamentarismus gehören,zu delegitimieren.
Jüngstes Beispiel für die in Teilen der politischen Öffentlichkeit verbreitete Neigung,das notwendigerweise partei- bzw. fraktionenpolitisch definierte Profil des modernenParlamentarismus zu beschneiden, war die publizistische Begleitmusik anlässlich derNeuwahl des deutschen Bundespräsidenten. Ein bekanntes Nachrichtenmagazin schriebhierzu, aufgrund der koalitionspolitisch aufgeladenen Wahlhandlung werde »den Dele-gierten und der Wahl... die Würde genommen«.19 Und Kurt Biedenkopf sekundierte mitdem (zweifelsfrei zutreffenden) Hinweis, die Parteien »sind nicht das Volk«, um dannfortzufahren: »Die Bundesversammlung als Vertretung des Volkes wählt den Bundes-präsidenten aus den Reihen der vorgeschlagenen Kandidaten. Auf die Mitwirkung derpolitischen Parteien ist sie dabei nicht angewiesen«.20
Hierzu ist anzumerken, dass die Vorstellung, eine über gewählte Parlamente besetzteVertretungskörperschaft wie die Bundesversammlung konstituiere ein Prinzip popula-rer, gleichsam volksunmittelbarer und um die Parteien herumführender Repräsentation,wirklichkeitsfremd, weil mit dem institutionellen Zuschnitt des demokratischen Partei-enstaates nicht kompatibel ist. Um es mit einem weiteren ehemaligen Ministerpräsiden-
19 DER SPIEGEL vom 26/2010.20 Kurt Biedenkopf, »Zur Bundesversammlung« in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17. Juni
2010, S.33.
314 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 314

ten, Bernhard Vogel, zu sagen: Auch eine Bundesversammlung agiert nicht »im politischluftleeren Raum«.
Selbstredend lassen sich keine direkten Kausalbeziehungen zwischen einer über dieKritik an Praktiken des Parteienstaates hinausreichenden Parteienstaatskritik in Wissen-schaft, Publizistik und auch seitens prominenter Alt-Parteipolitiker einerseits sowie einerallgemein verbreiteten parteien(staats)kritischen Grundstimmung andererseits aufzei-gen. Jedoch ist anzunehmen, dass auch hier steter antiparteilicher Tropfen den parteien-staatlichen Stein höhlt.
Parteienkritik in Deutschland: Befunde der neueren empirischen Forschung
Wie in den vorigen Abschnitten gezeigt wurde, sind negative Einstellungen zu den po-litischen Parteien fest in der politischen Tradition Deutschlands verankert. Sie finden sichin intellektuellen Diskursen, in den Massenmedien und in den Einstellungen der Bevöl-kerung. Ihre Ursache liegt in kaum reflektierten Antiparteienaffekten, einem moralisie-renden Politikverständnis und einem Unverständnis der Funktionsprinzipien einer plu-ralistisch-repräsentativen Demokratie. Insbesondere die Auseinandersetzung über dieRepräsentations- und Legitimationsschwächen moderner Demokratien wies immer einestarke parteienkritische Färbung auf.21
Direkte Beziehungen zwischen der Stoßrichtung der intellektuellen Parteienkritik unddem Bild der Parteien in der Bevölkerung lassen sich empirisch kaum nachweisen. Den-noch bilden Wissenschaft und Öffentlichkeit in modernen Gesellschaften keine herme-tisch voneinander getrennten Sphären des politischen Lebens. Die Massenmedien trans-portieren die Kernbotschaften der Parteienkritik in die Öffentlichkeit. Insofern ist es vonInteresse zu erfahren, wie verbreitet die von Wissenschaft und Medien artikulierten par-teienkritischen Positionen in der deutschen Öffentlichkeit sind und wie sie sich auf dieAkzeptanz der Demokratie in Deutschland auswirken. Der folgende Teil dieses Beitragesbeschäftigt sich mit der Klärung dieser Fragen. Die untersuchten Einstellungen betreffenunterschiedliche Aspekte des Wirkens der politischen Parteien. Da entsprechende Datennur für den Zeitraum 1994 bis 2005 zur Verfügung stehen, ergänzen wir die Untersu-chung um eine längerfristig angelegte Darstellung der Entwicklung der Parteiidentifika-tion und des Vertrauens zu den politischen Parteien.
Zur Entwicklung der Parteiidentifikation und des Vertrauens zu den politischen Parteien
Im Zentrum der bisherigen empirischen Untersuchungen des Verhältnisses der Bürgerzu den deutschen Parteien standen Einstellungen wie die Parteiidentifikation, die Par-teisympathie oder die Zuweisung von Problemlösungskompetenz an die Parteien. Die
21 Vgl. Heinrich Oberreuter, Parteien zwischen Nestwärme und Funktionskälte, Osnabrück1983; Richard Stöss, »Parteienstaat oder Parteiendemokratie« in: Oscar W. Gabriel / OskarNiedermayer / Richard Stöss (Hg.), Parteiendemokratie in Deutschland, Opladen 2002, S. 13– 35.
315 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 315
ZfP 57. Jg. 3/2010

Entwicklung dieser Einstellungen ist in Deutschland über einen längeren Zeitraum gutdokumentiert,22 auch im internationalen Vergleich.23 Besondere Aufmerksamkeit wid-met die Forschung dem Wandel der Parteiidentifikation, da sie dieser wichtige Funktio-nen für das Verhältnis der Bürger zum politischen System zuschreibt. Nach einer unterPolitikwissenschaftlern weit verbreiteten Auffassung fördert sie das politische Interesse,Urteilsvermögen, Selbstbewusstsein sowie die aktive Beteiligung der Menschen undstärkt ihre Neigung, die Demokratie zu unterstützen sowie den politischen Institutionenund Akteuren zu vertrauen. Dadurch trägt sie sowohl zur Responsivität als auch zurEffektivität des politischen Systems, seiner Institutionen und Repräsentanten bei.24 Die-ser Argumentation zu Folge stellt sich der in vielen zeitgenössischen Demokratien do-kumentierte Rückgang der Parteiidentifikation als ein der Vitalität der Demokratie ab-träglicher Vorgang dar
Entgegen den populären Thesen vom Niedergang der Parteiendemokratie vermittelndie in den Abbildungen 1 und 2 enthaltenen Daten keineswegs den Eindruck einer mas-siven, sich im Zeitverlauf verstärkenden Abwendung der Bundesbürger von den politi-schen Parteien. Im Jahr 2009 bezeichneten sich sieben von 10 Bürgern der alten Bundes-länder und mehr als jeder zweite in den neuen Ländern als Anhänger einer Partei. Vondiesen fühlte sich der weitaus größte Teil der CDU/CSU, der SPD, der FDP und denGrünen verbunden. Zudem sind moderate und starke Parteibindungen erheblich häufi-ger anzutreffen als schwache (tabellarisch nicht ausgewiesen). Ebenso eindeutig ist al-
22 Jürgen W. Falter / Hans Rattinger 2002, »Die deutschen Parteien im Urteil der öffentlichenMeinung 1977 bis 1999« in: Oscar W. Gabriel / Oskar Niedermayer / Richard Stöss (Hg.),Parteiendemokratie in Deutschland, Opladen 2002, S. 484 – 503; Silke Keil, »Parteiidentifika-tion als des ‚Pudels Kern’? Zum Einfluss unterschiedlicher Formen der Parteineigung auf dieEinstellungen der Bürger zu den politischen Parteien« in: Oscar W. Gabriel / Jürgen W. Falter /Hans Rattinger (Hg.), Wächst zusammen, was zusammengehört? Stabilität und Wandel poli-tischer Einstellungen im wiedervereinigten Deutschland, Baden-Baden 2005, S. 91-127; HansRattinger, »Abkehr von den Parteien? Dimensionen der Politikverdrossenheit« in: Aus Politikund Zeitgeschichte B11/1993, S. 24-35; ders., »Die Bürger und ihre Parteien« in: Jürgen W.Falter / Oscar W. Gabriel / Hans Rattinger (Hg.), Wirklich ein Volk? Die politischen Orien-tierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich, Opladen 2000, S. 209-240; ders., »DieParteien – ungeliebt aber ohne Alternative« in: Jürgen W. Falter, u. a. (Hg.): Sind wir ein Volk?Ost- und Westdeutschland im Vergleich. München 2006, 82-106.
23 Frode Berglund / Sören Homberg / Hermann Schmitt / Jacques Thomassen, »Party Identifi-cation and Party Choice« in: Jacques Thomassen (Hg.), The European Voter. A ComparativeStudy of Modern Democracies, New York 2005, S. 106-124; Russell J. Dalton, »The Decline ofParty Identifications« in: ders. / Martin P. Wattenberg (Hg.), Parties without Partisans. PoliticalChange in Advanced Industrial Democracies. Oxford/New York 2000, S. 19-36; HermannSchmitt / Sören Holmberg, »Political Parties in Decline« in: Hans-Dieter Klingemann / DieterFuchs (Hg.), Citizens and the State, Oxford 1995, S. 95-133.
24 Paul A. Abramson, Political Attitudes in America. Formation and Change, San Francisco 1983,S. 72ff; Angus Campbell / Philip E. Converse / Warren E. Miller / Donald E. Stokes, TheAmerican Voter, New York 1960; Max Kaase, »Legitimitätskrise in westlichen demokratischenIndustriegesellschaften: Mythos oder Realität« in: Helmut Klages / Peter Kmieciak (Hg.),Wertwandel und gesellschaftlicher Wandel, Frankfurt a. M./New York 1979, S. 328-350, de-taillierte empirische Analysen dieser Zusammenhänge finden sich bei Keil, Parteiidentifikation,aaO. (FN 22).
316 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 316

lerdings ein zweiter, problematischer Sachverhalt: Zwischen 1977 und 2007 ist der Anteilder Parteiidentifizierer in den alten Bundesländern um ca. 10 Prozentpunkte gesunken.In den neuen Ländern nahm er – bei periodisch auftretenden Schwankungen – in derTendenz weder zu noch ab. Im Gegensatz dazu entwickelte sich die Intensität der Par-teibindungen in den alten und neuen Bundesländern diskontinuierlich, lässt aber keinenstetigen Rückgang erkennen. Demnach waren vor allem die peripheren Parteianhänger,d.h. die Personen mit einer schwachen bis mäßigen Parteibindung, für den Rückgang desAnteils der Parteiidentifizierer in Deutschland verantwortlich. Ungeachtet ihrer Abnah-me befindet sich die Parteiidentifikation in Deutschland nach wie vor auf einem hohenNiveau.
Abbildung 1: Anteil der Bürger mit Parteibindung in Deutschland, 1977-2009 (in Prozentund gleitender Durchschnitt)
Abbildung 1: Anteil der Bürger mit Parteibindung, 1977-2009 (in Prozent und gleitender Durchschnitt)
100
70
80
90
100
40
50
60
70
80
90
100
0 0245 69 853 0 0266 + 45 981
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ABL ABL gleitender Durchschnitt NBL NBL gleitender Durchschnitt
y = -0,0245x + 69,853R² = 0,3414
y = 0,0266x + 45,981R² = 0,071
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ABL ABL gleitender Durchschnitt NBL NBL gleitender Durchschnitt
y = -0,0245x + 69,853R² = 0,3414
y = 0,0266x + 45,981R² = 0,071
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
ABL ABL gleitender Durchschnitt NBL NBL gleitender Durchschnitt
Quellen: 1977-2007: Politbarometer; 2008: ESS; 2009: GLES. Eigene BerechnungenFragetext (exemplarisch, Abweichungen in einzelnen Studien): „Viele Leute in der Bundesrepublikneigen längere Zeit einer bestimmten politischen Partei zu, obwohl sie auch ab und zu mal eineandere Partei wählen. Wie ist das bei Ihnen: Neigen Sie, ganz allgemein gesprochen, einer be-stimmten Partei zu?“. Angaben: Prozentanteile derjenigen, die einer Partei zuneigen.
317 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 317
ZfP 57. Jg. 3/2010

Abbildung 2: Stärke der Parteibindung in Deutschland, 1977-2009 (Mittelwerte undgleitender Durchschnitt)
Abbildung 2: Stärke der Parteibindung, 1977-2009 (Mittelwerte und gleitender Durchschnitt)
0,4
0,5
0 1
0,2
0,3
0,4
0,5
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
y = -8E-05x + 0,3032R² = 0 0321
y = 2E-05x + 0,2538R² = 0 0005
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
ABL ABL gleitender Durchschnitt NBL NBL gleitender Durchschnitt
y = -8E-05x + 0,3032R² = 0,0321
y = 2E-05x + 0,2538R² = 0,0005
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 03 04 05 06 07 08 09
ABL ABL gleitender Durchschnitt NBL NBL gleitender Durchschnitt
Quellen: 1977-2007: Politbarometer; 2008: ESS; 2009: GLES. Eigene BerechnungenAnmerkungen: Mittelwerte zwischen: -1 ‚sehr schwach‘ und +1 ‚sehr stark‘.Fragetext: Wie stark oder wie schwach neigen Sie, alles zusammengenommen, dieser Partei zu?Neigen Sie ihr sehr stark, stark, mittelmäßig, schwach oder sehr schwach zu?
Wie die Parteiidentifikation hilft das Vertrauen zu den politischen Parteien der Bevöl-kerung dabei, sich in einer komplexen politischen Welt zurechtfinden. Generell entlastetdas politische Vertrauen das Individuum von der Notwendigkeit, sich umfassende unddetaillierte Informationen über politische Sachverhalte zu beschaffen, um auf dieserGrundlage korrekte Entscheidungen treffen zu können. Es impliziert zudem die Bereit-schaft, zumindest kurzfristig risikobehaftete oder nachteilige Beschlüsse oder Program-me der Regierung oder des Parlaments zu befolgen. Das Vertrauen zu den politischenParteien ist noch unter einem weiteren Gesichtspunkt bedeutsam: Da zwischen demVertrauen zu einzelnen politischen Institutionen und Akteuren mehr oder weniger engeWechselwirkungen bestehen, kann ein geringes oder rückläufiges Vertrauen zu den Par-teien langfristig das Vertrauen zu den Kerninstitutionen des politischen Systems (Parla-ment, Regierung, Bundesverfassungsgericht) untergraben. Somit spielt das Vertrauen zuden politischen Parteien für das Funktionieren der Demokratie eine ähnlich wichtigeRolle wie die Parteiidentifikation.25
Anders als beim Niveau und der Entwicklung der Parteiidentifikation stützen die Da-ten über das Vertrauen der Deutschen zu den politischen Parteien die Feststellungen derparteienkritischen Literatur. Keine andere Institution des öffentlichen Lebens findet inder Bevölkerung ein ähnlich geringes Vertrauen wie die politischen Parteien. In praktischallen empirischen Studien nehmen sie im Ansehen der Öffentlichkeit gemeinsam mit den
25 Oscar W. Gabriel, »Integration durch Institutionenvertrauen. Struktur und Entwicklung desVerhältnisses der Bevölkerung zum Parteienstaat und zum Rechtsstaat im vereinigten Deutsch-land« in: Jürgen Friedrichs / Wolfgang Jagodzinski (Hg.), Soziale Integration. Kölner Zeit-schrift für Soziologie und Sozialpsychologie Sonderheft 39, Opladen 1999, S. 199-235.
318 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 318

Politikern einen der letzten Ränge ein.26 Wie bei dieser schlechten relativen Position zuerwarten, ist es auch um das Niveau des Vertrauens zu den politischen Parteien schlechtbestellt. In keiner der in Abbildung 3 erfassten Erhebungen gab eine Mehrheit der Men-schen in den alten und neuen Bundesländern an, den politischen Parteien zu vertrauen.Lediglich das Ausmaß parteienkritischer Einstellungen variierte, aber stets waren Skepsisund Indifferenz weiter verbreitet als das Vertrauen zu den Parteien. Die unter den Deut-schen ohnehin stets vorherrschende parteienkritische Attitüde nahm seit der Wieder-vereinigung nochmals zu.
Abbildung 3: Vertrauen zu den politischen Parteien in Deutschland, 1991-2008
Quellen: DFG-Studie “Politische Einstellungen, politische Partizipation und Wählerverhalten imvereinigten Deutschland“ (1991, 1994, 1998, 2000, 2002); IPOS (1992, 1993, 1995); KSPW-Studie„Politische Resonanz“ (1996); KAS – Konrad Adenauer Stiftung (1997); European Social Survey(2004, 2006, 2008); Reform des Wohlfahrtsstaats (2007).Fragetext: „Ich lese Ihnen jetzt eine Reihe von öffentlichen Einrichtungen vor. Bitte sagen Sie miranhand dieser Liste bei jeder, ob Sie ihr vertrauen oder nicht. Wie ist das mit den Parteien?“. Ant-wortvorgaben: Skala rekodiert von -2 („vertraue überhaupt nicht“) bis +2 („vertraue voll undganz“). Angaben: Mittelwerte.
Eine erste Bilanz der Struktur und Entwicklung des Verhältnisses der Bundesbürger zuden politischen Parteien lässt die folgenden Feststellungen zu: Zwar fühlt sich die Mehr-heit der Deutschen einer demokratischen Partei verbunden, aber nur eine Minderheitvertraut den Parteien. Dieses widersprüchliche Einstellungsbild hat sich in den letztenJahrzehnten erhalten, denn in diesem Zeitraum ist die Zustimmung der Bürger zu denParteien zurückgegangen. Sie binden heute weniger Menschen an sich als vor 30 Jahrenund stehen in geringerem Ansehen als zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung.
26 Oscar W. Gabriel / Katja Neller, »Deutschland« in. Oscar W. Gabriel / Fritz Plasser (Hg.),Deutschland, Österreich und die Schweiz im neuen Europa: Bürger und Politik, Baden-Baden2010, S. 98-116.
319 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 319
ZfP 57. Jg. 3/2010

Öffentlichkeit und Parteienkritik im vereinigten Deutschland
Während die akademische Parteienkritik den Wandel der Parteiidentifikation kaum zumThema macht, räumt sie dem Vertrauensverlust der Parteien, des Parteiensystems undder repräsentativen, parteienstaatlichen Demokratie breiten Raum ein. Die Hinweise aufdie Krise des Vertrauens der Bürger zu den Parteien gehen einher mit der Kritik an zahl-reichen negativen Erscheinungen und Fehlentwicklungen der Parteiendemokratie. Zudiesen gehört die Diagnose einer Entfernung der Parteien von den Bürgern ebenso sowiedie Feststellung der Profillosigkeit und Machtfixierung der Parteien, des Mangels inner-parteilicher Demokratie sowie der Inkompetenz und moralischen Unzulänglichkeit derpolitischen Klasse.
Diese in der Parteienkritik artikulierten Vorstellungen sind in der Bevölkerung eben-falls anzutreffen, auch wenn die Bürger die politischen Parteien in der Summe überra-schend differenziert beurteilen. Die Kritik der Öffentlichkeit gilt vornehmlich der zustarken Machtorientierung der politischen Parteien, gefolgt von ihrer zu geringen Re-sponsivität, dem Fehlen unterscheidbarer Ziele und dem unzureichenden Stand der in-nerparteilichen Demokratie. Schwächer ausgeprägt sind die Vorbehalte gegen die Ver-trauenswürdigkeit der Parteien und Politiker sowie gegen ihre Problemlösungskompe-tenz und ihre Rolle als Vertreter von Bürgerinteressen (vgl. Tabelle 1). Eine in den Jahren1998 und 2002 gestellte offene Frage nach den Schwächen der Parteien liefert weitereinteressante Informationen über die Sicht der Parteien durch die Bürger. Bemerkenswertwar zunächst, dass die weitaus meisten Befragten trotz der Möglichkeit zu Mehrfach-nennungen nur eine negative Eigenschaft der Parteien angaben. Im Zentrum der Kritikstand die geringe Glaubwürdigkeit, insbesondere die Neigung der Parteien, die gemach-ten Wahlkampfversprechen nicht zu halten (West: 41 %, Ost: 40 %). Erst mit einem sehrweiten Abstand folgten weitere negative Eigenschaften, nämlich die Streitereien zwi-schen den Parteien, die fehlende Bürgernähe und die unzulänglich entwickelte Fähigkeit,Probleme zu lösen (jeweils zwischen 8 und 10 % der Nennungen, tabellarisch hier nichtausgewiesen).
Als ebenso überraschend wie die differenzierte Bewertung der Parteien durch die Be-völkerung erweist sich die Entwicklung der Einstellungen zwischen 1994 und 2005. Ab-gesehen von einer wachsenden Kritik an den unzulänglichen innerparteilichen Mitwir-kungsmöglichkeiten und der zu geringen Unterscheidbarkeit der Parteiziele sind dieEinstellungen zu den Parteien im Zeitverlauf positiver geworden bzw. haben sich dis-kontinuierlich entwickelt. Sieht man von diesen wenigen Beispielen von Ansehensver-lusten ab, dann standen die Parteien im Jahr 2005 in höherem Ansehen in der Öffent-lichkeit als 1994.27
27 Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass die besonders positiven Werte in der Erhebung desJahres 2005 durch erhebungstechnische Faktoren bedingt sind, denn diese Daten stammen auseiner telefonischen Wiederholungsbefragung der 2002 in direkten mündlichen Interviews be-fragten Personen.
320 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 320

Tabelle 1: Einstellungen zu den politischen Parteien in Deutschland, 1994- 2005 (Anga-ben: Anteil parteienkritischer Einstellungen).
ABL NBL
MW 1994 1998 2002 2005 MW 1994 1998 2002 2005
Den Parteien geht es nurum die Macht (+) 69 73 70 68 62 75 78 80 71 71
Die Parteien wollen nur dieStimmen der Wähler, ihreAnsichten interessieren sienicht (+)
50 55 57 51 38 56 63 61 58 42
Die Parteien betrachtenden Staat als Selbstbedie-nungsladen (+)
49 57 54 49 36 50 50 58 50 42
Die Parteien unterscheidensich in ihren Zielen so sehr,dass der Bürger klare Al-ternativen hat (-)
45 45 40 39 55 46 37 37 49 59
Die Parteien üben in derGesellschaft zuviel Ein-fluss aus (+)
44 54 44 42 37 44 51 49 41 36
Ohne gute Beziehungen zuden Parteien kann der Bür-ger heute überhaupt nichtsmehr erreichen (+)
42 49 43 40 35 38 40 39 36 38
Auch einfachen Parteimit-gliedern ist es möglich, ihreVorstellungen in den Par-teien einzubringen (-)
37 40 34 35 38 34 31 33 36 38
Die meisten Parteipolitikersind vertrauenswürdigeund ehrliche Menschen (-)
34 36 32 31 37 35 37 33 31 39
Vertrauen zu den Parteien(-) 32 34 31 33 28 34 33 32 37 36
Die meisten Parteien undPolitiker sind korrupt (+) 29 33 25 39 18 33 38 34 35 26
Keine Partei problemlö-sungskompetent (+) 26 28 26 25 23 40 40 40 43 36
Keine Partei vertritt Inte-ressen (+) ne 14 17 ne ne 23 24 ne
Quelle: Transformation politischer Orientierungen und Verhaltensweisen im vereinigten Deutsch-land. Primärforscher: Oscar W. Gabriel, Hans Rattinger und Jürgen W. Falter.Anmerkungen:Fragetext: Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen über die Parteien in Deutschland vor. Bitte sagenSie mir zu jeder Aussage anhand dieser Skala von –2 bis +2, ob sie Ihrer Meinung nach zutrifft oder
321 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 321
ZfP 57. Jg. 3/2010

nicht. (Der Wert) -2 bedeutet, dass sie überhaupt nicht zutrifft, +2 bedeutet, dass sie voll und ganzzutrifft. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen. Die Werte wurden ein-heitlich so recodiert, dass parteienkritische Aussagen hohe Werte erhielten, der Wertebereich istwie folgt definiert: (-1) Sehr positive Einstellung zu den Parteien, (1) sehr negative Einstellung zuden Parteien, fehlend: Weiß nicht, Antwort verweigert(+) Zustimmung indiziert parteienkritische Einstellung(-) Ablehnung indiziert parteienkritische EinstellungProblemlösungskompetenz1994: Welche Partei ist Ihrer Meinung nach am besten geeignet, das wichtigste (zweitwichtigste)Problem also... zu lösen?1998/2002: Das für Sie wichtigste (zweitwichtigste) Problem ist... Welche Partei ist Ihrer Meinungnach am besten geeignet, dieses Problem zu lösen? Nur eine Nennung möglich. Es wurden alle Aufdie CDU/CSU/SPD, FDP und GRÜNE entfallenden Nennungen berücksichtigt. Der aus derAuszählung der Nennungen resultierende Wertebereich von 0 bis 4 wurde auf den Wertebereich0 bis 1 standardisiert.Vertrauen zu den Parteien: Ich lese Ihnen jetzt eine Reihe von öffentlichen Einrichtungen vor. SagenSie mir bitte anhand dieser Liste bei jeder, ob Sie ihr vertrauen oder nicht: Die politischen Parteien:Vertraue überhaupt nicht (-1) Vertraue eher nicht (-0,5), Vertraue teilweise (0) Vertraue weitgehend(0,5) Vertraue voll und ganz (1), fehlend: Weiß nicht, Antwort verweigert.Interessenvertretung: Ich lese Ihnen jetzt einige Gruppen, Organisationen und Parteien vor. SagenSie mir bitte anhand dieser Liste für jede davon – egal, ob Sie darin Mitglied sind oder nicht – obsie Ihrer Meinung nach Ihre Interessen vertritt oder Ihren Interessen entgegensteht. Bitte nennenSie wieder nur den entsprechenden Skalenwert.(-1) Steht meinen Interessen vollständig entgegen, (-0,5) Steht meinen Interessen teilweise entgegen(0) Weder noch (0,5) Vertritt meine Interessen teilweise (1) Vertritt meine Interessen vollständig,fehlend: Weiß nicht, Antwort verweigert. Auf die CDU/CSU/SPD, FDP und GRÜNE entfallen-den Nennungen berücksichtigt. Der aus der Auszählung der Nennungen resultierende Wertebe-reich von 0 bis 4 wurde auf den Wertebereich 0 bis 1 standardisiert.
Vor dem Hintergrund dieser Befunde kann von einem grundsätzlich negativen Verhält-nis der Bürger zu den Parteien nicht die Rede sein. Als Einrichtungen des politischenLebens sind sie vielmehr mit einer Mischung aus Kritik, Indifferenz und Zustimmungkonfrontiert. Abweichend von den Einstellungen zu den meisten anderen Institutionenüberwiegt die Kritik an den Parteien (und Politikern) jedoch deutlich die Zustimmungzu ihnen.
Diese Feststellung gilt für die neuen Bundesländer noch etwas stärker als für die alten.Besonders markant fallen diese Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland beider Bewertung der Parteien als Einrichtungen der Interessenvertretung sowie beim Urteilüber ihre Problemlösungskompetenz und über die innerparteilichen Partizipationschan-cen aus. Dieses Ergebnis entspricht den Erwartungen. Die ostdeutschen Bürger verfügtenim untersuchten Zeitraum über weniger Erfahrungen mit der Parteiendemokratie als ihreLandsleute im Westen. Zudem ist es wahrscheinlich, dass viele Menschen in Ostdeutsch-land den Parteien eine Mitverantwortung für ihre als ungünstig bewerteten Lebensbe-dingungen zuweisen.
322 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 322

Delegitimiert die Parteienkritik die Demokratie in Deutschland?
Auch wenn die aktuelle Parteienkritik nicht in gleichem Maße von antidemokratischenMotiven getragen wird wie in früheren Phasen der deutschen Geschichte, geht sie dochoft mit Forderungen nach einer Veränderung der Regimestrukturen, insbesondere nacheinem Ausbau direktdemokratischer Beteiligungsformen, einher. Die Frage, ob die inEinzelaspekten weit verbreitete, massive Kritik an den politischen Parteien negative Ein-stellungen zur Demokratie nach sich zieht und damit zur Delegitimation des politischenSystems beiträgt, lässt sich jedoch nur empirisch klären. Bei einem solchen Unterfangenmuss man allerdings differenzierter vorgehen, als dies bei den meisten akademischenParteienkritikern üblich ist. Ein eindeutiges Bild von der Tragweite parteienkritischerEinstellungen für die Unterstützung der politischen Systems gewinnt man nämlich erstdann, wenn man die verschiedenen Aspekte des Verhältnisses der Bürger zur Demokratieim Blick behält. Besonders wichtig ist es dabei, zwischen der Unterstützung der demo-kratischen Ordnung bzw. der dieser zu Grunde liegenden Prinzipien einerseits und derZufriedenheit mit dem alltäglichen, praktischen Funktionieren der Demokratie inDeutschland andererseits zu unterscheiden. Spillover-Effekte parteienkritischer Orien-tierungen auf die Bewertung des alltäglichen Funktionierens der Demokratie und der sietragenden Institutionen und Akteure sind für das Selbstverständnis, die Akzeptanz unddie Leistungsfähigkeit der Demokratie auf kurze Sicht schon deshalb nicht problema-tisch, weil die Arbeit der Parteien das praktische Funktionieren der Demokratie starkbeeinflusst. Ernsthafte Probleme ergeben sich erst dann, wenn die generalisierte Unter-stützung der demokratischen Ordnung in den Sog der Parteienkritik gerät und somit dieGrenzen zwischen dem kontroversen und dem nichtkontroversen Sektor des politischenZusammenlebens durchbrochen werden.28
Zum Zweck der Analyse des Einflusses der Parteienkritik auf die Einstellungen zumIdeal und zur Praxis der Demokratie wurden die in Tabelle 1 enthaltenen parteienkriti-schen Positionen zu einem Index zusammengefasst und zur Unterstützung der demo-kratischen Prinzipien der Meinungsfreiheit und der Legitimität von Opposition sowiezur Demokratiezufriedenheit in den alten und neuen Bundesländern in Beziehung ge-setzt. Um darüber hinaus die Annahmen über die demokratiestützende Funktion derParteiidentifikation prüfen zu können, wurde in einem zweiten Schritt der Zusammen-hang zwischen parteienkritischer Orientierungen und den Einstellungen zur Demokratiebei Personen mit einer starken bzw. schwachen oder fehlenden Parteiidentifikation ver-glichen. Wenn die Parteiidentifikation tatsächlich die ihr zugeschriebene systemstützen-de Funktion erfüllt, müssten parteienkritische Einstellungen die Unterstützung der De-mokratie bei starken Parteiidentifizierern weniger beeinträchtigen als bei schwachenIdentifizierern oder Nichtidentifizierern.
28 Oscar W. Gabriel, »Politische Einstellungen und Politische Kultur« in: Oscar W. Gabriel /Sabine Kropp (Hg.), Die EU-Staaten im Vergleich. Strukturen, Prozesse, Politikinhalte, Wies-baden 2008, S.181-214.
323 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 323
ZfP 57. Jg. 3/2010

In Abbildung 4 ist der Zusammenhang zwischen der Stärke der Parteienkritik und derUnterstützung demokratischer Prinzipien dargestellt. In den alten Bundesländern spie-len parteienkritische Einstellungen keine Rolle für die Zustimmung zu demokratischenWerten. Auf allen Niveaus der Parteienkritik finden diese eine gleich breite Unterstüt-zung. In den neuen Ländern stellt sich dieser Zusammenhang ähnlich dar, allerdings fällthier die Unterstützung demokratischer Werte bei moderat parteienkritischen Bürgerngeringfügig höher aus als bei den besonders kritischen oder unkritischen Befragten.
Bei einem Vergleich des Zusammenhanges zwischen Parteien- und Demokratiekritikbei Bürgern mit einer starken bzw. schwachen/fehlenden Parteiidentifikation bestätigtsich die Annahme, die Parteiidentifikation fördere die Unterstützung der Demokratie.Zunächst zu den alten Bundesländern: Bei den sehr starken Parteienkritikern macht dieParteiidentifikation keinen großen Unterschied für die Unterstützung demokratischerPrinzipien. Im Gegenteil: Die Personen mit einer stark ausgeprägten Parteiidentifikation,die zahlreiche Aspekte der Parteiendemokratie kritisieren, sind sogar geringfügig demo-kratiekritischer eingestellt als die Befragten mit schwachen oder fehlenden Parteibin-dungen (68 gegen 73 % positive Einstellungen zur Demokratie). Im Falle einer sehrschwachen Kritik an den Parteien übt die Parteiidentifikation dagegen einen erkennba-ren, positiven Einfluss auf die Unterstützung demokratischer Prinzipien aus. In dieserGruppe liegt die Demokratieunterstützung der starken Parteiidentifizierer bei 77 Pro-zent, die der Nichtidentifizierer bzw. schwachen Identifizier um 15 Prozentpunkte nied-riger. Die Parteiidentifikation verhindert also nicht die Umsetzung einer starken Partei-enkritik in demokratiekritische Orientierungen. Bei einer schwachen Parteikritik erfülltsie dagegen die Funktion eines Puffers gegen Akzeptanzprobleme der Demokratie.29
In den neuen Ländern fällt der Effekt der Parteiidentifikation auf die Unterstützungder Demokratie schwächer aus. Die Beziehung zwischen Partei- und Demokratiekritikbei Nichtidentifizierern und schwachen Identifizierern stellt sich ähnlich dar wie in derGesamtbevölkerung. Eine starke Parteiidentifikation fördert allerdings die Demokratie-unterstützung der moderaten Parteienkritiker, bei denen sie ohnehin überdurchschnitt-lich ausgeprägt ist.
29 Max Kaase, Legitimitätskrise, aaO. (FN 24), S. 330.
324 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 324

Abbildung 4: Parteienkritik und Unterstützung demokratischer Prinzipien in Deutsch-land, 1998 und 2002.
Quelle: wie Tabelle 1.Anmerkungen:Der Index Parteienkritik umfasst die Summe der in Abbildung 1 enthaltenen parteienkritischenAussagen mit Ausnahme der Einstellung zur Interessenvertretung und zur Problemlösungskom-petenz. Der Übersichtlichkeit halber wurden die Originalwerte von 0 (Zustimmung zu keiner derAussagen) bis 11 (Zustimmung zu allen 11 Aussagen) zu vier Gruppen mit den Werten 0 – 2 (sehrschwach), 3 – 5 (schwach), 6 – 8 (stark) und 9 – 11 (sehr stark) zusammengefasst.Demokratische Prinzipien: Wir haben hier eine Reihe von häufig gehörten Meinungen über diePolitik und die Gesellschaft zusammengestellt. Sagen Sie mir bitte, ob Sie diesen Meinungen zu-stimmen oder nicht. (Der Wert) -2 bedeutet, dass Sie dieser Meinung überhaupt nicht zustimmen,(der Wert) +2 bedeutet, dass Sie ihr voll und ganz zustimmen. Mit den Werten dazwischen könnenSie ihre Meinung abstufen. Summenindex aus den Items: Jeder sollte das Recht haben, für seineMeinung einzutreten, auch wenn die Mehrheit anderer Meinung ist und Eine lebensfähige Demo-kratie ist ohne politische Opposition nicht denkbar, Antworten recodiert auf -1 bis 1.
325 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 325
ZfP 57. Jg. 3/2010

Bei der Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Parteienkritik und Demokratie-zufriedenheit zeigt sich das in repräsentativen Parteiendemokratien zu erwartende Bild:Je kritischer die Menschen in West- und Ostdeutschland den Parteien gegenüberstehen,desto unzufriedener sind sie mit dem Funktionieren der Demokratie. Anders als bei derUnterstützung demokratischer Prinzipien trägt die Parteiidentifikation nichts dazu bei,den Einfluss der Parteikritik auf die Demokratiezufriedenheit abzuschwächen oder zumodifizieren. Das gleiche Muster finden wir bei der Untersuchung der Relevanz derParteienkritik für das Vertrauen zum Deutschen Bundestag, zur Bundesregierung und –in abgeschwächter Form – zum Bundesverfassungsgericht (hier nicht ausgewiesen).
Abbildung 5: Parteienkritik und Demokratiezufriedenheit in Deutschland, 1998und 2002
326 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 326

Quelle: wie Tabelle 1.Anmerkungen:Der Index Parteienkritik umfasst die Summe der in Abbildung 1 enthaltenen parteienkritischenAussagen mit Ausnahme der Einstellung zur Interessenvertretung und zur Problemlösungskom-petenz. Der Übersichtlichkeit halber wurden die Originalwerte von 0 (Zustimmung zu keiner derAussagen) bis 11 (Zustimmung zu allen 11 Aussagen) zu vier Gruppen mit den Werten 0 – 2 (sehrschwach), 3 – 5 (schwach), 6 – 8 (stark) und 9 – 11 (sehr stark) zusammengefasst.Demokratiezufriedenheit: Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie – alles in allem – mit der De-mokratie, so wie sie in Deutschland besteht? Sind Sie sehr zufrieden (1) ziemlich zufrieden, teilszufrieden, teils unzufrieden, ziemlich unzufrieden, sehr unzufrieden (-1).
Fazit und Folgerungen
Eine sich über einen langen Zeitraum erstreckende Dauerkritik an den politischen Par-teien und am Parteienstaat ist für die Einstellungen der Bevölkerung zur Demokratienicht folgenlos geblieben. Insbesondere der an die Parteien gerichtete Vorwurf, sie agier-ten als machtbesessenes, bürgerfernes Kartell der politischen Klasse, beeinträchtigt zwarnicht die Unterstützung demokratischer Prinzipien durch die Bürger, sie hat jedoch dieDemokratiezufriedenheit und das Vertrauen zu den staatlichen Institutionen beeinträch-tigt. Kritik an den Parteien, das ergibt sich eindeutig aus unseren Befunden, trifft dieInstitutionen der parlamentarischen Demokratie, ob dies nun gewollt ist oder nicht.
Mit diesen Feststellungen ist nicht beabsichtigt, den Parteienstaat einer kritischen De-batte zu entziehen. Die politischen Parteien gehören zu den mächtigsten Institutionender parlamentarischen Demokratie und stützen ihre Macht auf vielfältige Ressourcen.Macht impliziert immer die Gefahr von Machtmissbrauch. Doch haben Parteien undParteipolitiker Anspruch auf eine faire Beurteilung ihrer Arbeit. Die wissenschaftlicheParteienkritik muss sich dabei an den Maßstäben theoretischer Stringenz und empiri-scher Gültigkeit messen. Tatsächlich basieren weite Teile der akademischen Parteienkri-tik auf problematischen normativen Vorstellungen und einem Desinteresse an den Er-
327 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 327
ZfP 57. Jg. 3/2010

kenntnissen der empirischen Forschung. Dadurch treten an die Stelle wissenschaftlicherAnalyse antifaktische Fehlurteile und theorielose Spekulation. Vermittelt über die poli-tische Publizistik gelangen diese Vorstellungen in die Öffentlichkeit. Sie scheinen dasdort entstehende Bild der politischen Parteien zwar zu beeinflussen, offenbar aber nichtso stark, wie man es erwarten könnte.
Zusammenfassung
Kritik an den Parteien und am Parteienstaat hat in Deutschland eine lange Tradition undwird auch von Staats- und Politikwissenschaftlern kultiviert. Machtbesessenheit, Bür-gerferne, Eigennutz, Inkompetenz und mangelnde Vertrauenswürdigkeit der Parteienund der Parteipolitiker lauten die seit Jahrzehnten erhobenen Standardvorwürfe an dieParteien. Sie basieren bei vielen Kritikern auf der Forderung nach einer sachrationalen,unideologischen, nicht vom Parteienstreit deformierten Lösung politischer Probleme.Wie im vorliegenden Beitrag gezeigt wird, finden sich von der akademischen und mas-senmedialen Parteienkritik thematisierte Schwächen des Parteienstaates auch in den Ein-stellungen der Bevölkerung. Allerdings beurteilt die Öffentlichkeit die Arbeit der Par-teien differenziert und keineswegs ausschließlich und zunehmend negativ. Während sichparteienkritische Einstellungen stark negativ auf die Demokratiezufriedenheit der Bun-desbürger auswirken, haben sie keine Bedeutung für die Unterstützung wichtiger Ei-genschaften der demokratischen Ordnung.
Summary
Criticism of political parties and the party state is firmly embedded in German politicalthinking on state and politics. Intellectuals and mass media have their share in the pre-vailing blame of political parties as too strongly focused on the strive for power, al beingtoo selfish and too remote from normal citizens, as lacking competence, integrity, andtrustworthiness. Critics prefer a style of policymaking which is regarded as more rationaland oriented towards the common good than party competition. As demonstrated in thiscontribution, most topics of the intellectual critique of political parties can also be foundin the citizens attitudes to political parties. Satisfaction with the way democracy worksin Germany is strongly influenced by negative attitudes towards political parties, butsupport of fundamental principles of a democratic regime has not yet been underminedby anti-party orientations.
Oscar W. Gabriel / Everhard Holtmann, The party state – a permanent public nuisancein democracy. Critical remarks on an ongoing debate.
328 Oscar W. Gabriel/Everhard Holtmann · Der Parteienstaat 328

Frank Decker
Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem
Eine Forschungsnotiz
Der Begriff »Semi-Präsidentialismus« ist noch nicht sehr alt. Vom Journalisten und LeMonde-Gründer Hubert Beuve-Méry 1959 erstmals benutzt, wurde er erst in den sieb-ziger Jahren von Maurice Duverger in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt.Nachdem Duverger das Konzept 1980 in einem englischsprachigen Artikel vorgestellthatte, trat es seinen weltweiten Siegeszug an und ist seither aus der institutionenorien-tierten Regierungssystemanalyse nicht mehr wegzudenken.1
Duvergers These, wonach es sich beim Semi-Präsidentialismus um ein Regierungs-system von eigener Art – sui generis – handele, hat viel Verwirrung gestiftet und einebreite politikwissenschaftliche Diskussion ausgelöst, die bis heute anhält. Die Problemefangen bereits beim Begriff an, der den Eindruck erweckt, dass das semi-präsidentielleSystem ein »Hybrid« oder »Bastard« sei, eine Regierungsform, die sich irgendwo in derMitte zwischen dem parlamentarischen und dem präsidentiellen Systemtypus befinde.2
Wenn dem so wäre, dann könnte man genauso gut von einem »semi-parlamentarischen«Regierungssystem sprechen. Weil dieser Begriff noch problematischere (nämlich anti-demokratische) Assoziationen wecken würde, hat er sich in der Literatur aus gutenGründen nicht durchgesetzt.3 Man sollte es also beim »Semi-Präsidentialismus« belassenund sich – statt über das Wort zu streiten – auf die inhaltliche Bestimmung des so be-zeichneten Regierungssystemtypus konzentrieren.
In Duvergers Artikel aus dem Jahre 1980 wird ein Regierungssystem als »semi-präsi-dentiell« charakterisiert, wenn es folgende drei Elemente aufweist:§ der Präsident wird direkt vom Volk gewählt;§ er besitzt beträchtliche Kompetenzen;§ neben den Präsidenten treten ein Regierungschef (Premierminister) und Minister, die
über Regierungsmacht verfügen und gegen den Willen des Parlaments nicht im Amtbleiben können.4
1 Robert Elgie, »The Politics of Semi-Presidentialism« in: ders. (Hg.), Semi-Presidentialism inEurope, Oxford / New York 1999, S. 1-21.
2 Matthew Søberg Shugart / John M. Carey, Presidents and Assemblies. Constitutional Designand Electoral Dynamics, Cambridge / New York / Oakleigh 1992.
3 Klaus von Beyme, Die parlamentarische Demokratie. Entstehung und Funktionsweise 1789 –1999, 3., völlig neubearbeitete Auflage, Opladen 1999, S. 52.
4 Maurice Duverger, »A New Political System Model: Semi-Presidential Government« in: Eu-ropean Journal of Political Research 8 (1980), S. 165-187.
ZfP 57. Jg. 3/2010

In Winfried Steffanis5 dichotomischer Klassifikation der Regierungsformen gehört derSemi-Präsidentialismus zum Grundtyp des parlamentarischen Systems. Einerseits sindRegierung bzw. Regierungschef auf das Vertrauen der Parlamentsmehrheit angewiesen,von der sie jederzeit aus politischen Gründen abberufen werden können. Andererseitsist das Vorhandensein einer doppelten (zweigeteilten) Exekutive im Semi-Präsidentia-lismus systemlogisch geboten und nicht nur – wie im rein parlamentarischen System –historisch begründet. Letztgenanntes könnte theoretisch genauso gut mit einer geschlos-senen Exekutive auskommen. Für den Semi-Präsidentialismus bleibt es demgegenübercharakteristisch, dass die exekutiven Funktionen nicht nur formal, sondern auch mate-riell von zwei Organen wahrgenommen werden. Um sie vom Westminster-Parlamenta-rismus britischer Provenienz und den »quasi-parlamentarischen« Systemen der meistenanderen europäischen Länder abzugrenzen, hat der deutsche PolitikwissenschaftlerWerner Kaltefleiter6 diese Regierungsform treffend als »System bipolarer Exekutive«apostrophiert. Damit ist er in der angelsächsischen Wissenschaftsgemeinde jedoch aufgenauso wenig Widerhall gestoßen wie Steffani, der von »parlamentarischen Systemenmit Präsidialdominanz« spricht.7 Stattdessen machte das von Duverger in etwa zeitgleichausgearbeitete Konzept des »Semi-Präsidentialismus« Karriere.
Obwohl Duvergers Beschreibung des fraglichen Typus mit jener Steffanis und Kal-tefleiters fast vollständig übereinstimmt, wird sie in der Forschung bis heute als Versuchaufgefasst, die Dichotomie der Parlamentarismus-Präsidentialismus-Typologie zu über-winden. Tatsächlich lässt sich die Mischsystem-These, die Duverger8 selbst geschürt hat,nicht so leicht von der Hand weisen. Mag der Semi-Präsidentialismus von seiner insti-tutionellen Grundstruktur her dem parlamentarischen System entsprechen, so weist erdurch die geteilte Regierungsmacht doch zugleich ein typisches Merkmal des präsiden-tiellen Systems auf. Wie für den Präsidentialismus sind für das semi-präsidentielle Systemzwei Legitimationsstränge kennzeichnend – die Wahl des Parlaments und die Wahl desPräsidenten –, während im (rein) parlamentarischen System die Legitimation der Regie-rung ausschließlich aus der Wahl des Parlaments abgeleitet wird.
Ob durch diese doppelte Legitimation tatsächlich ein Mischsystem begründet wird,ist unter den Anhängern der Semi-Präsidentialismus-Konzeption umstritten. Pointiertformuliert worden ist die Mischsystem-These von Matthew Shugart, der dabei zur Be-gründung auf die Unterscheidung der beiden Regierungszweige abhebt. Während dereine Teil der Exekutive (Regierung und Regierungschef) im Semi-Präsidentialismus nachden Regeln des parlamentarischen Systems bestellt werde und abberufbar sei, folge dieBestellung und Nicht-Abberufbarkeit des anderen Teils (des Präsidenten) der präsiden-
5 Winfried Steffani, »Semi-Präsidentialismus: ein eigenständiger Systemtyp? Zur Unterscheidungvon Legislative und Parlament« in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 26 (1995), S. 621-641.
6 Werner Kaltefleiter, Die Funktionen des Staatsoberhauptes in der parlamentarischen Demokra-tie, Köln / Opladen 1970, S. 129 ff.
7 Steffani, aaO., S. 637 f.8 Duverger, aaO., S. 165.
330 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 330

tiellen Logik. »The key point is that semi-presidential systems mix elements of the twopure types for each portion of a dual executice structure«.9
Bezogen auf das Primärkriterium der Abberufbarkeit (und Bestellung) ist diese Be-gründung zweifellos schlüssig. Bezieht man die sekundären Unterscheidungsmerkmalein die Betrachtung mit ein, zeigt sich allerdings, dass der Semi-Präsidentialismus in sei-nem präsidentiellen Zweig (im Verhältnis von Parlament und Präsident) von der Logikdes Präsidentialismus in wichtigen Punkten abweicht. So verfügt der Präsident in densemi-präsidentiellen Systemen z.B. häufig über das Auflösungsrecht, was im gewalten-trennenden System des Präsidentialismus nur in Ausnahmefällen vorkommt (s.o.).
Die Vertreter der »sui generis«-These knüpfen an dieser Stelle an; sie heben hervor,dass die duale Legitimation im Präsidentialismus und Semi-Präsidentialismus ganz un-terschiedlich zum Ausdruck kommt. Im präsidentiellen System basiere sie auf der for-mellen Unabhängigkeit von Exekutive (Präsident) und Legislative (Kongress), die dieRegierungsmacht zwar gemeinsam ausübten, sich in ihrem Bestand aber wechselseitignichts anhaben könnten. Insofern gibt es im Präsidentialismus (außer dem Volk) keinen»Prinzipal“ « Im semi-präsidentiellen System, wo die Machtteilung innerhalb der Exe-kutive erfolge, befänden sich Regierung und Regierungschef demgegenüber gleich in ei-ner doppelten Abhängigkeitsbeziehung; sie benötigten das Vertrauen des Parlamentesund des Präsidenten, um ihre Befugnisse wahrzunehmen.
Das Vorhandensein eines weiteren Prinzipals grenzt den Semi-Präsidentialismus dem-nach sowohl vom rein parlamentarischen als auch vom präsidentiellen System ab. ImAnschluss an Duverger haben es die meisten Autoren darum für sinnvoll befunden, dieDichotomie der Regierungslehre zu einer Trichonomie zu erweitern und dem semi-prä-sidentiellen System den Status einer eigenständigen Regierungsform zuzuweisen.10 Mit»eigenständig« soll weder eine Mischform gemeint sein (selbst wenn es zutrifft, dass derSemi-Präsidentialismus Elemente der parlamentarischen und präsidentiellen Grundty-pen verbindet) noch ein Regime, das in der Praxis mal einer eher parlamentarischen undmal einer eher präsidentiellen Logik gehorcht.11 Gegen letzteres spricht bereits, dass un-
9 Matthew Søberg Shugart, »Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed AuthorityPatterns« in: French Politics 3 (2005), S. 323-351. (Hervorheb. FD).
10 Z.B. Horst Bahro / Ernst Veser, »Das semipräsidentielle Regierungssystem – Bastard oderRegierungsform sui generis?« in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 26 (1995), S. 471-485 undGianfranco Pasquino, »Semi-Presidentialism: A Political Model at Work« in: European Journalof Political Research 31 (1997), S. 128-137.
11 Die Alternierungsthese wird in der Regel Duverger (aaO., S. 186) zugeschrieben, der sich hieraber nur auf einen kurz zuvor erschienenen Artikel von Georges Vedel bezieht. Vgl. GeorgesVedel »Synthèse ou paranthèse?« in: Le Monde vom 19./20. Februar 1978, S. 2. Auf die Spitzegetrieben hat sie Lijphart, der das Regierungssystem der V. Französischen Politik je nachMehrheitskonstellation mal dem parlamentarischen und mal dem präsidentiellen Typus zu-schlägt. Sartori kritisiert diese doppelte Zuordnung zu Recht, weil sie dem integralen Charakterdes semi-präsidentiellen Systems widerspreche. Er zieht stattdessen den Begriff des »Oszillie-rens« vor, um auszudrücken, dass die Position des wahren Regierungschefs im semi-präsiden-tiellen System zwischen dem Präsidenten und Premierminister wechseln (oszillieren) kann.Vgl. Arend Lijphart, Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Haven / London, 1999, S. 119; Giovanni Sartori, Comparative Constitu-
331 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 331
ZfP 57. Jg. 3/2010

ter den (rein) parlamentarischen und präsidentiellen Regierungsformen ebenfalls zahl-reiche Varianten anzutreffen sind, die sich in ihrer realen Funktionsweise zum Teil deut-lich voneinander unterscheiden. Insoweit ist die Rede von »reinen« Systemen generellmissverständlich und die Hinzufügung eines von den vorhandenen Typen hinreichendunterscheidbaren dritten Typus zumindest nachvollziehbar. Für dessen Gleichwertigkeitmit den vermeintlichen Reintypen könnte außerdem sprechen, dass empirische Grenz-fälle nicht nur zwischen der parlamentarischen und semi-präsidentiellen oder der semi-präsidentiellen und präsidentiellen Regierungsform auftreten, sondern auch zwischender parlamentarischen und präsidentiellen Regierungsform.12
Obwohl das Semi-Präsidentialismus-Konzept in der Forschung breiten Anklang ge-funden hat, konnte sich die »sui generis«-These Duvergers gegenüber Steffanis Ansatzniemals vollständig durchsetzen. Dessen hartnäckiges Festhalten an der klassischen Di-chotomie scheint im Gegenteil inzwischen auch in der angelsächsischen Literatur Früch-te abzuwerfen.13 Nicht nur, dass die disjunktive Klassifikation der Regierungssystemeaus methodischer Sicht eine größere Stringenz verspricht.14 Die Zuordnung des Semi-Präsidentialismus zum Grundtyp des parlamentarischen Systems kann sich auch inhalt-lich auf gewichtige Argumente stützen.
Erstens müssen beide Typen historisch im selben Entstehungszusammenhang gesehenwerden. Ansonsten wäre z.B. kaum zu erklären, warum nach dem Umbruch in Mittel-und Osteuropa keines der dortigen Länder für die präsidentielle Regierungsform optierthat.
Zweitens – und damit zusammenhängend – finden Systemwechsel sehr viel häufigerzwischen dem rein parlamentarischen und semi-präsidentiellen Typus statt als zwischeneinem von diesem und dem Präsidentialismus.15 Verläuft der Wandel vom semi-präsi-dentiellen zum rein parlamentarischen System, bedarf es dazu noch nicht mal einerförmlichen Verfassungsänderung. Dies unterstreicht die konstitutionelle Flexibilität desSemi-Präsidentialismus und belegt dessen Zugehörigkeit zum parlamentarischen Grund-typus.
tional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes, 2. Aufl., Houndmillsu. a. 1997, S. 124 f.
12 Steffen Kailitz, »Parlamentarische, semipräsidentielle und präsidentielle Demokratie – ideal-typische und reale Unterschiede der politischen Strukturen und Prozesse« in: Uwe Backes /Eckhard Jesse (Hg.), Jahrbuch Extremismus & Demokratie (E&D), 18. Jahrgang, Baden-Baden2006, S. 34-56.
13 Vgl. z.B. Alan Siaroff, »Comparative Presidencies. The Inadequacy of the Presidential, Semi-Presidential and Parliamentary Distinction« in: European Journal of Political Research 42(2003), S. 287-312.
14 Vgl. Frank Decker, »Ist die Parlamentarismus-Präsidentialismus-Dichotomie überholt? Zu-gleich eine Replik auf Steffen Kailitz« in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 19 (2009), S. 179 ff.
15 Gianfranco Pasquinos These, wonach sowohl präsidentielle als auch parlamentarische Systemenicht ohne weiteres in semi-präsidentielle Systeme übergehen können, verkennt, dass dieserZusammenhang in umgekehrter Richtung durchaus besteht – allerdings nur im Übergang vonder semi-präsidentiellen zur rein parlamentarischen Regierungsform. Für die Verwandlungeines semi-präsidentiellen in ein präsidentielles System lassen sich dagegen keine empirischenBeispiele finden. Vgl. Pasquino aaO., S. 129.
332 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 332

Drittens stimmen semi-präsidentielle und rein parlamentarische Systeme in ihrergrundlegenden Funktionsweise dahingehend überein, dass am Ende die Parlaments-mehrheit über die Komposition und politische Ausrichtung der Regierung den Aus-schlag gibt.16 Die beiden Legitimationsstränge des semi-präsidentiellen Systems sind in-sofern nicht ganz gleichgewichtig. Auch Steffanis Begriff der »Präsidialdominanz« über-sieht, dass sich diese Dominanz immer nur mit Unterstützung des Parlaments entfaltenkann. Fehlt es daran, verschieben sich die Machtverhältnisse innerhalb der Exekutivezugunsten des parlamentarisch verantwortlichen Premierministers.
Gegen die zuletzt genannte These ließe sich einwenden, dass in einem semi-präsiden-tiellen System dem Präsident durchaus das entscheidende Wort über die Regierung zu-stehen kann. Setzt sich das Staatsoberhaupt bei deren Bestellung und Entlassung über dieParlamentsmehrheit einfach hinweg, wäre ein normales Regieren allerdings kaum mehrmöglich, weil das Parlament dann fürchte müsste, auch in seiner legislativen Funktionausgehebelt zu werden. Von daher ist die Frage berechtigt, ob die »präsidentiell-parla-mentarische« Variante des Semi-Präsidentialismus (in der Terminologie von Shugart /Carey) überhaupt zu den demokratischen Regierungsformen gerechnet werden kann.Lässt man sie in der Typologie außen vor, besteht an der Zugehörigkeit der semi-präsi-dentiellen Systeme zum Grundtyp des Parlamentarismus kein Zweifel.
Damit wendet sich der Blick zu den von Duverger aufgeführten inhaltlichen Merk-malen des Semi-Präsidentialismus. Hier ist nur die im dritten Kriterium benannte par-lamentarische Grundstruktur in der Literatur unangefochten geblieben, während um diebeiden anderen Merkmale – die Volkswahl des Präsidenten und seine Regierungsbefug-nisse – eine anhaltende lebhafte Debatte geführt wird. Was das erste Merkmal – dieVolkswahl – angeht, ist dies schwer verständlich. Gehört es zum Wesen des Semi-Prä-sidentialismus, dass er innerhalb der Regierung eine duale Legitimität begründet, kannder Präsident ja nur durch eine Volkswahl auf dieselbe Stufe gestellt werden wie dasParlament. Dies gilt zumal, wenn das Staatsoberhaupt über Machtbefugnisse verfügt, diejenen der Regierung vergleichbar oder sogar überlegen sind. Der Zusammenhang lässtsich am Beispiel der V. Französischen Republik illustrieren. Hier wurde die Direktwahlauf Drängen de Gaulles 1962 nachträglich eingeführt, um die präsidentialistische Lesartder Verfassung abzusichern, die der General seit 1958 geprägt hatte. Starke Präsidentenohne direktdemokratische Legitimation bleiben theoretisch vorstellbar, kommen in derPraxis aber so gut wie nie vor. Der prominenteste Ausnahmefall ist Finnland, wo einesolche Konstellation bis Anfang der neunziger Jahre vorherrschte.17
Der Zusammenhang besteht allerdings nur in einer Richtung. Wenn starke Befugnisseeine Direktwahl des Präsidenten bedingen, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass direkt
16 Vgl. Steffani, aaO., S. 639.17 Die Direktwahl des Staatspräsidenten ist in Finnland paradoxerweise erst 1991 eingeführt
worden – zu einem Zeitpunkt, als das Land die Bahn des Semi-Präsidentialismus bereits ver-lassen hatte und zur rein parlamentarischen Regierungsweise übergangen war. Der Wechsel inder Verfassungspraxis wurde durch eine förmliche Verfassungsreform im Jahre 2000 nachvoll-zogen. Vgl. Florian Lütticken / Florian Pfeil, »Finnlands neue Verfassung: Abschied vom semi-präsidentiellen System« in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 34 (2003), S. 296-310.
333 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 333
ZfP 57. Jg. 3/2010

gewählte Präsidenten im Regierungsprozess automatisch über eine starke Stellung ver-fügen müssen. Einige sind ihren Rechten bereits von Verfassungs wegen eingeschränkt,während die anderen darauf verzichten, die ihnen eingeräumten Rechte in der Praxiseinzulösen. In einem solchen Fall würde es eigentlich nahe liegen, der faktischen Macht-losigkeit des Amtes durch eine Änderung des Bestellungsmodus Rechnung zu tragen.Dabei handelt es sich jedoch nur um eine theoretische Möglichkeit, da die Abschaffungeiner einmal eingeführten Direktwahl politisch nicht legitimierbar wäre. Deshalb ist sieauch von keinem der semi-präsidentiellen Systeme mit schwachem Präsidenten erwogenworden.
Die Direktwahl bildet folglich ein notwendiges, aber noch kein hinreichendes Krite-rium des Semi-Präsidentialismus. Ihre Bedeutung kann sie nur in Verbindung mit starkenoder – in der Terminologie Duvergers – »beträchtlichen« Kompetenzen entfalten. Wasdarunter zu verstehen ist, wo die starken Kompetenzen beginnen und aufhören, lässt sichnaturgemäß nicht leicht bestimmen. Denn anders als bei der Direktwahl handelt es sichbei den Regierungsbefugnissen des Präsidenten um ein Merkmalskontinuum, das zahl-reiche Abstufungen erlaubt. Die Liste der semi-präsidentiellen Systeme variiert deshalbin der Literatur erheblich – je nachdem, welche Definition von Stärke der jeweilige Autorbenutzt. Aus dieser misslichen Situation lassen sich unterschiedliche Konsequenzen zie-hen. Einige Autoren18 möchten das Kriterium ganz aufgeben und die Zuordnung zumSemi-Präsidentialismus allein an der Direktwahl festmachen. Damit schütten sie jedochletztlich das Kind mit dem Bade aus, da es sich bei den Regierungsbefugnissen des Prä-sidenten zweifellos um ein inhaltlich gehaltvolles Merkmal handelt. Überzeugender er-scheint da der zweite Weg, der eine bessere Systematisierung und empirische Über-setzung der präsidentiellen Kompetenzen anstrebt.19 In der Literatur liegen hierzu meh-rere brauchbare Vorschläge vor.20
Eine sinnvolle Einteilung wird zunächst zwischen nicht-legislativen und legislativenBefugnissen unterscheiden. Erstere beziehen sich auf die Kreation der Regierung, letztereauf das Regieren selbst (als Inhalt und Prozess). Die nicht-legislativen Befugnisse sindrasch aufgezählt. Sie umfassen§ die Ernennung des Regierungschefs und der Minister§ die Entlassung derselben sowie§ die Auflösung des Parlaments, um vorgezogene Neuwahlen herbeizuführen.
18 Vgl. z.B. Elgie, aaO., oder Siaroff, aaO.19 Lee Kendall Metcalf, »Measuring Presidential Power« in: Comparative Political Studies 33
(2000), S. 660-685.20 Vgl. z.B. Shugart / Carey, aaO., Steven D. Roper, »Are All Semipresidential Regimes the Same?
A Comparison of Premier-Presidential Regimes« in: Comparative Politics 34 (2002), S. 253-272oder Markus Soldner, »Semi-präsidentielle Regierungssysteme? Überlegungen zu einem um-strittenen Systemtyp und Bausteine einer typologischen Rekonzeptualisierung« in: KlemensH. Schrenk / ders. (Hg.), Analyse demokratischer Regierungssysteme, Wiesbaden 2010,S. 61-82.
334 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 334

Zu den legislativen Kompetenzen gehören wiederum§ die Zuständigkeiten des Präsidenten in der Außen- und Verteidigungspolitik§ die Notstandsbefugnisse§ das Recht der Gesetzesinitiative§ das Dekretrecht sowie§ das Vetorecht (auch mittelbar: durch Anrufung des Volkes oder des Verfassungsge-
richts).Bei der empirischen Anwendung des Katalogs muss mehrerlei bedacht werden. Erstensbesteht – wie fast bei jeder Typologie – das Problem, dass die Merkmale nicht alle diegleiche Bedeutung besitzen. Hat der Präsident etwa die Möglichkeit, durch ein unbe-schränktes Entlassungsrecht jederzeit eine Regierung nach seinem Geschmack einzuset-zen, so braucht er nicht unbedingt über starke förmliche Gesetzgebungskompetenzenzu verfügen, um den politischen Prozess zu bestimmen. Ein solches System würde aufder Semi-Präsidentialismus-Skala in jedem Falle weit oben rangieren. Für den Forscherheißt das, dass er die Merkmale stets im Gesamtkontext betrachten muss. So kann er z.B.herausfinden, ob zwischen der respektiven Stärke oder Schwäche der legislativen undnicht-legislativen Befugnisse ein Zusammenhang besteht.
Zweitens weisen die Merkmale auch in sich unterschiedliche Ausprägungen auf, dieihre jeweilige Relevanz bestimmen. Das Gewicht des Vetorechts wird vermutlich nichtdasselbe sein, je nachdem, ob das Veto im Parlament mit einer einfachen oder nur miteiner qualifizierten Mehrheit überstimmt werden kann. Gleiches gilt für das Auflö-sungsrecht, das in den meisten Fällen sachlichen oder zeitlichen Beschränkungen unter-liegt, oder die Dekretbefugnisse, die sich auf mehr oder weniger umfangreiche Geset-zesmaterien erstrecken können. Forschungspraktisch würde es sich hier anbieten, diepräsidentiellen Befugnisse je nach Qualität mit unterschiedlichen Indices zu versehenund sie dann zu einer Skala zusammenzufassen.
Drittens stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang die Präsidenten von ihrenKompetenzen tatsächlich Gebrauch machen. Zu den bleibenden Verdiensten von Du-vergers Konzept gehört die Erkenntnis, dass gerade in den semi-präsidentiell genanntenSystemen die Verfassungspraxis von der Verfassungsnorm mitunter stark abweicht. Umdie Gründe dafür zu ermitteln, bleibt die Analyse der verfassungsrechtlichen Ausgangs-lage unabdingbar. Die abschließende Zuordnung muss aber auf der Basis der Regie-rungswirklichkeit erfolgen. Weil sich die Systemeigenschaften auch ohne förmliche Ver-fassungsänderung wandeln können, dürfte diese beim Semi-Präsidentialismus vermut-lich weniger stabil sein als bei den (rein) parlamentarischen oder präsidentiellen Regie-rungsformen.
Auf der Grundlage einer so systematisierten und empirisch handhabbaren Bestim-mung der präsidentiellen Befugnisse lassen sich – in aufsteigender Reihenfolge der Stärke– vier verschiedene Präsidenten-Typen identifizieren:§ Präsidenten, die überwiegend zeremoniell-notarielle Funktionen ausüben (Typ 1)§ Präsidenten, die in den Regierungsprozess korrigierend eingreifen (Typ 2)
335 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 335
ZfP 57. Jg. 3/2010

§ Präsidenten, die die Richtlinien der Regierungspolitik bestimmen (Typ 3) und§ Präsidenten, die Parlament und Regierung vollständig dominieren (Typ 4).Von diesen vier Typen rechtfertigen lediglich Nummer zwei und drei die Zuordnungzum Semi-Präsidentialismus. Präsidenten, die bloße »figureheads« abgeben (Typ 1) unddarin den monarchischen Staatsoberhäuptern ähneln, sind ein Merkmal der rein parla-mentarischen Regierungsform. Systeme, in denen die Regierung allein vom Vertrauendes Präsidenten abhängt (Typ 4), fehlt es wiederum – wie gesehen – an der für den Semi-Präsidentialismus charakteristischen parlamentarischen Grundstruktur. Dieser Typus,der heute exemplarisch von Russland verkörpert wird, firmiert in der Literatur unter dertreffenderen Bezeichnung »hyper- oder superpräsidentiell«.21
Der graduelle Charakter des Stärke-Kriteriums bedingt, dass die Grenzen zwischenden einzelnen Typen fließend sind. So sind z.B. Portugal und Finnland in den achtzigerJahren beide von der semi-präsidentiellen zur rein parlamentarischen Regierungsweiseübergegangen. Während die Präsidenten hier immer mehr darauf verzichteten, die ihnenvon Verfassungs wegen zustehenden Befugnisse auszuüben, fand in Russland umgekehrtein schleichender Systemwechsel hin zum Superpräsidentialismus statt. Dieser wurdefreilich erst in der Ära Putin (ab 2000) endgültig vollzogen, nachdem das Regierungs-system unter Jelzin noch starke semi-präsidentielle Züge aufgewiesen hatte.22 Die Ukrai-ne bewegte sich unterdessen genau in die gegenteilige Richtung. Die »orangene« Revo-lution führte sie in den Kreis der semi-präsidentiellen Systeme zurück, ließ die Zugehö-rigkeit zu Typ 2 oder 3 aber zunächst ungeklärt.
Auch bei den konsolidierten semi-präsidentiellen Demokratien bereitet die Abgren-zung zwischen beiden Typen Probleme. In den mittel- und osteuropäischen Ländern,die nach dem Umbruch semi-präsidentielle Systeme eingeführt und diese beibehaltenhaben, begnügen sich die Präsidenten in der Regel mit einer Korrektivrolle, was gele-gentliche Ausbruchsversuche (wie in Polen oder Moldova) nicht ausgeschlossen hat. Inder V. Französischen Republik – dem Prototyp des Systems mit starkem Präsidenten –wurde an dem von de Gaulle durchgesetzten Führungsanspruch des Staatschefs inner-halb der Exekutive dagegen bis heute nicht gerüttelt. Die Verwirklichung dieses An-spruchs setzt aber auch hier voraus, dass der Präsident von einer parlamentarischenMehrheit unterstützt wird. Muss er mit einem Premierminister aus dem anderen politi-schen Lager zusammenarbeiten, verbleiben ihm nur die in der Verfassung verankertenPrärogativen, wechselt das System also von Typ 3 zu Typ 2.
21 Z.B. Stephen Holmes, »The Postcommunist Presidency« in: East European Constitutional Re-view 2 (1993) / 3 (1994), S. 36-39.
22 Seither kann Russland in eine Typologie demokratischer Regierungssysteme nicht mehr sinn-voll einbezogen werden. Auch wenn die semi-präsidentielle Verfassung formal fortbesteht undmit Putins Wechsel in das Amt des Premierministers die Frage nach der Machtverteilung in-nerhalb der Exekutive eine neue Aktualität erhalten hat, bleibt doch das Problem, dass derzweite – parlamentarische – Legitimationsstrang, der ein zentrales Merkmal nicht nur der prä-sidentiellen, sondern auch der semi-präsidentiellen Regierungssysteme markiert, in der Russ-ländischen Föderation praktisch verkümmert ist.
336 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 336

Sucht man nach Gründen für die Diskrepanz von Verfassungsnorm und -praxis unddie unterschiedlichen Regierungswirklichkeiten des Semi-Präsidentialismus, so sind zu-vörderst die Strukturen des Parteiensystems zu nennen. Je stärker die Parteien in derGesellschaft verankert sind und deren Konfliktlinien abbilden, um so geringer dürftendie Schwankungen des Wählerverhaltens ausfallen, die den Fragmentierungsgrad desParteiensystems bestimmen. Damit wächst die Chance, dass eine stabile Mehrheitsre-gierung hervorgebracht werden kann. Unterstützen lässt sich die Stabilisierung durch einmehrheitsbildendes Wahlrecht. Dessen Einführung setzt freilich voraus, dass es zumCharakter des Parteiensystems passt, was insbesondere in Gesellschaften mit sozial-strukturellen Minderheiten ein Problem darstellt. Für den Gleichklang von parlamenta-rischer und präsidentieller Mehrheit ist neben dem Wahlmodus auch der Zeitpunkt derWahlen beachtlich. Finden die Präsidentschaft- und Parlamentswahlen am selben Tagstatt oder kann ein gewählter Präsident über eine vorzeitige Parlamentsauflösung zeit-nahe Neuwahlen herbeiführen, ist die Wahrscheinlichkeit gleichgerichteter Mehrheitengrößer als bei zeitlich versetzten Wahlen. Maßgebliche Bedeutung für die Regierungs-praxis gewinnt schließlich die parteipolitische Herkunft des Präsidenten selbst und seineStellung innerhalb des Parteiensystems. Präsidenten, die zugleich die Führer der stärks-ten Partei sind und sich so als Vertreter einer bestimmten politischen Richtung exponie-ren, finden im Parlament voraussichtlich größeren Rückhalt als parteipolitische »Au-ßenseiter«. Deshalb sind sie eher in der Lage, den Regierungsprozess mitzuprägen undim Verhältnis zum parlamentarisch verantwortlichen Premierminister die Oberhand zubehalten.23
Die Schlüsselbedeutung des Parteiensystems lässt sich am Schicksal des Weimarer Re-gierungssystems illustrieren, dessen vergleichsweise geringe Beachtung in der kompara-tistischen Forschung zum Semi-Präsidentialismus in doppelter Hinsicht überrascht.24
Einerseits handelt es sich bei der Weimarer Reichsverfassung um den Prototyp der semi-präsidentiellen Regierungsform, der später auch anderen Ländern in ihren Verfassungs-gebungsprozessen als Vorbild diente. Andererseits sind die Elemente und Konstrukti-onsfehler der Weimarer Republik namentlich von der deutschen Geschichts- und Poli-tikwissenschaft so eingehend untersucht worden, dass es an Erkenntnissen über diesenFall nicht mangelt.
Mit der Schaffung einer dualistischen Exekutive wollten die Schöpfer der WeimarerVerfassung um Hugo Preuß den fortwirkenden Traditionen des monarchischen Obrig-keitsstaates nach 1918 gerecht werden. Das Regierungssystem wurde durch die Herstel-lung der parlamentarischen Verantwortlichkeit des Reichskanzlers demokratisiert, wäh-rend der Reichspräsident als »Ersatzkaiser« nicht nur eine symbolische Integrations-funktion wahrnehmen, sondern auch die Bedeutung einer starken Exekutive unterstrei-chen sollte. Welchen Anteil der Dualismus am Scheitern der Weimarer Republik hatte,
23 Cindy Skach, Borrowing Constitutional Design. Constitutional Law in Weimar Germany andthe French Fifth Republic, Princeton / Oxford 2005.
24 Vgl. z.B. Elgie, aaO.
337 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 337
ZfP 57. Jg. 3/2010

wird in der Literatur unterschiedlich eingeschätzt. Autoren, die wie Duverger25 oderSartori26 die in der politischen Kultur angelegte Schwäche des Parteiwesens als Haupt-grund dieses Scheiterns betrachten, haben die Vermutung geäußert, dass der WeimarerStaat ohne die kompensatorische Funktion eines starken Präsidenten bereits sehr vielfrüher zugrunde gegangen wäre. Die damit postulierte generelle Vorzugswürdigkeit desSemi-Präsidentialismus bei der Herstellung oder Konsolidierung demokratischer Herr-schaftsstrukturen hat nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme dieAuseinandersetzung um die richtige Regierungsform in den mittel- und osteuropäischenTransformationsstaaten maßgeblich mitbestimmt. Ähnliche Argumentationsmuster fin-den sich in der Debatte um den lateinamerikanischen Präsidentialismus.
Andere Autoren sehen demgegenüber im Semi-Präsidentialismus selbst eine Ursacheder beklagten Parteienschwäche. Stehe hinter dem Regierungschef ein starker, mit exe-kutiven Befugnissen ausgestatteter Präsident in Reserve, so vermindere sich der Druck,für die Bildung einer stabilen parlamentarischen Mehrheit zu sorgen. Die Weimarer Re-gierungswirklichkeit liefert für diese These eindrucksvolle Belege. Nicht nur, dass mehrals die Hälfte der Regierungen zwischen 1919 und 1933 Minderheitskabinette waren.Auch die Mehrheitsregierungen zeichneten sich durch notorische Undiszipliniertheit dersie tragenden Fraktionen und Parteien aus, die den Erfordernissen einer parlamentari-schen Regierungsweise widersprach.27 Die Reichspräsidenten – Ebert und (ab 1925)Hindenburg – nutzten das Vakuum zur Steigerung ihres eigenen Einflusses, indem sieüber die ihnen laut Verfassung ausdrücklich zustehenden Rechte bei der Regierungsbil-dung hinaus auch auf den Kurs der Regierungspolitik einwirkten. Als wichtigstes Druck-mittel diente ihnen dabei die Befugnis, den Reichstag aufzulösen (Art. 25 WRV), die ihreBedeutung wiederum erst in Verbindung mit dem sogenannten Notverordnungsartikel48 entfaltete. Dieser gab dem Staatsoberhaupt die Möglichkeit, bei Gefährdungen deröffentlichen Sicherheit und Ordnung die »nötigen Maßnahmen« zu treffen, was die Au-ßerkraftsetzung von Grundrechten ebenso einschloss wie den Einsatz der bewaffnetenGewalt. Die Notverordnungen konnten von einer Mehrheit des Reichstages jederzeitaußer Kraft gesetzt werden. Da es stabile parlamentarische Mehrheiten jedoch nicht gab,wurden sie zum bevorzugten Regierungsinstrument der Minderheitskabinette. DiesePraxis gelangte bereits unter Ebert zur Blüte, der von Art. 48 zwischen 1919 und 1924nicht weniger als 130 Mal Gebrauch machte.28
Im übrigen unterschieden sich die beiden Präsidenten in ihrer Amtsführung gewal-tig.29 Während Ebert von der Notwendigkeit einer parlamentarisch getragenen Mehr-heitsregierung im Prinzip überzeugt war und er seinen eigenen Einfluss in dieser Rich-tung verwendete, blieb dem im Kaiserreich mental verwurzelten Feldmarschall das We-
25 Vgl. Duverger, aaO., S. 173.26 Vgl. Sartori, aaO., S. 128 f.27 Peter Haungs, Reichspräsident und parlamentarische Kabinettsregierung. Eine Studie zum Re-
gierungssystem der Weimarer Republik in den Jahren 1919 bis 1924, Köln / Opladen 1968,S. 280 ff.
28 Vgl. Skach, aaO., S. 50 f.29 Vgl. Kaltefleiter, aaO., S. 153 ff.
338 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 338

sen der Parteiregierung zeitlebens fremd. Aufgrund seiner parteipolitischen Herkunftund anerkannten Stellung innerhalb der Sozialdemokratie konnte Ebert die SPD auchals Präsident »führen«. Erst als sie gegen den Willen Eberts das Kabinett StresemannEnde 1923 stürzte und in die Opposition wechselte, entfremdete sich die Partei von ihremPräsidenten, dem es aber auch in der Folgezeit gelang, auf die SPD mäßigend einzuwir-ken. Hindenburg fehlte es dagegen an einer vergleichbaren politischen Verwurzelung,sodass er nicht in der Lage war, auf den Kurs der ihm nahestehenden Parteien, insbe-sondere der Deutschnationalen, bestimmenden Einfluss zu nehmen. Nach dem von ihmmitverschuldeten Zusammenbruch der letzten parlamentarisch getragenen Regierungunter Hermann Müller (SPD) zog sich das greise Staatsoberhaupt deshalb zunehmendauf seine Prärogativen zurück. Hindenburg gestattete dem neuen Kanzler Heinrich Brü-ning (Zentrum) nicht nur den Einsatz des Notverordnungsartikels 48, sondern hinter-trieb auch dessen Versuche, durch die Berufung zweier Sozialdemokraten die parlamen-tarische Basis der Rechtskoalition zu verbreitern. Das fehlende Verfassungsverständnisdes Präsidenten offenbarte sich in der personellen Zusammensetzung der von ihm be-stellten Regierungen, in denen die Parteienvertreter von »neutralen« Fachmännern im-mer mehr verdrängt wurden. Die Fachkabinette, die ab 1930 regierten, bildeten die un-mittelbare Vorstufe zur Diktatur. Sie mündeten in einer Reihe fataler Fehlentscheidun-gen des Reichspräsidenten, die in der Ernennung Hitlers zum Kanzler am 30. Januar 1933kulminierten.
Die Analyse des Weimarer Falls unterstreicht die Bedeutung der von den Strukturendes Parteiensystems geprägten Macht- und Mehrheitsverhältnisse für die Funktionsfä-higkeit des Regierungsmodells. Diese Bedeutung ist im semi-präsidentiellen System eherhöher zu veranschlagen als im reinen Parlamentarismus oder Präsidentialismus, was dieAnfälligkeit dieser Regierungsform besonders hoch macht. Um die tatsächliche Funkti-onsweise zu verstehen, bietet es sich mit Cindy Skach30 an, unterhalb der Verfassungs-norm drei Varianten der semi-präsidentiellen Regierungspraxis zu unterscheiden:§ die gleichgerichtete Mehrheitsregierung. Bei ihr entstammen Präsident und Regie-
rungschef dem gleichen politischen Lager bzw. der gleichen Partei und verfügen übereine Mehrheit im Parlament.
§ die geteilte Mehrheitsregierung. Hier verfügt nur der Regierungschef über die Mehr-heit im Parlament, der Präsident entstammt dem gegnerischen politischen Lager. Fürdiese Konstellation hat sich der aus der französischen Politik übernommene Begriffder »cohabitation« eingebürgert.
§ die geteilte Minderheitsregierung. Hier verfügen weder der Präsident noch der Re-gierungschef über eine Mehrheit im Parlament.
Am unproblematischsten erscheint die Funktionsweise des Semi-Präsidentialismus beigleichgerichteten Mehrheitsverhältnissen. Dies gilt für die Systeme vom Typ 2 und Typ3 gleichermaßen. In den erstgenannten braucht der Präsident die ihm von Verfassungswegen zustehenden Vetobefugnisse nicht einzusetzen, kann er doch darauf vertrauen,dass die von der Regierung verfolgte Politik in seinem Sinne ist. Dies verschafft dem
30 Vgl. Skach, aaO., S. 15 ff.
339 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 339
ZfP 57. Jg. 3/2010

Premierminister im Regierungsprozess automatisch ein Übergewicht. In den Systemenvom Typ 3 hat der Staatschef wiederum die Möglichkeit, als »Führer« der Mehrheits-partei bzw. des Mehrheitslagers die Funktion des chief executive auch gegenüber demnominellen Regierungschef auszuspielen, sodass der Dualismus in der Exekutive in derPraxis nicht zum Tragen kommt bzw. in der Dominanz des Staatschefs aufgelöst wird.Ein Vorteil dieser Konstellation könnte darin liegen, dass der Präsident trotz seiner de-mokratischen Legitimation für die Regierungspolitik nicht unmittelbar haftet.31 Er kannsich also hinter seinem Premierminister verstecken und diesem bei etwaigen Fehlern oderVersäumnissen die Schuld in die Schuhe schieben. In einem solchen Fall würde die Re-gierung freilich Gefahr laufen, ihre parlamentarische Mehrheit zu verlieren, womit derpräsidentiellen Dominanz der Boden entzogen wäre.
Muss sich der Staatschef die Macht mit einem Premierminister aus dem anderen Lagerteilen, wird der Dualismus des semi-präsidentiellen Systems auch in der Verfassungs-praxis manifest. Wie konfliktanfällig das Regieren unter den Bedingungen der cohabita-tion ist, dürfte in erster Linie von der Amtsführung des Präsidenten abhängen. Nimmtdieser seine Prärogativen offensiv wahr oder betrachtet er sich gar als Speerspitze derOpposition gegen die Regierung, sind Auseinandersetzungen vorprogrammiert. Umge-kehrt setzt eine funktionierende cohabitation voraus, dass der Regierungschef die vonder Verfassung geschützten Domänen des Präsidenten angemessen respektiert.
Die weitaus schwierigste Konstellation ist die einer geteilten Minderheitsregierung.Skach32 weist darauf hin, dass sich hier die Grundübel der parlamentarischen und präsi-dentiellen Regierungsformen miteinander verbinden: die Unfähigkeit, eine stabile Mehr-heitskoalition zu bilden und das Auseinanderfallen der parteipolitischen Mehrheitenzwischen Parlament und Regierung (divided government). Da dem Staatsoberhaupt imSemi-Präsidentialismus weitreichende exekutive Befugnisse zugebilligt werden, kanndieser den daraus erwachsenden Funktionsproblemen zumindest potenziell besser Herrwerden als ein rein parlamentarisches oder präsidentielles System. Wie der Weimarer Falllehrt, steckt aber gerade darin ein Problem. Das Vertrauen und der tatsächliche Rückgriffauf die präsidentielle Reservemacht vermindern den Anreiz, über eine entsprechendeStrukturierung des Parteiensystems dauerhaft stabile Regierungsmehrheiten zu erzeu-gen. Sie tragen also selbst zur Entstehung der Verhältnisse mit bei, die ihren anschlie-ßenden Gebrauch legitimieren sollen.
Diese Ambivalenz unter Demokratiegesichtspunkten macht den Semi-Präsidentialis-mus zu einer äußerst anspruchsvollen Regierungsform.33 Von daher ist es nicht verwun-derlich, dass er in der Literatur kritischer beäugt wird als die rein parlamentarischen oderpräsidentiellen Systeme. Ein Blick auf die mittel- und osteuropäischen Länder, die sichnach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime für semi-präsidentielle Ver-
31 Ezra N. Suleiman, »Presidential Government in France« in: Richard Rose / ders. (Hg.), Pre-sidents and Prime Ministers, Washington D.C. 1980, S. 94-138.
32 Vgl. Skach, aaO., S. 7.33 Robert Elgie, »Semi-Presidentialism, Cohabitation and the Collapse of Electoral Democracies,
1990-2008« in: Government and Opposition 45 (2010), S. 29-49.
340 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 340

fassungen entschieden haben, scheint dem Recht zu geben.34 Der Dualismus innerhalbder Exekutive hat hier immer wieder Konflikte hervorgerufen und zum Teil regelrechteSystemkrisen provoziert (z.B. in der Ukraine). Dass sich die Kritik keineswegs nur aufdie Erfahrungen aus den Transformationsstaaten zu stützen vermag, belegt wiederumdas französische Beispiel, wo der Semi-Präsidentialismus – aller demokratischen Stabi-lität zum Trotz – umstritten bleibt und die Rufe nach einer neuen, VI. Republik nichtverstummen wollen. Die Zweifel hielten die Verfassungsgeber in Mittel- und Osteuropaallerdings nicht davon ab, bei der Ausgestaltung ihrer Regierungssysteme dem franzö-sischen Vorbild nachzueifern.35 Auch in anderen Weltregionen hat der Semi-Präsiden-tialismus zunehmend Verbreitung gefunden, was seine ungebrochene Attraktivität alsRegierungsmodell beweist.36 Offenbar sehen viele Länder in ihm nach wie vor die besteMöglichkeit, die Bedürfnisse der Demokratie und Systemstabilität miteinander in Ein-klang zu bringen.
Zusammenfassung
In der vergleichenden Politikwissenschaft gibt es eine anhaltende Kontroverse über denStatus des semi-präsidentiellen Regierungssystemtypus. Obwohl die meisten Autorendas semi-präsidentielle System heute im Anschluss an dessen »Erfinder« Maurice Du-verger als Regierungsform »sui generis« betrachten, sprechen mehr Argumente für dievon Winfried Steffani postulierte Zuordnung zum parlamentarischen Grundtypus. Un-abhängig davon ist die empirische Inflationierung der semi-präsidentiellen Systeme kri-tikbedürftig, wenn diese an zu weichen Stärke-Indikatoren festgemacht werden (etwader bloßen Direktwahl des Präsidenten). Die potenzielle Rivalität zwischen Staatschefund parlamentarisch verantwortlichem Premierminister macht den Semi-Präsidentialis-mus zu einer demokratiepolitisch äußerst anspruchsvollen Regierungsform, deren At-traktivität jedoch weiterhin ungebrochen ist.
Summary
The validity of the semi-presidential system of government as an analytical categorycontinues to be contested in comparative political science. Most authors today view the
34 Ein spielerischer, gleichwohl aussagekräftiger Indikator für den Systemtypus ist die Vertretungdes Landes im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs. Diese blieb in dem EU-Mitgliedsland mit der am stärksten ausgeprägten semi-präsidentiellen Struktur – Frankreich –bis zuletzt dem Staatspräsidenten vorbehalten, während Finnland, Litauen, Polen und Rumä-nien sowohl vom Präsidenten als auch vom Regierungschef vertreten wurden. Zumindest imFalle Finnlands dürfte dies überraschen, nachdem dessen Regierungsform in der Literatur heuteüberwiegend als parlamentarisch charakterisiert wird.
35 Sylvia von Steinsdorff, »Die Verfassungsgenese der Zweiten Russischen und der Fünften Fran-zösischen Republik im Vergleich« in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 26 (1995), S. 486-504.
36 Robert Elgie / Sophia Moestrup (Hg.), Semi-Presidentialism Outside Europe. A ComparativeStudy, London 2007.
341 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 341
ZfP 57. Jg. 3/2010

semi-presidential system as »sui generis« in accordance with Maurice Duverger,the »inventor« of the term. Nonetheless, there are a number of reasons to support Win-fried Steffani’s approach of categorizing this system as falling within the parliamentarytype of government. Regardless of which approach is more convincing, the inflationarycategorization of political systems as semi-presidential warrants criticism, particularlywhen qualification as such is made dependent on overly »soft« criteria (such as solelyhaving a directly elected president). For it is precisely the potential rivalry between thehead of state and the prime minister held responsible by parliament that makes semi-presidentialism an utterly demanding form of democratic government – and yet, a formof government whose attractiveness has failed to cease.
Frank Decker, Semi-Presidentialism as a »pseudo«-mixed type of government. A re-search note
342 Frank Decker · Der Semi-Präsidentialismus als »unechtes« Mischsystem 342
Bitte bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei unter www.nomos-shop.de
Friedens- und KonfliktforschungErzwungene DemokratiePolitische Neuordnung nach militärischer Intervention unter externer AufsichtVon Sonja Grimm2010, 420 S., brosch., 69,– €, ISBN 978-3-8329-5028-6(Studien der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Bd. 6)
Nach humanitären und demokratischen Interven-tionen induzieren externe Akteure Rechtsstaat und Demokratie in Gesellschaften, die von Gewalt zerrissen sind. Jedoch: Lässt sich Demokratie erzwingen? Der Band untersucht erstmals syste-matisch die Legalität, Legitimität und Effektivität der externen Demokratisierung von 1945 bis heute und zeigt die damit verbundenen Dilem-mata auf.
Nomos
Erzwungene Demokratie
Sonja Grimm
Studien der Hessischen Stiftung | 6Friedens- und Konfliktforschung
Politische Neuordnung nach militärischer Intervention unter externer Aufsicht

Felix Dirsch
60 Jahre Bundesrepublik – ein Staat in guter Verfassung?
Eine Literaturauswahl in der Rückschau auf die Jubiläumsjahre 2008und 2009
Hans-Ulrich WEHLER, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, fünfter Band: Bundesrepublik und DDR1949-1990, München 2008, 529 Seiten, 34,90 EUR.
Eckhart CONZE, Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1949bis in die Gegenwart, Berlin 2009, 1071 Seiten, 39,95 EUR.
Axel SCHILDT / Detlev SIEGFRIED, Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik – 1945 bis zurGegenwart (Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung), Bonn 2009, 696 Seiten (Ori-ginalausgabe Hanser, 24,90 EUR).
Hans-Peter SCHWARZ (Hg.), Die Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz nach 60 Jahren, Köln/Weimar/Wien 2008, 698 Seiten, 39,90 EUR.
Christian BOMMARIUS, Das Grundgesetz. Eine Biographie, Berlin 2009, 287 Seiten, 19,90 EUR.
Jörn IPSEN, Der Staat der Mitte. Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, München 2009,476 Seiten, 29 EUR.
Marion DETJEN/Stephan DETJEN/Maximilian STEINBEIS, Die Deutschen und das Grundgesetz.Geschichte und Grenzen unserer Verfassung, München 2009, 400 Seiten, 16,95 EUR.
Die Jahre 2008 und 2009 bedeuten Meilensteine bezüglich der bundesrepublikanischenMemorialisierungskultur. 2008 wurde in einer Fülle von Publikationen, TV-Reihen,Talkshows, wissenschaftlichen Tagungen etc. der rund 40 Jahre vorher erfolgten »Um-gründung der Republik« (Manfred Görtemaker) gedacht. 2009 war Anlass für drei wich-tige Gedenktage: Das Grundgesetz und die Bundesrepublik Deutschland feierten ihren60. Geburtstag, zudem erinnerte man in vielfältigen Feierlichkeiten an den 20. Jahrestagdes Mauerfalls. Heuer sind es nunmehr 20 Jahre, dass die Einheit Deutschlands in Freiheitvollendet wurde. Im Rückblick auf dieses Großereignis werden wiederum die Sektkor-ken knallen. Die – später so genannte – Berliner Republik nahm langsam Gestalt an.
Dass solche Jubiläen von einer umfangreichen Detailliteratur begleitet werden, bedarfkaum eines Hinweises. In der folgenden Auswahl werden Publikationen berücksichtigt,die sich mit dem Grundgesetz oder der Gesamtgeschichte der Bundesrepublik beschäf-tigen. Die neuere Spezialforschung zum Umbruch von 1989 und 1990 muss hingegen(aus räumlichen Gründen) in einer eigenen Besprechung untersucht werden.1
1 Exemplarisch seien genannt: Andreas Rödder, Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte derWiedervereinigung, 2., durchgesehene Auflage, München 2009; Ilko-Sascha Kowalczuk, End-spiel. Die Revolution von 1989 in der DDR, 2., durchgesehene Auflage, München 2009.
ZfP 57. Jg. 3/2010

Da in den letzten Jahren bereits einige Gesamtdarstellungen zur Geschichte der Bun-desrepublik erschienen,2 verwundert es nicht, dass das Jubiläum 2009 nur wenige solcherAbhandlungen hervorbrachte: Auf Hans Ulrich Wehlers viel diskutierte »Deutsche Ge-sellschaftsgeschichte 1949-1990«, die bereits im Herbst 2008 veröffentlicht wurde, folgteder Überblick von Eckhart Conze. Wehlers Buch schließt seine fünfbändige Gesell-schaftsgeschichte ab, die gewiss einen Meilenstein deutscher Geschichtsschreibung dar-stellt. Der Band orientiert sich, wie seine Vorgänger, an den Kategorien Wirtschaft,Herrschaft, Kultur sowie – diese überlappend – Soziale Ungleichheit. Manche Schluss-folgerungen aus diesen an Max Weber und Karl Marx angelehnten, struktur- und pro-zesstheoretischen Schemata, die bereits am Beispiel früherer Epochen erprobt wurden,lassen sich für die Zeit nach 1945 nur sehr bedingt anwenden. Denn: Der deutsche »Son-derweg«, wenn es ihn denn je gab, endete spätestens 1945. Überdies ist Webers Konzeptder »charismatischen Herrschaft« für die meisten Regierungschefs nach der Katastrophedes Dritten Reiches unbrauchbar, sieht man vielleicht von Willy Brandt einmal ab.
Am Ende der eindrucksvollen sozialgeschichtlichen Synopse, deren erster Band an derWende zum 18. Jahrhundert beginnt, arbeitet Wehler in sechs umfangreichen Kapitelndie Unterschiede zwischen dem west- und dem ostdeutschen Staat heraus. Dass die DDRüberall den Kürzeren zieht, entspricht sowohl dem Stand der Forschung als auch demcommon sense weiter Bevölkerungskreise, was selbst für den überwiegenden Teil derBewohner des früheren SED-Staates gelten dürfte. Das totale Misslingen des sozialisti-schen Projektes kann gewiss nicht getrennt werden von seinen deutlich schlechterenAusgangsbedingungen im Vergleich zum westdeutschen Pendant, das weniger Repara-tionsleistungen erbringen musste und wesentlich größere Unterstützung seitens der ehe-maligen Kriegsgegner erhielt. Immerhin konnten sozialistische Gegner des »kapitalisti-schen« Deutschlands von Anfang an darauf hinweisen, dass es der DDR weitgehendgelang, die Einkommensunterschiede zu nivellieren, wenn man die Privilegien der No-menklatura einmal ausklammert. Auch der DDR-Kritiker Wehler, einst linker Gefolgs-mann Jürgen Habermas‘ bei dessen polemischen Einlassungen im Historikerstreit,kommt nicht darum herum, eine »Sozialhierarchie der Bundesrepublik« zu konstatieren.Der Bielefelder Emeritus schreckt nicht vor mutigen Urteilen zurück: In spärlicher Aus-wahl sei sein deutliches Aufzeigen von Problemen erwähnt, die aus einer jahrzehntelan-gen, ungezügelten Einwanderung resultieren, seine Kritik an demographischen Verän-derungen, insbesondere dem Geburtenrückgang und der Problematisierung der Situati-on vieler Alleinerziehenden, seine Auseinandersetzung mit etlichen Forderungen der68er-Bewegung, deren – oft wider Willen – kapitalistisch-individualistische Konsum-orientierung er geißelt, seine Ablehnung der Absenkung von Leistungsstandards inSchulen und an Universitäten und seine Einwände gegen den oftmals exzessiven Ausbaudes Sozialstaates. So wird die Erfolgsgeschichte Bundesrepublik ein wenig zurecht ge-
2 In der wissenschaftlichen Debatte der letzten Jahre nahmen zwei Darstellungen einen besonde-ren Stellenwert ein: Manfred Görtemaker, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von derGründung bis zur Gegenwart, zuerst München 1999; Edgar Wolfrum, Die geglückte Demokra-tie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Mün-chen 2007.
344 Felix Dirsch · 60 Jahre Bundesrepublik – ein Staat in guter Verfassung? 344

rückt. Plausibel begründet der Meister der bundesdeutschen Sozialhistorie, warum dieZäsur von 1990 den Endpunkt seines Mammutwerkes darstellt.
Obwohl die Fachwelt sicherlich mit Recht darauf verwies, dass die fünf Bände desWehler’schen Großprojektes unterschiedlich zu bewerten sind, kommen weder Freundenoch Feinde an der »Meisterleistung deutscher Geschichtsschreibung« (Richard Evans)vorbei. Das gilt auch für den letzten Teil.
Anders als bei Wehler steht bei Conze nicht die Analyse sozialgeschichtlicher Struk-turen im Vordergrund, sondern die Erzählung der Ereignisgeschichte, die in eine um-fassende Deutung eingebettet wird. Auf über 1000 eng bedruckten Seiten (einschließlichFußnoten und verzeichneter Literatur) werden folgende Abschnitte präsentiert: Endeund Anfang (1945-1949); Gründerjahre der Republik (1949-1957); Ende der Nach-kriegszeit (1957-1966); Reformzeit (1966-1974); Krisenjahre (1974-1982); Abschied vomProvisorium (1982-1989); Wiedervereinigung (1989/90); Auf dem Weg in die BerlinerRepublik (1990-2001); An der Schwelle zur Gegenwart.
Der Heidelberger Historiker verbleibt überall im verbindlichen Radius der Forschung– egal, ob er die Gründerjahre der Republik oder die Kontroversen der unmittelbarenGegenwart präsentiert. Nehmen wir als Beispiel aus der Fülle der abgehandelten Themenlediglich die seit Jahren heftig umstrittenen Umbrüche am Ende der 1960er-Jahre. Conzebewertet diese Dekade als Zeit einer grundlegenden Liberalisierung und Verwestlichung,was heute opinio communis der Fachwelt ist. Davon unterscheidet er (ungeachtet allerVerbindungslinien) die Vielfalt dessen, was unter dem mythischen Datum »1968« ver-standen wird. Letzteres ist nicht ohne die Wandlungsprozesse, die sich bereits um 1960herum abzeichneten, denkbar. Dennoch ist das Gesicht der Studentenrevolte janusköp-fig, was eine derartige Differenzierung als sinnvoll erscheinen lässt. Schließlich war einTeil der (fast ausschließlich amerikakritischen) Rebellierenden mit den Konterfeis kom-munistischer Führerfiguren alles andere als liberal oder westlich. Durch diese weite Sichtvon »1968« – die eruptiven Ereignisse werden lediglich als Facette der »dynamischenZeiten« (Axel Schildt), der »roaring sixties«, gesehen – kann der Verfasser die Auf-bruchsbewegung zur »Haben-Seite« der Republik zählen – das aber zum Preis einer bloß»halbierten« Darstellung, die manche der Folgewirkungen ausblendet, so die immerwieder diskutierten, etwaigen Zusammenhänge zwischen Studentenbewegung und RAF,die zu den Schattenseiten der deutschen Linken gezählt werden.
Conze meistert jedoch nicht nur die Klippen der ereignisgeschichtlichen Darstellungsouverän; darüber hinaus legt er eine plausible Interpretation der Entwicklung der Bun-desrepublik vor. Das (stets im Wandel begriffene) Bedürfnis nach Sicherheit dient ihmals roter Faden, den er von den Gründerjahren bis heute verfolgt. Seinerzeit suchtenbreite Bevölkerungskreise des jungen Gemeinwesens die Verbesserung ihrer oft küm-merlichen materiellen Lebensverhältnisse; des Weiteren erhofften viele Menschen Schutzvor neuerlichen kriegerischen Auseinandersetzungen. Dem kam die Regierung Adenauerdurch die Integration Westdeutschlands in internationale Organisationen ebenso wiedurch die Weichenstellung in Richtung »soziale Marktwirtschaft« entgegen. Das Ver-trauen, das die Politik der 1950er-Jahre weithin gewinnen konnte, sollte nicht durch»Experimente« gefährdet werden. Nach nunmehr sechs Jahrzehnten sieht die Prioritä-
345 Felix Dirsch · 60 Jahre Bundesrepublik – ein Staat in guter Verfassung? 345
ZfP 57. Jg. 3/2010

tenliste anders aus: Von den führenden Politikern wird weithin erwartet, dass sie dieGefahren des globalen Terrors zumindest eindämmen und die ökonomischen Risikeninfolge der weltweiten Umbrüche so weit wie möglich abfedern. Der Erhalt der Ar-beitsplätze rangiert in Umfragen weit oben. Dem Ende der 1990er-Jahre spürbaren Ge-fühl, Rot-Grün gelinge der soziale Ausgleich in einer Phase der weltweiten sozialen undwirtschaftlichen Neujustierung besser als der christlich-liberalen Vorgängerkoalition,verdankte Gerhard Schröder seinen Wahlsieg 1998.
Neben dieser nachvollziehbaren Deutung ist besonders hervorzuheben, dass Conze,anders als Wehler, die Geschichte der Republik bis in die unmittelbare Gegenwart fort-schreibt. So ist es dem Leser möglich, die Wurzeln aktueller Debatten zu verfolgen. Diederzeitige Sozialstaatskrise kann, um nur ein Beispiel zu nennen, von den Folgen derdeutschen Einheit nicht getrennt werden. Genauso fiel der weltumspannende Kollapsder Finanzmärkte nicht vom Himmel, sondern wurde nicht zuletzt deshalb möglich, weilviele nationale Politiker (in Deutschland vor allem Vertreter der rot-grünen Koalition)ihre Länder durch gesetzgeberische Maßnahmen in das komplexe System des globalenKapitalismus eingliederten. Nur vor dem Hintergrund solcher strukturellen Reformenist zu erklären, warum die viel zitierte Subprime- und Immobilienmarkt-Krise aus denUSA die bekannten, verheerenden Ausmaße annehmen konnte.
Angesichts der hochkarätigen, konkurrierenden Arbeiten über das gleiche Thema, diein den letzten Jahren vorgelegt wurden, war es ein Wagnis, eine neue Gesamtdarstellungin Angriff zu nehmen. Die Zunft muss Conze dankbar sein, dass er die Herausforderungglänzend gemeistert und eine Abhandlung geschrieben hat, die bald zum Standardwerkavancieren dürfte. Es ergänzt die sozialhistorischen Betrachtungen Wehlers, die ihm imDetailreichtum und hinsichtlich der Deutung der bundesrepublikanischen Geschichtenicht das Wasser reichen können.
Da der Stoff einer bundesrepublikanischen Kulturgeschichte ebenso faszinierend wievielfältig ist, haben sich schon einige Kenner der Thematik angenommen. Exemplarischsei lediglich die dreibändige Abhandlung von Hermann Glaser genannt,3 die vor einigenJahren, um ein breiteres Publikum zu erreichen, in einem Band komprimiert erschien.Auch der Literaturwissenschaftler und Historiker Jost Hermand hat bereits diversesEinschlägige verfasst, darunter eine Darstellung, die die gesamte deutsche Kulturge-schichte des 20. Jahrhunderts umspannt.4 Jedem, der sich damit beschäftigt, droht dieimmense Flut an Informationen zu erschlagen. Das gilt auch bei Betrachtung der letztensechs Dekaden.
In sieben Kapiteln beschreiben der an der Universität Hamburg lehrende Axel Schildt,der durch viele Veröffentlichungen zur Geschichte der Bundesrepublik bekannt wurde,etwa zu den 1950er-Jahren und zur Sozialgeschichte, und Detlev Siegfried, ebenfalls inHamburg tätig, die Mannigfaltigkeit dessen, was Kultur nach 1945 bedeutet. Dabei han-delt es sich um ein wahrlich weites Feld. Bereits die entsprechenden Aktivitäten nachdem deutschen Zusammenbruch bis zur Zäsur von 1949 offenbaren eine Fülle von Im-
3 Hermann Glaser, Kulturgeschichte der Bundesrepublik, 3 Bände, München 1985-1989.4 Jost Hermand, Deutsche Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, Darmstadt 2006.
346 Felix Dirsch · 60 Jahre Bundesrepublik – ein Staat in guter Verfassung? 346

pulsen des geistigen Lebens der Nachkriegszeit, unabhängig davon, ob es sich um Ent-nazifizierung oder Re-education handelt oder ob die Frage debattiert wurde: An welcheguten Traditionen der deutschen Geschichte, an klassisch-literarische oder an christlicheVorbilder, lässt sich leicht und unkompliziert anknüpfen? Dem Eingangskapitel folgenErörterungen über die Kultur im Wiederaufbau, die zwischen Traditionalismus undModernismus schwankte, des Weiteren, wie sich Kultur im Horizont des zunehmendenWohlstandes veränderte. Die kulturelle Dynamik vor dem Hintergrund des Wertewan-delschubes in den 1960er- und 1970er-Jahren kommt ebenso ausführlich zur Sprache wiedie Kultur der Spätphase der alten Bundesrepublik in der Ära Kohl. Das abschließendeKapitel beschäftigt sich mit den kulturellen Umbrüchen seit 1990.
Es führte im vorliegenden Rahmen zu weit, dem Werk eine ausführliche Würdigungzuteil werden zu lassen. Zweifellos bereichert es die Kenntnis wesentlicher kulturellerVorgänge und Entwicklungen. Als besonderes Verdienst ist es Schildt und Siegfried an-zurechnen, dass auch die jüngsten Tendenzen, etwa im Bereich der Kunst, berücksichtigtwerden, während Glaser in seiner Publikation »Deutsche Kultur 1945-2000« nur nocheinen kursorischen Ausblick auf die Zeit um 2000 bietet. Natürlich steht eines außerFrage: Die Autoren betrachten die Thematik aus einer dezidiert linksliberalen Perspek-tive. Deshalb verwundert es nicht, dass wichtige kulturelle Impulse aus dem konservativ-christlichen Lager entweder gar nicht erwähnt werden – hingewiesen sei lediglich aufbedeutende Schriftsteller der Nachkriegszeit wie Romano Guardini, Max Picard, AlfredMüller-Armack, Hans Zehrer oder Philipp Lersch – oder schlecht wegkommen wie HansSedlmayr. Wie wenig sich eine konservative sowie antikommunistische Haltung einer-seits und eine demokratische Ausrichtung andererseits ausschlossen, zeigt nicht zuletztdie Person des »liberalen Abendländers« Konrad Adenauer. Das alles lässt sich kaumbestreiten, auch wenn Schildt und Siegfried das Gegenteil suggerieren. Angesichts derVorgänge im Osten Europas sollten auch Spätgeborene ein Stück Verständnis für über-triebene Reaktionen haben, zu denen (zumindest aus heutiger Sicht) auch das vom CDU-Politiker Rainer Barzel gegründete Komitee »Rettet die Freiheit« zu zählen ist. DieseInitiative war im Zeitalter des West-Ost-Konfliktes durchaus berechtigt. Immerhin kon-statieren die Autoren im Hinblick auf die (pejorativ so bezeichnete) »Abendland-Ideo-logie« der 1950er-Jahre, sie habe »paradoxerweise eine positive Funktion für die Veran-kerung der Bundesrepublik im Westen« gehabt. Wahrscheinlich ist es zu viel verlangt,von den Verfassern zu fordern, sie hätten in ihrer Bewertung der Gegenwartskultur auchauf manche Gefährdungen der Freiheit hinweisen können. So heißt es an einer Stelle, dieFortschritte in Punkto Frauenemanzipation oder Gleichstellung der Homosexuellenwürden »seit den 90er Jahren als linksliberale ´political correctness` oder ´PC` karikiertund diffamiert« (S. 516). Dieses Phänomen entzündete sich vor Jahrzehnten im Umgangmit Minderheiten, heute äußert es sich in einer (überall vorherrschenden) Intoleranz deröffentlichen Meinung gegenüber denjenigen, die nicht den linksliberalen Mainstream re-präsentieren, von dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger angefangenüber den wegen einer umstrittenen Rede aus der CDU ausgeschlossenen Martin Hoh-mann bis hin zu der (von Schildt und Siegfried erwähnten) früheren Tagesschauspre-cherin Eva Herman, auf die regelrechte mediale Treibjagden veranstaltet wurden. Viele
347 Felix Dirsch · 60 Jahre Bundesrepublik – ein Staat in guter Verfassung? 347
ZfP 57. Jg. 3/2010

Namen (neben anderen Konrad Löw, Gerard Menuhin oder jüngst Thilo Sarrazin) wärenin diesem Zusammenhang zu nennen. Der Umgang mit Abweichlern sagt einiges überdie Kultur der unmittelbaren Gegenwart.
Neben den aufgezählten Gesamtdarstellungen zur Politik- und Kulturgeschichte der»geglückten Demokratie« (Wolfrum) bereicherte kurz vor Beginn des Jubiläumsjahreseine »Bilanz nach 60 Jahren« den Buchmarkt. Der von dem Adenauer-Biographen Hans-Peter Schwarz edierte Sammelband umfasst 31 Beiträge z.T. namhafter Wissenschaftler,darunter Karl-Rudolf Korte, Klaus Schroeder, Manfred Görtemaker, Franz Walter, Joa-chim Radkau und Christian Hacke. Die eindrucksvolle Zusammenfassung der For-schung ist in drei größere Abschnitte gegliedert: Historische Abläufe und Konstellatio-nen, Institutionen sowie Themenfelder. Der erste reicht von dem Versuch, »Zäsuren inder Geschichte der Bundesrepublik« (Alexander Gallus) aufzuzeigen, bis zu KlausSchroeders Analysen »Deutschland nach 1990. Probleme der Einheit«. Der zweite er-örtert wesentliche staatliche Einrichtungen: Kanzlerdemokratie, Parlamentarismus,Bundesstaatlichkeit, Parteiensystem, Bundesverfassungsgericht, Wirkungen des Fernse-hens und Bundeswehr. Die dritte Passage umfasst unterschiedliche Bereiche: vom »In-dustrieland Deutschland 1945 bis 2008« (Werner Plumpe) über die »Außenpolitik derBundesrepublik« (Christian Hacke) bis zum »Verschwinden des kulturellen Gedächt-nisses«. Besonders hervorzuheben sind die beiden Beiträge, die den Band umrahmen:Hans-Peter Schwarz‘ einführender Aufsatz »100 Jahre deutsche Jubiläumsbilanzen« undPeter März‘ abschließender Essay »Der Ort der Bundesrepublik in der deutschen Ge-schichte«. Der zeithistorisch wie politologisch Interessierte darf sich freuen, einen fun-dierten Überblick über die Vielfalt der Bundesrepublik-Forschung vorzufinden, dervergleichbare ältere Darstellungen, etwa den von Richard Löwenthal und Hans-PeterSchwarz zum 25. Geburtstag der Republik 1974 veröffentlichten Sammelband, auf denneuesten Stand bringt.
Während in der traditionellen Staatsrechtslehre, von Hans Kelsen bis zu seinem An-tipoden Carl Schmitt, der Wirklichkeit des Politischen der eindeutige Vorrang vor seinennormativen Grundlagen zukam, erfreut sich hierzulande das Grundgesetz schon seit ge-raumer Zeit wachsender Beliebtheit. Daher erstaunt es nicht, dass 2009 einige Studienüber das Grundgesetz und seine Genese erschienen. Christian Bommarius veröffentlichteeine populärwissenschaftliche »Biographie« über das erfolgreiche Geschöpf der Verfas-sungsväter und –mütter.
Dass das Grundgesetz eine »kopernikanische Wende« in der deutschen politischenTradition bedeutet, war und ist evident. Zwei bahnbrechende Neuerungen im Vergleichzur Tradition vor 1945 waren die vorstaatliche Begründung der Grundrechte und dieEinrichtung einer Verfassungsgerichtsbarkeit, die in der Weimarer Republik lediglichGegenstand verfassungsrechtlicher Dispute war. Bommarius schildert die Frühgeschich-te des Grundgesetzes anschaulich: die hitzigen Debatten 1948 (im Parlamentarischen Rat)über das Für und Wider der Todesstrafe; Fragen über die Gleichberechtigung von Mannund Frau, die in den 1950er-Jahren – aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Si-tuation – noch nicht so stark wie später im Vordergrund standen; die verfassungsrecht-liche Stellung der Kirchen und das Elternrecht – Streitpunkte, die damals heftiger dis-
348 Felix Dirsch · 60 Jahre Bundesrepublik – ein Staat in guter Verfassung? 348

kutiert wurden, als man sich das heute vorstellen kann; die neue Stellung der Parteien;die rechtsstaatliche Struktur der noch nicht gegründeten Republik und einiges mehr.
Daneben wird geschildert, welch hohen Stellenwert das Grundgesetz in den sechsJahrzehnten seiner Geschichte erhielt. Die jüngere Rechtsgeschichte ist voll von Bei-spielen über erregte Auseinandersetzungen im Hinblick auf die grundgesetzliche Exegesedes Bundesverfassungsgerichts: Lüth- und Elfes-Urteil, Asylrechts- und Abtreibungs-entscheid, Kruzifix-Streit, Maastricht- und Lissabon-Urteil – vieles ist mit dem OrtKarlsruhe verbunden, an dem der Wächter über das Grundgesetz seinen Sitz hat.
Bommarius´ Studie ist kurzweilig und amüsant zu lesen. Manche Glorifizierung, be-gründet in einer einseitigen linksliberalen Weltsicht, ist aber als übertrieben zurückzu-weisen. Für einen Vertreter des Mainstream-Journalismus lässt es sich wohl kaum ver-meiden, im Asyl-Kompromiss der 1990er-Jahre, der höchstrichterlich abgesegnet wurde,sowie im Luftsicherheitsgesetz, das unter der Ägide von Innenminister Otto Schily ver-abschiedet wurde, zwei Tiefpunkte der deutschen verfassungsgeschichtlichen Entwick-lung in jüngerer Zeit zu sehen. Bei aller Hochschätzung der Menschenwürde als Dreh-und Angelpunkt des Grundgesetzes: Beim Luftsicherheitsgesetz versagt die Anwendungdieses für die Konstitution so entscheidenden Grundsatzes. Schließlich kommt nicht nurden Insassen eines Flugzeuges – nehmen wir ein Szenario wie »nine eleven« einmal inDeutschland an! –, sondern auch denen, die vor einem Angriff geschützt werden sollen,die Menschenwürde zu. Hier sind Abwägungsprozesse zu leisten. Der Gesetzgebernahm sie in anderer Weise als das Bundesverfassungsgericht vor. In den Jahrzehnten, indenen sich das Grundgesetz bewährt hat, war immer von den Gefährdungen die Rede,denen es ausgesetzt ist. Spontan fallen einem die Extremisten von links und rechts ein,die in der bundesrepublikanischen Geschichte stets ein Randphänomen waren und daswohl auch in Zukunft sein werden. Verstärkt seit dem Maastrichter Vertrag wurde deut-lich, dass der Prozess der europäischen Einigung für das Grundgesetz unübersehbareGefahren mit sich bringt. Folgt man Bommarius‘ Duktus, so überrascht es nicht, wiewenig der Autor auf diese Zusammenhänge eingeht. Es hätte einer ausführlicheren Un-tersuchung bedurft zu klären, inwiefern die Fülle der Gesetze, die auf unterschiedlicheWeise von Brüssel vorgegeben werden, gegen einen zentralen Grundgesetz-Artikel ver-stößt: »Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus«. Eine andere Frage lautet, ob durch dieforcierte europäische Einigung die Staatsstruktur- und Identitätsprinzipien der Verfas-sung verletzt werden. Noch vieles weitere wäre in diesem Kontext zu hinterfragen. Sosehr man auch die in den letzten Jahren neu beschlossenen Sicherheitsgesetze mit wach-samen Augen verfolgen kann und soll: Ihr Gefahrenpotenzial ist unbestreitbar geringerals dasjenige, das von der Brüsseler Bürokratie ausgeht.
In vielen Darstellungen, die sich mit deutscher Verfassungsgeschichte beschäftigen,fungiert die Bundesrepublik nicht selten als Appendix. Auf diese Weise wird ihr spezi-fischer verfassungsrechtlicher und verfassungshistorischer Beitrag zur deutschen Ge-schichte öfters nicht recht deutlich. Jörn Ipsen will diesem Mangel Abhilfe schaffen undveröffentlichte 2009 einen wissenschaftlich profunden Überblick über die verfassungs-geschichtlichen und –rechtlichen Grundlagen eines Staates, der ohne den ihn konstitu-ierenden, grundlegenden »antitotalitären Konsens« (Jürgen Habermas) undenkbar ist.
349 Felix Dirsch · 60 Jahre Bundesrepublik – ein Staat in guter Verfassung? 349
ZfP 57. Jg. 3/2010

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass in der politischen Wirklichkeit nicht seltenbloß eine weitreichende antifaschistische Übereinkunft übrigbleibt, die die Gefahren desoft »smarten Extremismus« (Lang/Jesse) durch diverse linke Vereinigungen häufig nichtzur Kenntnis nimmt.
Der Titel der Untersuchung Ipsens erweist sich nicht zuletzt deshalb als zutreffend,weil die Bundesrepublik sich nicht nur als resistent gegenüber radikalen Abenteuernjedweder Couleur erwies, sondern auch »Schaukelspiele« zwischen Ost und West ver-mied. Einer der zahlreichen Belege dafür ist die Ablehnung der so genannten »Stalin-Note« von 1952, deren Akzeptieren durch die junge Bundesrepublik – und im unab-dingbaren Einklang mit ihr durch die Besatzungsmächte – ein neutralisiertes Deutsch-land ohne Westbindungen zur Folge gehabt hätte. Für alle Bundesregierungen war diePräferenz westlicher Werte nicht diskutabel.
Diese überaus klare Orientierung schlägt sich inhaltlich an fast allen Stellen desGrundgesetzes nieder. Eine Einrichtung wie die des Reichspräsidenten als »Ersatzkaiser«mit umfassenden Vollmachten, mit der die Weimarer Reichsverfassung noch eine alsspezifisch »deutsch« empfundene Tradition aus vordemokratischen Zeiten hinüberrettenwollte, wäre im Grundgesetz undenkbar gewesen. Doch selbst der Neubeginn von 1949bedeutete nicht in allen Bereichen des Rechts eine Tabula rasa. Erst in den 1960er-und 1970er-Jahren wurden letzte Relikte aus vordemokratischen Zeiten beseitigt. Somutierten beispielsweise die »besonderen Gewaltverhältnisse« zu den »Sonderrechts-verhältnissen«, die kein Residuum der Exekutive mehr darstellen, sondern vom Parla-ment geregelt werden müssen. Man kam nicht darum herum, Teile des Bürgerlichen Ge-setzbuches an verfassungsrechtliche Vorgaben anzupassen.
In zehn Kapiteln erläutert Ipsen Verfassungsgeschichte und –recht der Bundesrepu-blik. Das Regierungssystem des »freiesten Staates der deutschen Geschichte« (Karl Cars-tens) erfährt eine ausführliche Darstellung und Würdigung. Auffallend ist der weiteRaum, den der Jurist den zeitgeschichtlichen Partien einräumt. Auf diese Weise kann erzeigen, dass nicht nur konstitutionelle Normvorgaben westlichen Standards entsprachenund das heute noch tun; vielmehr führte dieses staatsrechtliche Fundament dazu, dass inder Mitte Europas ein politisch stabiles Gravitationszentrum entstand, das zwei Gene-rationen nach seiner Gründung erstaunliche Kontinuitäten vorweisen kann. Weder derweithin als schwerwiegend erachtete Einschnitt durch die Ereignisse am Ende der 1960er-Jahre noch die Herausforderung durch den Terrorismus im darauf folgenden Jahrzehntkonnten den verfassungsrechtlichen wie –politischen Konsens nachhaltig erschüttern.Trotz aller neuen Akzentsetzungen gilt das auch für das alt-neue Deutschland nach derWiedervereinigung. Selbst eine solche Zäsur wurde von der Bevölkerung und der öf-fentlichen Meinung nicht als so groß eingeschätzt, dass starke Veränderungen des Grund-gesetzes – über marginale Korrekturen hinaus – mehrheitlich durchsetzbar gewesen wä-ren. Auch dieses Faktum zeigt, wie sehr sich in Deutschland ein »Fundamentalkonsens«(Richard Rorty) hinsichtlich oberster juristischer Grundwerte bilden konnte, den manin der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast ausschließlich im angloamerikanischen Be-reich vorfand. In der Schlussbetrachtung wird der Verfasser spürbar nachdenklich. Ei-nerseits gehört das zunehmende Aufgehen Deutschlands in einem europäischen Staa-
350 Felix Dirsch · 60 Jahre Bundesrepublik – ein Staat in guter Verfassung? 350

tenverbund sicherlich zu dem, was die Verfassungsväter und –mütter intendierten; an-dererseits stellt sich die Frage, ob manches Charakteristikum der bundesrepublikani-schen Rechtsprechung, etwa der starke Schutz der Grundrechte, aufrechtzuerhalten seinwird; denn der Europäische Gerichtshof ließ bisher andere Schwerpunkte erkennen, undes bleibt abzuwarten, ob die Europäische Grundrechtscharta katalytische Wirkung ent-falten kann.
Weniger wissenschaftlich als Ipsens Traktat, aber durchaus lesenswert ist das vomEhepaar Marion und Stephan Detjen sowie Maximilian Steinbeis verfasste Buch »DieDeutschen und das Grundgesetz«. Von seiner Anlage her eignet es sich gut für die poli-tische Bildung. Dem journalistischen Grundzug, der die Thematik für einen breiterenLeserkreis aufbereiten will, ist es geschuldet, dass es den Autoren nicht um einen syste-matischen Abriss der bundesdeutschen Verfassungsgeschichte geht, sondern in stärke-rem Maß um eine Erzählung der wichtigsten Abschnitte aus Theorie und Praxis desbundesdeutschen Verfassungslebens. Das Verhältnis des Grundgesetzes zu Staat, Frei-heit und Demokratie steht im Vordergrund. Der Bogen reicht vom Lüth-Urteil und vomKampf gegen die radikalen Parteien (SRP, KPD) der 1950er-Jahre bis zum Streit um denEuropäischen Verfassungsvertrag.
Das Unternehmen zeigt einige Gemeinsamkeiten mit Bommarius‘ Anliegen. Fraglichist, ob derjenige, der die Frühgeschichte der Bundesrepublik aufarbeitet, ein besondersostentativ vorgetragenes, distanziertes Verhältnis zu diesem zeithistorischen Abschnittan den Tag legen muss. Längst ist es, vor dem Hintergrund unserer eigenen Erfahrungen,üblich, den geringen Grad der Frauenemanzipation in den 1950er-Jahren zu beklagen.Freilich darf aus gegenwärtiger Perspektive nicht die Reflexion über die Kontingenz derGeschichte fehlen. Danach hatte und hat jede Zeit ihre Prioritäten. Angesichts des damalsrelativ geringen Lebensstandards und vieler kriegsbedingter Folgen, etwa die durch Kriegund Kriegsgefangenschaft bedingte lange Trennung vieler Familien, leuchtet es durchausauch im Jahre 2009 ein, dass das Verhältnis von Mann und Frau nicht so intensiv debattiertwurde wie in den 1970er-Jahren, wenngleich mit dem Ende des männlichen Stichent-scheides 1957 schon erste Akzentverschiebungen eingeleitet wurden. Darüber hinauswird die Wiedereingliederung von Ex-Nazis heute als unbefriedigend empfunden. Werdie Problematik jedoch genauer beleuchtet, erkennt viele Grade an Schuld und Verstri-ckung, die unmöglich exakt juristisch aufgearbeitet werden konnten. Versuche mittelsdes »Fragebogens« führten zu neuen Ungerechtigkeit, gegen die es von verschiedenenSeiten Widerstände gab, etwa von den Kirchen. Der Konsens von Kurt Schumacher bisKonrad Adenauer, die Mitläufer zu integrieren, hatte viele positive Konsequenzen undkann als pragmatisch angesehen werden. Das ist wohl das Beste, was in der katastrophalenseinerzeitigen Lage zu erreichen war, in der die meisten Zeitgenossen froh waren, »davongekommen« zu sein – viele (und nicht nur die Millionen Teilnehmer am »UnternehmenBarbarossa«) nicht ohne nachhaltige Belastungen für ihr weiteres Leben. Die große Massean Schuldigen abzuurteilen, darf als illusionär gelten – die Zahl an Richtern und Gefäng-nissen hätte kaum dazu ausgereicht.
Auffallend beim Überblicken der neuesten Bundesrepublik-Literatur ist der Mangelan umfangreichen Historisierungs-Versuchen. Die sogenannte »Bonner Republik« liegt
351 Felix Dirsch · 60 Jahre Bundesrepublik – ein Staat in guter Verfassung? 351
ZfP 57. Jg. 3/2010

als abgeschlossener Zeitraum hinter uns. Sie wurde in jüngster Zeit eher journalistischdenn wissenschaftlich thematisiert.5 Einer der Gründe für dieses Desiderat liegt – beiallen möglichen Anknüpfungspunkten an Traditionen des 19. Jahrhunderts, etwa derliberalen Bewegung von 1848 – in dem Umbruch, den die Nachkriegszeit im Hinblickauf die deutsche Geschichte als Ganzes bedeutet. Selbst das demokratische Zwischenspielvon 1918 bis 1933 konnte kaum Vorbildcharakter entwickeln, weil der anfänglich hoff-nungsvolle Aufbruch später zumeist von seinem bitteren Ende her gesehen wurde. So istauch das geflügelte Wort des Schweizer Publizisten Fritz R. Allemann, »Bonn ist nichtWeimar«, zu verstehen.6 Es deutete den völlig unterschiedlichen Verlauf beider deutscherRepubliken schon im Jahre 1956 an. Der »Weimar-Komplex« (Sebastian Ulrich) trugeiniges zur Kontinuität nach 1949 bei.
Wie schon bei den runden Jubiläen vor zehn oder zwanzig Jahren zeigt sich bei nichtwenigen Abhandlungen die Tendenz, die »geglückte Demokratie« (Wolfrum) zu rosigzu sehen. Es kann selbstverständlich nicht bestritten werden, dass die Geschichte seit1949 den Bruch mit vielen negativen Erscheinungen erkennen lässt. Freilich darf das nichtden Blick für die Schattenseiten der Gegenwart trüben. Die z.T. massiven gesellschaft-lichen Probleme, die sich aus dem wachsenden Trend zum Multikulturalismus und zurIslamisierung ergeben,7 die politisch korrekte Einschränkung der Meinungsfreiheitdurch den »Terror der Gutmenschen«,8 die demographischen Schwierigkeiten, die sichjetzt bereits abzeichnen, die Defizite im Bildungsbereich,9 die Gefahren für nationaleSouveränität und Grundgesetz, auf die jüngst auch das Bundesverfassungsgericht in sei-nem Urteil zum Lissabon-Vertrag hinwies10 – das alles und noch vieles mehr, was dies-bezüglich genannt werden könnte, ist geeignet, das Bild von der grundsätzlichen Er-folgsstory nach 60 Jahren ein wenig zu relativieren.11
5 Vgl. dazu Heribert Schwan / Rolf Steiniger, Die Bonner Republik 1949-1998, Berlin 2009. DerBand präsentiert Interviews mit Zeitzeugen, die den untersuchten Zeitraum lebendig werdenlassen.
6 Auf dieses Bonmot bezieht sich die Monographie von Sebastian Ulrich, Der Weimar-Komplex.Das Scheitern der ersten deutschen Demokratie und die politische Kultur der frühen Bundes-republik 1945-1959, Göttingen 2009.
7 Deutlich angesprochen bei Udo Ulfkotte, SOS Abendland. Die schleichende IslamisierungEuropas, 5. Auflage, Rottenburg 2008.
8 Statt vieler anderer: Klaus J. Groth, Stigmatisiert. Der Terror der Gutmenschen, Unna 2003.Hier findet sich eine interessante Dokumentation von Opfern der politischen Korrektheit.
9 Engagiert-essayistisch abgehandelt bei Josef Kraus, Ist die Bildung noch zu retten? Eine Streit-schrift, München 2009.
10 Zum knappen Überblick: Felix Dirsch, »Karlsruhes ›Lissabon‹« in, Gegengift. Zeitschrift fürPolitik und Kultur vom 15.07.2009, S. 14-19.
11 Einiges Bedenkliche im Hinblick auf wichtige Gegenwartstendenzen findet sich, in Form einerkurzen skizzenhaften Darstellung, bei Felix Dirsch, »Und (k)ein bisschen weise. Zur Geburts-tagsstimmung im freiesten Staat der deutschen Geschichte« in, Gegengift. Zeitschrift für Politikund Kultur vom 1.06.2009, S. 4-9; ausführlicher: Johann Braun, Wahn und Wirklichkeit. Überdie innere Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 2008, der eine größere Zahlvon Problemfelder aufzählt.
352 Felix Dirsch · 60 Jahre Bundesrepublik – ein Staat in guter Verfassung? 352

BUCHBESPRECHUNGEN
Flügel-Martinsen, Oliver: Grundfragen politischerPhilosophie. Eine Untersuchung der Diskurse überdas Politische.(Rainer Miehe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Hirsch, Michael: Die zwei Seiten der Entpolitisie-rung. Zur politischen Theorie der Gegenwart.(Holger Zapf). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Munier, Gerald: Thomas Morus. Urvater desKommunismus und katholischer Heiliger und Rib-hegge, Wilhelm: Erasmus von Rotterdam.(Thomas Schölderle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Thein, Martin: Wettlauf mit dem Zeitgeist – DerNeonazismus im Wandel. Eine Feldstudie.(Armin Pfahl-Traughber). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Oliver FLÜGEL-MARTINSEN: Grundfragenpolitischer Philosophie. Eine Untersuchung derDiskurse über das Politische, Nomos Verlag Ba-den-Baden 2008, 277 S., kart., 19,90 €
Wenn Denker wie Sloterdijk das Politische durchdie Philosophie auflösen wollen, um mit thymoti-scher Energie eine »Revolution der gebendenHand« (FAZ vom 10.6.09) auszulösen, dann wirdeinem klar, wie nötig instruktive Betrachtungenzur politischen Philosophie geworden sind, schonallein aus Gründen der Unsinnsreduktion.
Flügel-Martinsens Buch ist vergleichsweise in-struktiv. Vier Diskurse werden vorgestellt: Be-gründen, Befestigen, Begrenzen, Befragen. Sie stel-len gewissermaßen einen ideengeschichtlichenVerlauf dar, der die Reflexionen über das Politi-sche vor dem Hintergrund normativer Welt- undMenschenbilder kennzeichnet danach, was in die-sen Reflexionen geschieht. Aristotelische, Kanti-sche und Hegelianische Diskurse begründen dasGemeinwesen und realisieren Freiheit auf jeweilsunterschiedliche Weise durch Institutionen, die
das Regierungshandeln in allen Politikfeldern le-gitimieren soll.
Befestigen ist notwendig, weil die menschlicheNatur mit ihren Bestrebungen nach Macht undGewalt auch immer eine Gefahr des begründetenGemeinwesens darstellt. Ordnung und Sicherheittreten in den Vordergrund und damit die auf Ma-chiavelli und Hobbes zurückgehenden Diskurse.Hier stellt sich die Frage, wie weit der Staat in dieFreiheit des Einzelnen eingreifen darf, so dass Pro-bleme der Begrenzung entstehen. Diese Problemewerden vom Autor durch Heranziehung der Kon-zeptionen vor allem von Locke, Rawls und Nozickdiskutiert.
Abschließend führt Flügel-Martinsen den Dis-kurs des Befragens ein, der im wesentlichen einNietzscheanischer ist und die Verunsicherung al-len Denkens zum Gegenstand hat.
Flügel-Martinsen beherrscht sein Metier so, wiees in der Sozial- und Geisteswissenschaft weitge-hend gefordert wird. Nicht Tatsachen und detail-lierte Einzeluntersuchungen stehen an erster Stel-le, sondern der große Überblick, hier der souverä-ne Umgang mit den ideengeschichtlichen Strö-mungen. Der hermeneutische Wahrheitsanspruch,den der Autor vertritt, ergibt sich dadurch, dass dieeloquente Art, wie dieser Anspruch auftritt, schonallein die Geltung von Wahrheit zu belegenscheint.
Dazu gehört die Aussage (26): »Obzwar dieRegierungsform der Demokratie im Verlauf derpolitischen Ideengeschichte eine allseits ungeliebteKonzeption darstellt, die geradezu gar keinen Für-sprecher mobilisieren kann und – nicht allein – vonAristoteles, Kant und Hegel unisono als denkbarschlechtester Zustand apostrophiert wird, steht siemittlerweile im Zentrum der theoretischen undpraktischen politischen Diskurse.« Dass diese ka-tegorische Bewertung abwegig ist, ergeben flüch-tige Blicke auf die englischen Theoretiker des 18.und 19. Jahrhunderts und vor allem auf Kant, derdemokratische Elemente in seiner Konzeption vonder Republik sehr wohl hervorhebt.
Flügel-Martinsen referiert hingegen gut nach-vollziehbar und einleuchtend den Freiheitsbegriffvon Hannah Arendt, durch welchen der Zusam-

menhang von Gründen und Bewahren deutlichwird. Arendt liegt es fern, Politik durch Philoso-phie aufzulösen. Freiheit erfahren die Menschenim gemeinsamen Handeln, aus dem heraus über-haupt erst Weltbezüge entstehen.
Was der Leser in der Studie vermisst, ist dieEinbeziehung von Religion bzw. Offenbarung impolitischen Denken. Flügel-Martinsens Resümee,»das Politische unterhält Beziehungen zum Nor-mativen« (261), wirkt im Vergleich zu den vielenkomplizierten Reflexionen des Autors sehr karg,und man hätte sich gewünscht, wenn das Wech-selspiel von Offenheit und Geschlossenheit derDiskurse zu einer dichteren Quintessenz geführthätte.
Außerdem ist die Zuspitzung der Nietzschea-nischen Diskurse auf die französische Philosophieder Gegenwart ziemlich einseitig. Nietzsche warkein vornehmlich politischer Denker. Hier hätteder deutsche bzw. internationale Forschungsstandstärker berücksichtigt werden sollen. Auch derEinfluss Nietzsches auf die normativen Klassikerder Politikwissenschaft, Eric Voegelin und vor al-lem Leo Strauss, gehört mit zu den Grundlagenpolitischer Philosophie.
Wer indes wissen will, wie politische Philoso-phie heute betrieben wird, hält eine lesenswerteSchrift in den Händen.
Rainer Miehe
Michael HIRSCH: Die zwei Seiten der Entpoliti-sierung. Zur politischen Theorie der Gegenwart,Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2007, 214 S.,brosch., 36,00 EUR.
Der demokratische Rechtsstaat ist am Ende. Er istam Ende, bevor es ihn jemals gegeben hat. Das ab-strakt-jungfräuliche normative Konzept einer erstnoch einzulösenden Volkssouveränität, das ihn ei-gentlich garantieren sollte, wurde und wird vonperversen Gegenaufklärern geschändet. Das ge-schieht auf zweierlei Weise: Entweder wird daraufverwiesen, dass der Staat als Zurechnungsort vonim Volkswillen begründeter Normativität längstverlorengegangen ist und nur noch als semantischeChimäre fortlebt, was sich empirisch in der Ten-denz spiegelt, dass sich Staatshandeln mehr undmehr in einer (zumindest scheinbar) kooperativenSubpolitik verliert, die gesellschaftliche Kräftever-hältnisse reproduziert. Oder aber die Volkssouve-
ränität wird verdreht in eine nur außerstaatlichmögliche und damit nicht normierbare Eruptiongesellschaftlicher Kräfte, die sich als pouvoir con-stituant gegen den Staat als pouvoir constitué wen-den. Aus dieser doppelten Frontstellung kann daskantische Aufklärungsdenken jedoch befreit wer-den, wenn man sich bewusst macht, dass dieGleichsetzung normativer und diagnostischerKonzepte ein Kategorienfehler ist. Das ist, wennman so will, die Erzählung, die Michael HirschsBuch – hervorgegangen aus einer Dissertation beiIngeborg Maus – zugrunde liegt.
Es handelt sich dabei um eine für einen »Nor-mativisten« mutige Auseinandersetzung mit etwazwanzig neueren Theorieentwürfen aus einer anKant orientierten Perspektive. Die Diagnose istdabei eine doppelte: Die untersuchten Theorienziehen sich angesichts der Komplexität von Politikund Gesellschaft entweder auf eine technokrati-sche oder auf eine ontologische bzw. ästhetischePosition zurück. Dadurch kommt es Hirsch zu-folge zu einer Entrechtlichung von Staat und Ge-sellschaft, insofern nicht nur die Verwirklichungdemokratischer Gleichheit als Projekt aufgegebenwird, sondern überhaupt das Regulativ einer funk-tionierenden Demokratie wegbricht: Die eher lin-ke »politische Ontologie« – von Rancière bis Ba-diou – setzt dem als Demokratie gescheitertenStaat eine symbolische Gemeinschaft entgegen,die, von der Idee der Volkssouveränität abgekop-pelt, nicht mehr darauf angelegt ist, im Rahmendemokratischer Verfahren Legitimität zu erzeu-gen. Die »politische Technokratie« auf der ande-ren Seite tendiert dazu, Staatshandeln von der le-gislativen Kontrolle weg zunehmend in den Ho-heitsbereich der Verwaltung zu verschieben, wasdazu führt, dass der Staat, ohne sich weiterhin desSteuerungsmediums demokratisch legitimiertenRechts zu bedienen, zum Akteur auf subpoliti-scher Ebene wird. Dies sind die »zwei Seiten derEntpolitisierung«. Mit dieser Analyse wird zu-gleich aufgezeigt, wie sehr scheinbar linke Theo-rien konservativen und fortschrittsfeindlichen Po-sitionen verfallen sind. Diesem Verdikt unterlie-gen dann auch nicht nur die autoritären politischenTheorien der Einheit von Hegel und Schmitt, son-dern auch die der Differenz von Lyotard über De-leuze bis zu Luhmann – Entpolitisierung, soweitdas Auge reicht. Das Korrektiv gegenüber diesennormativen Sackgassen ist die starke Annahme der
354 Buchbesprechungen 354

Möglichkeit eines an Volkssouveränität rückge-bundenen staatlichen Rechts.
Auf den einen oder anderen mag es zwar ermü-dend wirken, wie Hirsch die beiden Arten vonEntpolitisierung an einem Spektrum von avancier-ten politischen Theorien der Gegenwart durchde-kliniert und herausarbeitet, wie sie sich in ihrerTendenz zur technokratischen oder ontologischenEntpolitisierung gleichen – doch hat dieser Auf-weis selbst zeitdiagnostische Qualität, so dass mansich davon durchaus beunruhigen lassen kann.Methodisch bemerkenswert ist dabei insbesonde-re, dass im Anschluss an Luhmann immer wiederauf die (ideologische) Funktion von Theoriese-mantiken verwiesen wird – denn das ist in der Po-litischen Theorie gewiss ein Bereich, der mittel-fristig an Bedeutung gewinnen wird. Insofern istes bedauerlich, dass auf die methodische Entwick-lung der Untersuchung dieser Semantiken nichteingegangen wird – wenn auch durch die Darstel-lung einmal mehr offensichtlich wird, dass hier ei-niges an Material vorliegt, das eine eingehende, aufdiese Weise methodisch fundierte Untersuchungverdient hätte. Einstweilen kann man Hirschs ei-gene Entpolitisierungssemantik goutieren als denVersuch, dem sozialwissenschaftlichen Phantasmaüberbordender und nicht steuerbarer Komplexi-tät, das der Entpolitisierung zugrunde liegt, einwohlartikuliertes Unbehagen entgegenzuhalten,das der Aufklärung verpflichtet ist. Also: Endlichwieder eine Utopie, die nicht durch ihre Radikali-tät und ihren Willen zur (theoretischen) Gewaltbesticht! Oder, wie es der Autor vorsichtig for-muliert: »Es könnte sein, […] dass das normativRichtige nicht unbedingt immer neu und interes-sant ist.« In einer auf Innovationszwang abstellen-den Wissenschaftskultur ist diese Aussage ein Aus-druck von Integrität, im Hinblick auf die Unter-suchung weist sie mit vernünftiger Nüchternheitdie Grenzen derselben auf. Kann man mehr ver-langen?
Holger Zapf
Gerald MUNIER: Thomas Morus. Urvater desKommunismus und katholischer Heiliger. Ham-burg: VSA-Verlag 2008, 340 S., brosch.,22,80 EUR und Wilhelm RIBHEGGE: Erasmusvon Rotterdam. Darmstadt: WissenschaftlicheBuchgesellschaft 2010, 278 S., geb., 29,90 EUR.
Den Zeitgenossen schienen beide unzertrennlich,manchen galten sie sogar als »Zwillingspaar« (vgl.Hubertus Schulte Herbrüggen, Einleitung, in:Thomas-Morus-Werke, Bd. 5: Briefe der Freund-schaft mit Erasmus, München 1985, S. 36). Am31. August 1535, knapp zwei Monate nachdemThomas Morus auf dem Towerhügel enthauptetworden war, schrieb der zutiefst betrübte Eras-mus: »Mit Morus’ Tod scheine ich selbst gestor-ben, war meine Seele doch zweigeteilt« (Erasmusvon Rotterdam: Opus Epistolarum Des. ErasmiRoterodami, 12 Bde., hrsg. v. Percy S. Allen u.a.,Oxford 1906-1958, hier Bd. XI, 3049, Z. 163 f.)Auch Morus beendete bereits im Jahr 1529 einenBrief an Erasmus mit den Worten: »Leb wohl,mein lieber Erasmus, du mehr als die Hälfte meinerSeele« (Morus an Erasmus, 28. Oktober 1529,aaO. (FN 1), Nr. 47, S. 290). Die tiefe Freundschaftder beiden großen Humanisten ist nicht nur umihrer selbst willen bemerkenswert. Immer wiederliefert die Beziehung auch allerlei Klärendes fürdas Verständnis ihrer jeweiligen Werke, nicht zu-letzt für Morus’ berühmte Utopia (1516), Eras-mus’ Fürstenspiegel Erziehung des christlichenFürsten (1516) oder dessen Geniestreiche im Lobder Torheit (1511).
Zu den beiden großen Figuren der Renaissancesind nun zwei neue, allerdings höchst unterschied-liche Biografien erschienen. Gerald Muniers BuchThomas Morus. Urvater des Kommunismus undkatholischer Heiliger kam im März 2008 im Ham-burger VSA-Verlag auf den Markt; Wilhelm Rib-hegges Erasmus von Rotterdam erschien im Januar2010 bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft.In beiden Lebensbeschreibungen ist das innigeFreundschaftsverhältnis zentrales Thema. Munierwidmet der Beziehung unter der Überschrift »DerWeggefährte Erasmus von Rotterdam« ein eigenesKapitel. Und in Ribhegges Erasmus-Buch ist Mo-rus eigentlich unaufhörlich präsent; der mit Ab-stand umfangreichste Eintrag im Namensregisterist »Morus« vorbehalten. Damit haben sich dieGemeinsamkeiten beider Bücher aber bereits weit-gehend erschöpft. Während Ribhegge eine nüch-
355 Buchbesprechungen 355

terne Bestandsaufnahme der biografischen For-schung liefert und die Lebensgeschichte Erasmus’sachlich abwägend nachzeichnet, verfolgt Muniereine Mission: Pointiert, zuweilen polemisch, ver-sucht er seine These zu untermauern, die lautet:Morus sei entgegen der hagiografischen Traditionsowohl katholischer wie sozialistischer Biografenin Wahrheit eine ausgesprochen widersprüchliche,ja höchst angreifbare Person gewesen.
Morus (1478-1535) ist fraglos eine schillerndeFigur. Er ist nicht nur Autor der Utopia (1516) unddamit zugleich Namensgeber einer neuzeitlichenGattungs- und Denktradition; eine steile politi-sche Laufbahn führte ihn zudem bis in das höchsteAmt unter dem König: Von 1529 bis 1532 warMorus englischer Lordkanzler. Seinen Weltruhmverdankt er aber hauptsächlich seiner Weigerung,den Eid auf die neue, von Rom losgerissene An-glikanische Kirche Heinrichs VIII. zu leisten – eineWeigerung, die ihm das Leben kostete. Für dieStandhaftigkeit sprach ihn die katholische Kirche1935 heilig. Der Märtyrer diente aber nicht nur derkatholischen Kirche als leuchtendes Vorbild; auchdie sozialistische Rezeption entdeckte Morus alseinen ihrer Vordenker und hob ihn als ersten Ver-künder eines kommunistischen Gesellschaftsmo-dells auf den Schild. Unabhängig von ideologi-schen Interessen nötigt das gelassene und heitereSterben des Morus aber bis heute jedem einfachenBetrachter Respekt ab. Noch auf dem Weg zumSchafott soll er scherzend zum Gouverneur desTowers gesagt haben: »Helft mir bitte beim Hin-aufsteigen, Master Kommandant, für mein Her-unterkommen lasst mich selber sorgen« (vgl. Wil-liam Roper, Das Leben des Thomas Morus, Hei-delberg 1986, S. 87). Außerdem habe er seinen lan-gen weißen Bart beim Niederknien augenzwin-kernd zur Seite geschoben und in Richtung Hen-ker gemeint: »Mein Bart zumindest ist des Hoch-verrats nicht schuldig. Nimm deinen Mut zusam-men, mein Hals ist sehr kurz, darum sieh dich umdeiner Ehre willen vor, dass du nicht verkehrtschlägst.«
In der Tat eignet sich Morus’ Leben und Ster-ben daher als Vorlage für glorifizierende Porträts,von denen es wahrlich genügend gibt. Demgegen-über zeichnet Muniers Buch zumindest auf denersten Blick eine wohltuend distanzierte Perspek-tive aus, die vorgibt, den wirklichen Menschenhinter den Geschichten und Legenden zu ergrün-den. Doch schon bald stellt sich der Eindruck ein,
dass die sensationslüsterne Demontage das einzigeZiel der Darstellung ist. Wenn die bisherige Mo-rus-Forschung nicht völlig irrt, dann verbreitetMunier an vielen Stellen kaum mehr als wortge-waltige Unwahrheiten.
Eine erste gewagte These lautet, Morus sei eingnadenloser Ketzerverfolger gewesen, der die Hä-retiker reihenweise auf die brennenden Scheiter-haufen geschickt habe. Dieser Vorwurf wird inzahlreichen Passagen wiederholt und variiert. Mu-nier nennt Morus den »Kettenhund« einer inqui-sitorisch-enthemmten Politik (241). »Es lodertenwieder die Scheiterhaufen und der Henker ließ dasFallbeil auf die Häupter unglückseliger Anhängerder Reformation und all derer, die Morus für irre-geleitete Abtrünnige vom katholischen Glaubenhielt, niedersausen« (239). Muniers Urteil ist nichtnur maßlos überzogen, es geht an den historischenFakten wohl schlicht vorbei. Richtig ist, dass Mo-rus die Reformation in England in seinenSpätschriften nach Kräften bekämpfte und dass dieKetzerverfolgung dort mit Beginn von Morus’Kanzlerschaft wieder auflebte. Seine Rolle waraber vergleichsweise gering. Die weltliche Machtübernahm zwar die Vollstreckung, doch die Pro-zesse waren Angelegenheit der Bischöfe und geist-lichen Gerichte. Als Laie konnte Morus überhauptkeine Häretiker verurteilen (vgl. Raymond W.Chambers, Thomas Morus, Basel 1947, S. 332). Sei-ne Funktion reduzierte sich darauf, diese in Haftzu halten und Verhöre zu führen. Nach dem Rück-tritt von seinen Ämtern schrieb Morus selbst:»Von allen denen, die mir wegen Ketzerei überge-ben wurden, hat kein einziger, so wahr mir Gotthelfe, einen Schlag oder Streich erhalten, nicht ein-mal einen Nasenstüber. Alles, was mir meineAmtspflicht auferlegte, war, sie in sicherem Ge-wahrsam zu halten« (Thomas Morus, The Apolo-gy (Complete Works; Bd. 9), New Haven/London1979, S. 118). Es gibt wenig Grund, die Aussageanzuzweifeln. Kein einziges Ketzer- oder gar To-desurteil existiert, das Morus’ Unterschrift trägt.Auch Munier hat ein solches weder gefunden nochgesucht, aber er weiß, dass Morus als Lordkanzler»für solche Urteile verantwortlich war« (241).
Während Morus daher als »Heiliger von zwei-felhaftem Ruf« (237) gilt, hält ihn Munier als Vor-denker des Kommunismus für »ganz passabel«(243). Dieses Urteil resultiert nun allerdings auseiner völlig naiv-wörtlichen Lesart der »Utopia«.Munier nimmt die Schrift als »verwirklichungsin-
356 Buchbesprechungen 356

tendierenden Staatsentwurf« (143) in allen Facet-ten für bare Münze, obwohl sie an unzähligen Stel-len spielerische, experimentelle und oftmals sogarvöllig ironisch gemeinte Beschreibungen von Ein-richtungen und Sitten enthält. Der historische Mo-rus jedenfalls hat rechtmäßig erworbenen Reich-tum mehrfach verteidigt und in einer Spätschriftkommunistisches Gemeineigentum sogar aus-drücklich verworfen (Vgl. Thomas Morus, TheConfutation of Tyndale’s Answer (CompleteWorks; Bd. 8,2), New Haven/London 1973,S. 664). Wohl auch deshalb schreibt Munier allenErnstes: »Kommunist war er nur in jenem schma-len Zeitfenster 1515/16, als er die Utopia verfasste«(243). Selbst wenn dem so wäre, ist das methodi-sche Vorgehen eine Farce. Wenn, dann erlaubt diePerson Rückschlüsse auf das literarische Werk,niemals umgekehrt. Übrigens: Die Religion derUtopier ist eine ausgesprochen tolerante und ex-plizit »heidnische« Lehre. Warum der Biografnicht den Schluss zieht, dass der »Ketzerverfolger«in jener Zeit von einem »heidnischen Fieber« be-fallen war, das hat er leider für sich behalten.
Noch eine letzte, erstaunliche These Munierssei hier abschließend erwähnt. Sie lautet auf »Kar-rierismus« (183). Bei aller vorgegaukelten Beschei-denheit sei Morus in Wahrheit von einer »Ellen-bogenmentalität« (71) und »ehrgeizigem Vor-wärtskommen« (184) beseelt gewesen. Munier be-schreibt Morus als einen Menschen, »der hartnä-ckig nach oben strebt, zur Not auch opportunis-tisch den Nacken beugt, um sich bei Fördererneinzuschmeicheln und die richtigen Seilschaftenzu finden« (71). Der Biograf scheint dabei kaumnoch zu merken, wie sehr er seinem »Gefühl« of-fenbar mehr traut als allen überlieferten Quellen.Vor allem Erasmus beschreibt in zahllosen Briefen(ebenso wie Morus selbst), die distanzierte, zuwei-len unwillige Haltung, wenn es in Morus’ Lebendarum ging, sich in die Verantwortung politischerÄmter einbinden zu lassen. Auch besonderen Il-lusionen hat sich Morus dabei offenbar kaum hin-gegeben. Zu seinem Schwiegersohn William Roperbemerkte Morus einmal über seine Gunst bei Kö-nig Heinrich VIII.: »Seine Gnaden ist mir wirklichein sehr gütiger Herr (…). Wie dem auch sei, SohnRoper, das kann ich dir sagen, ich habe keinenGrund darauf stolz zu sein; denn wenn ihm meinKopf ein Schloss in Frankreich gewänne (…), wür-de er unweigerlich fallen« (Roper, aaO., S. 28).Nichts war Morus mehr zuwider als öffentlich zur
Schau gestellter Prunk. Selbst als Lordkanzler hatMorus in seiner Kirche in Chelsea noch den Chor-rock angelegt, um zu ministrieren (vgl. Peter Ber-glar, Die Stunde des Thomas Morus. Einer gegendie Macht, 3. Aufl., Olten/Freiburg 1981, S. 88).
Munier geriert sich, als hätte er als Erster end-lich den wahren Morus durchschaut. Unklar aberbleibt beständig, woher er seine Kenntnis des his-torischen Morus eigentlich nimmt. Die zahlrei-chen Fehlurteile haben ihre Ursache hauptsächlichin der beachtlichen Souveränität, mit der Munierdie Lücken seiner Argumentation durch Berge vonMutmaßungen und Unterstellungen füllt. Ange-sichts seines Vorhabens ist indes der Verdachtnicht weniger groß, dass er die Quellen auch beibesserem Wissen kaum zur Kenntnis genommenhätte.
Von ganz anderer Seriosität ist dagegen Rib-hegges Erasmus-Beschreibung. Rund ein Vierteldes Buches umfasst der Anmerkungs- und Litera-turapparat (211-272). Das ist nun nicht schlechthinBeleg für Gelehrsamkeit, zumindest aber fürErnsthaftigkeit. Ribhegge ist ein ausgewiesenerExperte, bei dem sich das Spektakel schon auf-grund der Detailtreue verbietet. Er bedient sich ei-ner einfachen, unprätentiösen Sprache; gelegent-lich hätte man sich den einen oder anderen Span-nungsbogen mehr gewünscht. So gesehen ist Mu-nier – das muss man seiner Darstellung lassen – dereindeutig bessere Stilist von beiden. Ribheggeüberzeugt gleichwohl mit breiter und solider Fak-tenkenntnis.
Die politische Karriere des Morus, das wird inRibhegges Buch rasch deutlich, ist der wohl größteUnterschied zwischen beiden Humanisten. Eras-mus (1467-1536) hat sich zeitlebens allen Angebo-ten und Anfechtungen weltlicher und geistigerÄmter verweigert. Noch in einem seiner letztenBriefe, einem Schreiben an den Krakauer BischofPetri Tomicki, berichtet Erasmus vom AngebotPapst Paul III., ihn zum Kardinal zu ernennen.Seine Ablehnung kommentierte Erasmus mit denironischen Worten: »Soll ich armes kleines Lebe-wesen, das sozusagen nur noch einen Tag zu lebenhat, jetzt in den Wettkampf gegen die Müßiggän-ger, die Gewalttäter und die Reichen eintreten, nurum reich zu sterben?« Er werde nicht wie ein Och-se sein Joch freiwillig annehmen. Tomicki sah dieAngelegenheit übrigens völlig anders. In seinemAntwortschreiben bemühte er zahllose Gründe,um Erasmus doch noch zur Übernahme der Kar-
357 Buchbesprechungen 357

dinalswürde zu überreden. Der Brief hat Erasmusnicht mehr erreicht. Er war bereits am 12. Juli 1536in Basel gestorben. Mit dieser exemplarischen Epi-sode (207-209) endet Ribhegges Buch.
Viele alte, tief eingelagerte Gefühle des Miss-trauens sprechen aus den ablehnenden Zeilen desRotterdamers. Erasmus’ Beziehung zur katholi-schen Kirche ist seit seiner Jugend von vielfachenAmbivalenzen geprägt. Der uneheliche Sohn desGoudaer Priesters Rotger Gerard und seinerHaushälterin, der bereits in jungen Jahre beide El-ternteile verlor, trat mit 18 oder 19 Jahren zwar alsNovize in das Kloster der Augustinerchorherrenin Steyn ein und wurde 1492 zum Priester geweiht.Vor allem das rigide asketische Regime im PariserCollège Montaigu, wo Erasmus ab 1495 Theologiestudierte und im Frühjahr 1496 einen Zusammen-bruch erlitt, entfremdeten ihm das Kosterlebenaber zusehends (11-27). Im Jahr 1517 wurde er, in-zwischen Doktor der Theologie, durch päpstli-chen Dispens endgültig von seinem Ordensgelüb-de entbunden (83-84). Anders als Morus machtesich Erasmus auch nie zu einem Parteigänger inden kirchenpolitischen Auseinandersetzungen sei-ner Zeit. So sehr er den Ämterkauf und die Privi-legien der alten Kirchenfürsten anprangerte, sosehr er die Schwerfälligkeit und Absurditäten derspätscholastischen Theologie (nicht zuletzt im»Lob der Torheit«) verspottete, so wenig Sympa-thie hegte er für Luther, seine Anhänger und dieReformation (103-137).
Zu Weltruhm gelangte Erasmus letztlich alleinmit seinen Schriften, die an Gelehrsamkeit undFormulierungskunst ihresgleichen suchen, unddurch ein einzigartiges Netzwerk an Korrespon-denzen, das er mit fast allen europäischen Gelehr-ten und Höfen unterhielt. Überall suchte man sei-nen Kontakt und man hütete Erasmus’ Briefe eitelwie kleine Schätze. Percy Stafford Allen (nicht»John Percy Allen«, wie Ribhegge schreibt, 9) be-gann 1906 mit der Veröffentlichung von Erasmus’Schriftwechsel in der Oxforder Ausgabe »OpusEpistolarum Des. Erasmi Roterodami« (vgl. Eras-mus, aaO.). Es wurde ein Lebenswerk. Der zwölf-te und letzte Band erschien 1958. Insgesamt um-fasst die Edition mehr als 3000 Briefe von und anErasmus. Die Ausgabe liefert heute ein kaum zuübertreffendes Bild der Zustände und Konflikte imZeitalter der Renaissance.
Das ironisch-spöttische Gemüt war Morus wieErasmus aber gleichermaßen eigen. Legendär ist
Erasmus’ Szene, in der er Papst Julius II. nach des-sen Tod in Kriegsrüstung vor der Himmelstür einStreitgespräch mit Petrus führen lässt, weil ihmdieser den Zutritt verweigert (vgl. Erasmus vonRotterdam, Julius vor der verschlossenen Him-melstür, ein Dialog, in: ders., Ausgewählte Schrif-ten, hrsg. v. Werner Welzig, Bd. 5, Darmstadt1968, S. 6-109). In solchen Passagen wusste er sichmit Morus einig. Schon Morus widmete in seiner»Utopia« der kriegerischen und vertragsbrüchigenKirchenstaatspolitik unter Julius II. eine bitterbö-se Satire (vgl. Thomas Morus, Utopia, in: Der uto-pische Staat, hrsg. v. Klaus Heinisch, Reinbek beiHamburg 1996, S. 86). Seine Widmung an Morusim »Lob der Torheit«, das Erasmus bei Morus inLondon niederschrieb und das dem Freund wohlnicht nur wegen der Namensähnlichkeit (griech.mori = Torheit) zugeeignet ist, beschließt Erasmusmit der spielerischen Aufforderung: »Du bist einso vorzüglicher Anwalt, dass du selbst eine be-denkliche Sache erfolgreich vertreten kannst. Lebwohl, beredter und gewandter Freund Morus, undmach die Sache der Moria zu deiner eigenen«(Erasmus von Rotterdam, Das Lob der Torheit.Encomium Moriae. Hrsg. von Anton J. Gail, Stutt-gart 1985, S. 6). Aus dem Spiel wurde Ernst. Eras-mus’ Schrift rief zum Teil erbitterte Kritiker aufden Plan. Unter anderem forderte der LöwenerTheologe Martin Dorp, Erasmus sollte als Wie-dergutmachung ein »Lob der Vernunft« schreiben.In einem langen Brief verteidigte Morus späternicht nur Erasmus und dessen Schrift. Nur wenigeMonate später entstand auch seine »Utopia«. Dortwird die Vernunft wieder und wieder als das ei-gentliche und beherrschende Fundament aller Sit-ten und Institutionen gerühmt, zuweilen ernst, zu-weilen ironisch. Beweisen lässt es sich nicht, aberder Verdacht ist gewaltig, dass sich Morus nichtnur als »Anwalt« des Erasmus verwendete, son-dern auch, dass er mit seiner »Utopia« die eigent-lich dem Freund zugedachte Aufgabe übernom-men hat. Das Verhältnis von Erasmus und Morusjedenfalls, das macht auch die Lektüre der beidenBiografien deutlich, ist für die Interpretation einerVielzahl ihrer Werke noch keineswegs endgültigerschlossen.
Thomas Schölderle
358 Buchbesprechungen 358

Martin THEIN: Wettlauf mit dem Zeitgeist – DerNeonazismus im Wandel. Eine Feldstudie, Göttin-gen: Cuvillier Verlag 2009, 467 S., kart., 39 EUR.
Die Zahl der Aktivisten der Neonazi-Szene hatsich in den letzten Jahren verdoppelt: von über2.000 Anfang der 1990er Jahre auf gegenwärtigüber 4.000. Die Ursachen für diese Entwicklungwill der Politikwissenschaftler Martin Thein in sei-ner Arbeit Wettlauf mit dem Zeitgeist – Der Neo-nazismus im Wandel. Eine Feldstudie herausarbei-ten. Es soll darin um die »Ursachen, Erfolgsbedin-gungen und Charakteristiken« und die daraus »re-sultierende(n) Attraktivitätsmomente für ein sol-ches Denken und Handeln« (S. 3) gehen. Hierbeiwill der Autor – bei Ausblendung des gesamtge-sellschaftlichen Kontextes – nur die szene-interneEntwicklung betrachten, ebendort die ideologi-schen, organisatorischen und strategischen Verän-derungen ins Visier nehmen und einen Vergleichder Neonazi-Szene der 1970er und 1980er Jahremit der der Gegenwart vornehmen. Primäre Da-tenbasis dafür sind 34 Tiefeninterviews mit nochaktiven und ehemaligen Angehörigen dieses La-gers des Rechtsextremismus, wozu auch ein Groß-teil der Führungsriege des Neonazismus gehörte.
Nach der Einleitung mit Ausführungen zu Er-kenntnisinteresse und Fragestellung, Forschungs-stand und Methode finden sich Ausführungen zuden zentralen Arbeitsbegriffen »Neonazismus«und »Rechtsextremismus« sowie zur historischenEntwicklung des Neonazismus in Deutschland.Dem folgen die drei Hauptteile der Arbeit, worinnach den organisatorischen, ideologischen undstrategischen Veränderungen in diesem Teil desRechtsextremismus jeweils für die 1970erund 1980er sowie die 1990er und 2000er Jahre ge-fragt wird. Hierbei geht es um so unterschiedlicheAspekte wie das traditionelle Organisationsmo-dell und die »Kameradschafts«-Strukturen, dieideologische Neuorientierung, die strategischeBinnenfixierung und die Neuausrichtung als ge-sellschaftliche Akteure. Der bilanzierendeSchlussteil unterscheidet dann idealtypisch zweiFormen der Angehörigen dieses politischen Spek-trums: den »traditionellen (westdeutschen) Neo-nazi« (S. 322) und den »Neonazi neuen Typs«(S. 325).
Dementsprechend formuliert Thein als zentra-les Ergebnis seiner Forschungsarbeit »das Aufzei-gen der Existenz eines neune Typs an Neonazi in
Ostdeutschland, dessen Charakteristika sich ele-mentar von dem... klassischen westdeutschen Ak-teur unterscheiden« (S. 325). Diesen definiert erwie folgt: »Unter ›Modernen Neonazis‹ verstehtman Rechtsextremisten, die sich vorwiegend in re-gionalen Kleingruppierungen organisieren und ausstrategischen Gründen ihre vormals primär natio-nalistische Orientierung durch sozialpolitische, ka-pitalismuskritische und lokalbezogene Themenin-halte erweitert haben« (S. 326, kursiv im Original).In diesem Kontext wird auch auf den szeneinter-nen ideologischen Wandel hingewiesen, habe sichdoch insbesondere in Ostdeutschland ein »diffe-renziertes Verhältnis zum historischen National-sozialismus« herausgebildet. Als entscheidendeUrsache für den »Attraktivitätszuwachs« wird die»binnenorganisatorische Neuausrichtung in Formdes Kameradschaftsmodells« (S. 329) ausgemacht.
Die Arbeit von Thein beeindruckt durch dasmethodische Vorgehen: Erstmals liegt hier einewissenschaftliche Studie vor, welche auf Basis vonTiefeninterviews mit zahlreichen führenden Neo-nazi-Aktivisten der Vergangenheit und Gegen-wart erstellt wurde. Deren systematische Auswer-tung wird im Anhang mit den Ausführungen zurMethode gut begründet. Der Autor nimmt darü-ber hinaus auch eine überzeugende Strukturierungbei der Präsentation seiner Ergebnisse vor, wobeieine ideologische, organisatorische und strategi-sche Ebene unterschieden werden. Gleichzeitigverkoppelt er diese Differenzierung der Untersu-chungsfelder mit dem Vergleich des früheren undgegenwärtigen Neonazismus. Hierbei gelingt esüberzeugend, neuere Entwicklungen in diesemTeil des Rechtsextremismus herauszuarbeiten.Thein arbeitet auch in der Gesamtanalyse diewichtigsten Bedingungsfaktoren für den »Attrak-tivitätszuwachs« der Szene auf und gewichtet dieseklar hinsichtlich ihrer Bedeutung (entscheidenderFaktor: Organisationsstruktur).
Diesen Vorzügen stehen aber auch kleinereSchwächen gegenüber: Die zentrale Fragestellunghätte klarer und systematischer – auch und geradehinsichtlich der Gewichtung von Hauptfragestel-lung und Unterfragen – entwickelt werden müs-sen. Bei der Auswertung der Interviews geht derAutor zu wenig auf die subjektive Interessenlageder Befragten ein, was sich an der häufig kritikar-men Rezeption ihrer Aussagen zeigt. Zwar gibt eseinen »neuen Typ« des Neonazis, der sich insbe-sondere in den ostdeutschen Ländern herausgebil-
359 Buchbesprechungen 359

det hat. Aber auch der »alte Typ« kannte durchaus»»sozialpolitische, kapitalismuskritische... The-meninhalte« (S. 329), womit dies kein trennschar-fes Kriterium sein kann. Gleichwohl handelt essich bei Theins Arbeit in der Gesamtschau um einebedeutende Forschungsleistung, die in der syste-matischen Auswertung der Tiefeninterview mit
wichtigen Vertretern der Neonazi-Szene und derproblemorientierten Analyse bezüglich der ideo-logischen, organisatorischen und strategischenEntwicklung auszumachen ist.
Armin Pfahl-Traughber
360 Buchbesprechungen 360
Bitte bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei unter www.nomos-shop.de
Der Triumph der GerechtigkeitWer mit seinen Nachbarn in Frieden lebt, kennt nur seine Rechte nichtEin zeitloses Märchen. Mit Zeichnungen von Imma SetzVon Rudolf Gerhardt2009, 115 S., brosch., 19,– €, ISBN 978-3-8329-5302-7
Rudolf Gerhardt, Jurist und Journalist, beschreibt mit einem „gewissen Lächeln“ den Einbruch des Rechts in Person eines zugezogenen jungen Anwalts in die friedli-che Idylle eines Schwarzwalddorfes, wo die Bewohner bis dahin nicht auf die Idee gekommen waren, sich um Recht und Gerechtigkeit zu streiten. Dass der junge Anwalt auf den verschlungenen Rechtswegen, auf die er seine Mandan-ten lockte, schließlich selbst ins Straucheln gerät, mag als Triumph der Gerech-tigkeit angesehen werden. Am Gerechtesten aber, so Gerhardts Fazit, geht es noch immer dort zu, wo sich die Menschen, gleichsam im Zustand der Unschuld, ums Recht-haben oder Recht-bekommen nicht scheren.
Gisela Friedrichsen, DER SPIEGEL
Ein zeitloses Märchen.