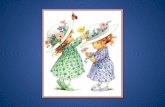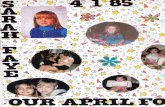Text sarah
-
Upload
mediensprache -
Category
Documents
-
view
414 -
download
1
Transcript of Text sarah

1. Folie: Das Nähe-Distanz ModellPeter Koch und Wulff Oesterreicher stellten das folgende Modell im Rahmen des 1986 erschienenen Text „Sprache der Nähe – Sprache der Distanz: Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte“ vorDie Leistung dieses Modells ist – kurz gesagt – die Abkehr von einer klaren Unterscheidung zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit; eine Äußerung ist nicht immer eindeutig mündlich oder schriftlich, denn es gibt auch Abstufungen.
Eine wichtige Grundlage des Modells ist die Unterscheidung zwischen der medialen und der konzeptionellen Ebene sprachlicher Äußerungen. Eine sprachliche Äußerung kann auf der medialen Ebene entweder graphisch 2. Folie1. Winter (Einblendung)oder phonisch 2. [ˈvɪntər] (Einblendung)stattfinden. In konzeptioneller Hinsicht unterscheiden Koch und Oesterreicher zwischen den Kategorien gesprochen und geschrieben – nicht immer werden Äußerungen sprachlich genauso realisiert wie in schriftlicher Form. Ein Beispiel dafür ist die Verneinung im Französischen. In geschriebener Sprache wird eine Verneinung mit ne eingeleitet, wie in diesem Satz:3. Folie1. il ne faut pas le dire (Einblendung)In der gesprochenen Sprache hingegen findet das ne in diesem Zusammenhang kaum noch Verwendung und auch auf das Personalpronomen wird verzichtet:2. faut pas le dire (Einblendung)Aus dieser Unterscheidung zwischen Medium und Konzeption ergibt sich folgendes Schema:
4. Folie: Medium und KonzeptionDie Äußerung kann auf konzeptioneller Ebene gesprochen oder geschrieben realisiert werden; dies geschieht auf der medialen Ebene entweder in Form des graphischen oder des phonischen Kodes. In der Regel treten die Kombinationen gesprochen und phonisch (z.B. in Form eines vertrauten Gesprächs) sowie geschrieben und graphisch auf (z.B. ein Gesetzestext). Aber es gibt auch andere Kommunikationsformen; ein Vortrag beispielsweise ist ein niedergeschriebener Text, der durch den phonischen Kode realisiert wird.Koch und Oesterreicher stellten fest, dass die Begriffe graphisch, bzw. phonisch klar voneinander abzugrenzen sind: Eine Äußerung kann entweder graphisch realisiert werden oder eben phonisch. Auf der konzeptionellen Ebene ist der Fall weniger eindeutig. Ist beispielweise ein Interview, das in einer Zeitung abgedruckt ist, eher mündlich oder eher schriftlich? Und kann ein Vorstellungsgespräch in gleichem Maße der Mündlichkeit zugeordnet werden wie ein Gespräch unter Freunden?Betrachtet man verschiedene Formen sprachlicher Äußerungen, so wird deutlich, dass nicht alle Äußerungsformen zweifelsfrei der Kategorie mündlich oder schriftlich zuzuordnen sind. Es gibt zahlreiche Zwischenformen. Koch und Oesterreicher veranschaulichen diesen Sachverhalt an folgendem Schema:
5. Folie mit KontinuumHier sind verschiedene sprachliche Äußerungsformen aufgelistet, unter anderem ein vertrautes Gespräch, ein Interview, ein Tagebucheintrag, ein Vorstellungsgespräch, eine Predigt und eine Verwaltungsvorschrift. Über der Linie befinden sich die Äußerungen, die

graphisch realisiert werden, unterhalb solche, die phonisch realisiert werden. Die Äußerungsformen sind in ihrem Verhältnis zu den Endpunkten ‚gesprochen‘, bzw. ‚geschrieben‘ angeordnet. So ist mit einem vertrauten Gespräch der höchste Grad an Mündlichkeit erreicht, während eine Verwaltungsvorschrift der Kategorie der Schriftlichkeit am deutlichsten entspricht. Alle anderen Äußerungsformen sind dazwischen angesiedelt.
Die Anordnung der Äußerungsformen auf dieser Leiste leiten Koch und Oesterreicher aus dem Zusammenspiel verschiedener Kommunikationsbedingungen ab. Wie wir sehen werden, lassen sich die Bedingungen, die gesprochene Sprache ermöglichen, allgemein mit dem Begriff Nähe assoziieren, während die Bedingungen für geschriebene Sprache sich eher durch Distanz auszeichnen. Aus diesem Grund sprechen Koch und Oesterreicher in Bezug auf die Pole gesprochen/geschrieben von einer Sprache der Nähe, bzw. der Distanz.Einige dieser Kommunikationsbedingungen haben wir im Folgenden aufgelistet:6. Folie: Kommunikationsbedingungen1. Einblendung nacheinander: Sprache der NäheDie Sprache der Nähe – also idealerweise ein vertrautes Gespräch - findet als Dialog statt, die Gesprächspartner befinden sich in einer face to face-Interaktion. Sie können spontan auf das reagieren, was ihr Gegenüber sagt und sind frei in der Themengestaltung. Das Gespräch ist nicht öffentlich und die Partner befinden sich gemeinsam in der Situation des Sprechens, d.h. sie haben bestimmte Hintergrundinformationen zum Gesprächsrahmen und befinden sich in demselben situativen Kontext.2. Einblendung nacheinander: Sprache der DistanzDie Sprache der Distanz findet in der Verwaltungsvorschrift ihre extremste Ausprägung. Hier gestaltet sich die sprachliche Äußerung als Monolog; die Rezipienten erscheinen als anonyme Instanz, d.h. sie sind dem Verfasser des Textes nicht bekannt und zudem räumlich und zeitlich von ihm getrennt. Der sprachlichen Äußerung geht eine hohe Reflektiertheit und Planung voraus. Das Thema ist festgelegt und wird öffentlich behandelt. Gemeinsames kontextuelles Wissen ist nicht vorhanden, sondern muss versprachlicht werden.Je nach Kombination dieser Bedingungen ist eine sprachliche Äußerung eher der Mündlichkeit, d.h. der Sprache der Nähe zuzurechnen oder der Schriftlichkeit, d.h. der Sprache der Distanz. Auf diese Weise ergibt sich die Anordnung der verschiedenen Äußerungsformen in dem vorher gezeigten Schaubild. Dieses „konzeptionelle Kontinuum“, so schreiben Koch und Oesterreicher, „ist der Raum, in dem die Parameter sich mischen und damit bestimmte Äußerungsformen konstituieren.“Aus diesen kommunikativen Bedingungen ergeben sich bestimmte Versprachlichungsstrategien. 7. Folie: Versprachlichungsstrategien (Sprache der Nähe)So zeichnet sich die Sprache der Nähe durch eine hohe Prozesshaftigkeit aus; ein vertrautes Gespräch ist ein weitgehend ungeplanter Vorgang, an dem sich die Gesprächspartner wechselseitig beteiligen. Dementsprechend ist die Sprache der Nähe eher simpel strukturiert und hat eine geringe Informationsdichte. 8. Folie: Versprachlichungsstrategien (Sprache der Distanz)Bei einer distanzsprachlichen Äußerung wie einer Verwaltungsvorschrift ist das Gegenteil der Fall. Eine solche Äußerung hat einen endgültigen Charakter. Es findet kein kommunikativer Prozess statt – die Äußerung wurde geplant, hat eine hohe Informationsdichte und ist sehr komplex und kompakt.
Diese Strategien schlagen sich konkret als sprachliche Merkmale nieder. Auf diese sprachlichen Merkmale werden wir im Folgenden genauer eingehen, wenn wir das Modell von Koch und Oesterreicher anhand einer SMS veranschaulichen.