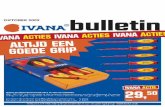SKWJ Bulletin 3 09
description
Transcript of SKWJ Bulletin 3 09

1 | skwj-bulletin 3/09
N O U V E L L E S D E L ’ A S J S
Folgt nach der Gen- jetzt die «Hirnselektion»?
Liebe Mitglieder
Von Irène Dietschi
Man fühlte sich am diesjährigen Gesund-heitsseminar plötzlich zurückversetzt in die 1990er-Jahre, in die Zeit, als die Gen-technologie den wissenschaftskritischen Diskurs dominierte. «Kommt es zu einer Selektion der ‹guten Gene›?», wurde da-mals gefragt, oder: «Werden Menschen mit ‹schlechten Genen› benachteiligt wer-den – im Beruf, in Versicherungsfragen, überhaupt?» Ganz ähnliche Fragen werden auch heute wieder gestellt. Nur geht es diesmal ums Gehirn, genauer um Neuro-Enhance-ment – dies der Titel unseres Seminars – oder Braindoping, wie das Gebiet von den Medien genannt wird. «Es passieren be-reits Fehlentwicklungen», stellte der Psy-chologe Lutz Jäncke (Uni Zürich) in sei-nem Einführungsreferat fest. Als Beispiel nannte Jäncke die Möglichkeit, mittels Hirnscans voraussagen zu können, ob je-mand im Alter dement werde. Das führe zu «Hirnselektion», warnte er. Auch die viel-fältigen Wege, das Gehirn von aussen zu beeinflussen (Magnetstimulation, Implan-tate etc.), gingen zum Teil in eine gefähr-liche Richtung. Relativiert wurde dieser Kassandraruf durch die Ethikerin Davinia Talbot, deren Ausführungen den Schluss der Tagung bildeten: Man sei zum ersten Mal im Begriff, den ethischen Diskurs über eine wissenschaftliche Entwicklung recht-zeitig zu führen. Und das sei eine Chance. Talbot hatte in der Zeitschrift «Gehirn und Geist» ein vielbeachtetes «Memorandum» zum Thema mitverfasst. Was also hat es auf sich mit Neuro-En-hancement? Ist es, wie die Opportunisten behaupten, «menschlich, natürlich und
Bulletin3 | 09 NOVEMBER 2009
www.science-journal ism.ch
Schweizer Klub für WissenschaftsjournalismusAssociation suisse du journalisme scientifiqueSwiss Association of Science Journalism
E D I T O R I A L
erstrebenswert», mit Medikamenten oder anderen Mitteln seine kognitiven Leistun-gen zu erhöhen? Oder gilt eher die Auf-fassung der Calvinisten, wonach wir es beim Braindoping mit einem «Betrug an der menschlichen Natur» zu tun haben? Tatsache ist, dass es zur Zeit kaum Evi-denz für die Wirkung von cognitive enhan-cers bei Gesunden gibt. Glaubt man den (wenigen) Untersuchungen, machen uns weder Ritalin noch Modafinil langfristig zu Besserleistern. Anderseits werden ge-rade diese Susbstanzen weltweit von einer wachsenden Anzahl Leute konsumiert, die nicht an ADHS (Ritalin) oder Narkolep-sie (Modafinil) leiden. «Wir sollten Dop-pelblindstudien nicht allzu sehr vertrau-en», meinte Felix Hasler (Uni Zürich), der in Neuchâtel seinen Selbstversuch mit Modafinil schilderte. Gesichert ist, dass von den Neurowissen-schaften vor allem psychisch Kranke enorm profitieren, zum Beispiel Menschen mit schwersten Depressionen oder posttrau-matischen Störungen. Es erstaunt nicht, dass etwa der in Bonn tätige Berner Psychia-ter Thomas Schläpfer vor allem hier die grösste Chance des Neuro-Enhancements sieht. Doch es stellen sich Fragen: Hat der Mensch eine Seele? Einen freien Willen? Viel Stoff für weitere Diskussionen ...
Après les gènes, le cerveau comme cible de sélection ?
Le thème du Séminaire-Santé de cette année – le Neuro-enhancement ou Braindoping en an-glais – a fait resurgir dans les esprits le débat, au début des années 1990, sur le génie et la sé-lection génétiques. Car déjà pointent des déri-ves : le psychologue Lutz Jäncke (Uni Zurich) a par exemple expliqué comment, à l’aide de l’imagerie cérébrale, il est possible de dire qu’une personne va souffrir ou non de démence. Ce qui pourrait conduire à une « sélection des cerveaux». Toutes ces techniques sont-elles « naturelles et humaines », comme le disent les optimistes ? Ou plutôt « une tromperie de la na-ture humaine », comme rétorque les plus « cal-vinistes » ? D’autant plus lorsque ce sont des personnes saines de corps et d’esprit qui en usent, malgré le peu d’études qui montrent de réels effets dans ce cas de figure. Vastes discus-sions en perspective.
Irène Dietschi
Editorial .................................................1
Nouvel écrin à L’EPFL .......................... 2–5
Gesundheitsseminar 09 ..................... 6–10
Grüne Gentech .....................................11
Wissenschaftskommunikation .......... 12–15
Versteckte Skandale .............................16
EUSJA–Tour ..........................................17
Mutationen / membres ..........................18
Klatsch / en bref / Literatur ............. 18–19
I N H A L T / S O M M A I R E

2 | skwj-bulletin 3/09
N O U V E L L E S D E L ’ A S J SN O U V E L L E S D E L ’ A S J S
Nouvel écrin pour les Sciences de la vie à l’EPFL
Les membres de l’ASJS ont eu le privilège de visiter en exclusivité les nouveaux locaux de l’EPFL qui abritent quatre instituts, 50 groupes et 1200 chercheurs.
Par Olivier Dessibourg
Un édifice tout neuf, nouvel écrin devisé à 64 millions de francs, pour 1200 collabo-rateurs qui n’attendaient plus que lui : l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a inauguré le 2 septembre son nouveau bâtiment des Sciences de la vie. En marge du lancement de section romande de l’Association suisse du journalisme scien-tifique (ASJS), ses membres – une petite vingtaine – ont pu le visiter en exclusivité, juste avant la cérémonie officielle en présence de Daniel Vasella, CEO de Novartis, et du Prix Nobel américain David Baltimore. Ce nouveau lieu de recherche « dernier cri » achève l’accomplissement du virage que Patrick Aebischer, président de l’EPFL, voulait faire prendre à la haute école lorsqu’il en a pris les rênes, en 2000 : ajouter aux compétences reconnues de l’institu-tion dans les domaines des sciences de l’ingénieur celles des sciences du vivant. La nouvelle faculté y réunira en effet quatre instituts, dont l’Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), anciennement établi à Epalinges. Au total, une cinquantaine de groupes de recherches se partageront les locaux, pour certains encore vides, ainsi surtout que des infrastructures qui ont permis d’attirer des sommités mon-diales dans leur domaine de recherche. Comment Patrick Aebischer s’y est-il pris pour les convaincre de rejoindre l’EPFL ? « Lorsque la marée monte, tous les bateaux montent », répond-il en souriant. Autre-ment dit, c’est selon lui simplement la qualité des recherches et des chercheurs pré-sents à l’EPFL qui est vertueuse, et encourage des scientifiques de tous horizons à ve-nir sur les rives du lac Léman. Douglas Hanahan, nouveau directeur de l’ISREC à l’EPFL confirme: « Jusqu’ici, l’ancien ISREC était trop petit et isolé pour profiter des opportunités qui se présentaient. Et parce qu’il était isolé, l’institut essayait de couvrir une vaste gamme de sujets. C’était plutôt un institut de recherche fondamentale. Faire partie de la Faculté des sciences de la vie de l’EPFL va nous permettre d’avoir accès à un grand pool d’experts, nous n’aurons plus besoin d’avoir chaque spécificité en no-tre sein. Nous avons aussi l’intention de fonctionner comme catalyseur, d’utiliser l’ins-titut comme une plate-forme pour organiser la communauté au sens large: l’Université de Lausanne et le CHUV, ainsi que toute la bio-ingénierie et les sciences naturelles qui se font à l’EPFL. Nous voulons créer quelque chose de beaucoup plus grand, qui ait une masse critique suffisante pour être à la pointe dans ce domaine. C’est ce qui m’a décidé à quitter San Francisco », où ce professeur de renommée mondiale officiait à l’Université de Californie. Autre locataire du nouveau bâtiment, Bruno Lemaitre, fraîchement débarqué de France, lui, au nouveau Global Health Institute. Ce chercheur s’intéresse de près aux mécanismes d’infection dans les mouches drosophiles. Pour ses travaux, il dispose de plusieurs laboratoires de haute technicité, dont un de niveau de sécurité 3 (sur une échelle de 4), qu’il a plaisir à faire découvrir aux journalistes tant il en apprécie lui-même chaque jour les fonctionnalités. Quant à l’équipe de Henry Markram, cela fait quelques années déjà qu’elle s’est ins-tallée sur le campus de l’EPFL. Son objectif scientifique, avec le Blue Brain Project : reproduire et simuler en trois dimensions, et à l’aide d’ordinateurs surpuissants, le fonc-tionnement d’une colonne de neurones, autrement dit une brique du système nerveux central, sur lequel il sera ensuite possible de simuler des stimulations externes. Ce pro-jet coûtant très cher, ses collaborateurs ont mis au point, à l’intention des visiteurs qui pourraient apporter de futurs soutiens financiers, une présentation multimédias en trois
EPFL-Biowissenschaften in neuer Umgebung
Ein architektonisches Schmuckstück zum Preis von 64 Mill. Franken und Platz für 1200 Mitar-beiter der Biowissenschaften wurde am 2. Sep-tember an der EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) feierlich eingeweiht. Eine Gruppe der neugegründeten Sektion des ASJS in der Romandie hatte Gelegenheit, exklu-siv das Gebäude zu besichtigen – direkt vor der offiziellen Eröffnung mit Daniel Vasella, Novar-tis-CEO, und dem amerikanischen Nobelpreis-träger David Baltimore.
Olivier Dessibourg

skwj-bulletin 3/09 | 3
N O U V E L L E S D E L ’ A S J S
dimensions ; lunettes bleues-rouges sur le nez, l’on découvre ainsi presque de l’inté-rieur des réseaux de neurones en images de synthèse. Impressionnant ! Dernier institut du quartet des sciences de la vie de l’EPFL, l’Institut de bio-ingé-nierie. L’une de ces expériences phare est celle d’une chaise roulante que son utilisa-teur peut déplacer uniquement par la pensée, à l’aide d’un système de captation des ondes émises par son cerveau et d’un ordinateur qui a appris à les « décoder » pour contrôler les mouvements de l’engin. Le projet est actuellement au début de la phase de développement commercial. Qu’ont en commun toutes ces recherches ? «Elles se situent toutes à l’interface en-tre la biologie et l’ingénierie », explique Patrick Aebischer. Et les sciences de la vie dé-pendent aujourd’hui tellement de la technologie qu’il est essentiel que les deux domai-nes interagissent. « Mais si on ne fait pas prendre le café ensemble à tous ces cher-cheurs, dans un même lieu de recherche, c’est plus difficile… », conclut-il.
Bruno Lemaître, fraîchement arrivé de France, s’est installé dans ses nouveaux locaux du Global Health Institute, où il mène des recherches en infectiologie sur les mouches drosophiles
Pour ses travaux en infectiologie, Bruno Lemaître dispose des équipements dernier-cri, dont un laboratoire de bio-technologie de niveau sécurité 3 (sur 4)
Les chercheurs de l’Institut de bio-ingénierie mettent au point un fauteuil roulant qui peut être commandé unique-ment à l’aide des pensées de son propriétaires

4 | skwj-bulletin 3/09
N O U V E L L E S D E L ’ A S J S
Mittwoch, 2. September 2009, 8 Uhr mor-gens. Ich sitze im Zug zwischen Bern und Lausanne und feile an meinem Text. Auf meinem Schoss liegt ein deutsch-franzö-sisches Wörterbuch, das ich alle paar Se-kunden aufschlage. Was heisst nochmals «Ansprache» auf Französisch? Der Dic-tionnaire gibt vier Möglichkeiten, ich ent-scheide mich für «discours». Und wie de-kliniere ich «stolz» in der weiblichen Form? Natürlich, «fière». Die «Präsiden-tin» ist einfacher, weil mit «présidente» fast gleich wie auf Deutsch. «Le lance-ment» muss ich nicht nachschauen – die «Lancierung» ist schon ein paar Mal im Newsletter vorgekommen, den ich seit Anfang August regelmässig verschicke. Am Schluss steht der folgende handge-schriebene Satz auf dem Papier, hoffent-lich grammatikalisch nicht ganz falsch: «Chers collègues, aujourd’hui c’est la pre-mière fois dans ma vie que je fais un dis-cours en français: Comme présidente de l’association suisse du journalisme scien-tifique je suis très fière d’être ici à Lau-sanne, et je vous félicite au lancement de la section romande de notre club.» – «Lie-be Kolleginnen und Kollegen, heute hal-te ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Rede auf Französisch: Als Präsiden-tin des Schweizer Klubs für Wissen-schaftsjournalismus bin ich sehr stolz da-rauf, heute hier in Lausanne zu sein, und ich gratuliere Euch zur Lancierung der Westschweizer Sektion unseres Klubs.» Das stimmt, ich freue mich sehr auf das Frühstück im Hotel Alpha-Palmier in Lau-sanne, das mein Vorstandskollege Olivier Dessibourg als Willkommen der West-schweizer Kolleginnen und Kollegen or-ganisiert hat. Aber ich bin nervös. Wieviele würden zu diesem Anlass kommen? Und warum, verflixt nochmal, muss meine erste öffentliche Amtshandlung als Präsi-dentin des SKWJ ausgerechnet auf Fran-zösisch stattfinden? Als ich in Lausanne ankomme, ist das Frühstück bereits in vollem Gang. Ich
hätte mir keine Sorgen zu machen brau-chen. Etwa 25 Leute sind gekommen – Virginie vom Radio suisse romande, Isa-belle, die fürs Radio und Fernsehen arbei-tet, Nicolas von Le Temps, Christophe, auch vom Fernsehen, Nancy, seit 30 Jah-ren bei RSR, und viele mehr. Ich schüttle Hände und höre Namen, die ich mir ir-gendwann nicht mehr merken kann. Aber wir kommen schnell ins Gespräch, reden über die ETH Lausanne und deren umtrie-bigen Präsidenten Aebischer, über das neue Life-Sciences-Gebäude, das wir an-schliessend besuchen werden, über die Qualität im Journalismus im allgemeinen und über die Probleme desselben im be-sonderen. Und natürlich fehlt an diesem Anlass auch nicht der «offizielle» Teil, den Olivier und ich gemeinsam bestreiten, er zweifellos in besserem Französisch als ich. Am Schluss ist mir klar geworden: Wir Wissenschaftsjournalisten aus der Deutsch- und Westschweiz müssen zwar Hemmun-gen überwinden, um miteinander zu reden – aber wir sprechen zum Glück doch die gleiche Sprache.
Irène Dietschi am 2. September in Lausanne
Zum Start der Sektion in Lausanne
Seit Anfang September ist es offiziell: Der SKWJ ist nun auch in der Romandie organisiert. Ein paar «präsidiale» Eindrücke vom Gründungsanlass.
Von Irène Dietschi

skwj-bulletin 3/09 | 5
N O U V E L L E S D E L ’ A S J S
Ce 2 septembre 2009, 8h du matin, je suis assise dans le train entre Berne et Lau-sanne, et, avec mon dictionnaire sur les genoux, je fignole mon texte de présenta-tion. Qui, au final, ressemble à cela : «Chers collègues, aujourd’hui c’est la pre-mière fois dans ma vie que je fais un dis-cours en français. Comme présidente de l’Association suisse du journalisme scien-tifique (ASJS) je suis très fière d’être ici à Lausanne, et je vous félicite au lance-ment de la section romande de notre club.» C’est vrai, je me réjouis du petit-déjeuner de bienvenue organisé par mon collègue du comité Olivier Dessibourg. Mais je suis
nerveuse: combien de membres seront là ? Et pourquoi diable ma première interven-tion officielle comme présidente de l’ASJS doit-elle se tenir en français ? Quand j’arrive, l’événement est déjà bien lancé. Quelque 25 collègues sont venus, de tous médias. Je serre des mains, le dialogue s’engage vite, autour de l’EPFL, de son président de son nouveau bâtiment des sciences de la vie que nous allons visiter. Au final, une chose m’est claire : nous, les journalistes scientifiques, alémaniques et romands, devons dépasser notre gêne, car nous parlons finalement tous la même langue.
Premier Atelier « Sciences, médias et société » L’Interface Sciences-Société de l’Univer-sité de Lausanne et la section romande de l’Association suisse du journalisme scien-tifique (ASJS) ont invité les collabora-teurs des médias écrits et audiovisuels à un premier atelier de travail commun sur un dossier important concernant les scien-ces et les technologies. Cette rencontre a eu lieu le 11 septembre et était consacrée au sujet « Nanotechnologies : Environne-ment, Santé et Enjeux de société ». Une vingtaine de collègues sont venus écouter les spécialistes de plusieurs secteurs (cher-cheurs à l’EPFL, représentant de l’OFSP,
du TA-SWISS, ou encore de la Fédéra-tion romande des consommateurs), puis débattre avec eux, avant de poursuivre les discussions autour d’un apéro. Ces rencontres entendent favoriser un dialogue constructif entre les journalistes et les chercheurs dans les domaines des sciences de la nature ou des sciences hu-maines et sociales. En permettant une ré-flexion détachée des urgences rédaction-nelles, ils sont une occasion précieuse pour aborder les grandes questions scien-tifiques contemporaines et leurs dimen-sions sociales et politiques.
Bienvenus, chers collègues !
En septembre l’Association suisse du journalisme scientifique ASJS s’est consti-tuée une section romande. Quelques réflexions «présidentielles» à cette occasion.

6 | skwj-bulletin 3/09
G E S U N D H E I T S S E M I N A R 2 0 0 9
Neuro-Enhancement – Aufbruch in eine schöne neue Welt?
Das diesjährige Gesundheitsseminar fand am 21. und 22. Oktober in Neuchâtel statt. Der Anlass war zugleich ein kleines Jubiläum. Es war das 35. Seminar der Interpharma für unseren Klub – und mit der Thematik «Neuro-Enhancement» wieder voll im Trend. Seitens des Klubs lag die Organisation in den Händen von Sabine Olff und Patrick Imhasly, der das Seminar souverän moderierte.
Von Mürra Zabel
Die Seminarthematik umfasste drei Bereiche: Zunächst ging es um mögliche Metho-den zur Leistungssteigerung des gesunden Gehirns, vor allem in Zusammenhang mit Lernen und Gedächtnis. Dann um Therapien für kranke und traumatisierte Menschen und schliesslich um politische und ethische Fragen im Neuro-Zeitalter. Einen ersten Überblick über die Methoden zur Leistungssteigerung des Gehirns bot Lutz Jäncke (Universität Zürich) in seinem Eröffnungsreferat.
Drogen und LernfähigkeitHinter der saloppen Formulierung Hirndoping verbirgt sich eine von den USA zuneh-mend auch nach Europa übergreifende Form der Leistungssteigerung, die vor allem bei Schülern, Studenten und beruflich stark beanspruchten Menschen beliebt ist. Wer sich unter Prüfungs- oder Arbeitsdruck fühlt, greift zunehmend zu Substanzen, die ur-sprünglich zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen entwickelt wurden: Zur kognitiven Verbesserung etwa schluckt man Donepezil, ein Medikament gegen Alz-heimer. Zwecks Stimulierung greift man zu Ritalin, einem Mittel gegen ADHS, oder nimmt als Muntermacher Modafinil, das eigentlich Menschen mit Narkolepsie wach-halten soll. In den Medien erscheinen zunehmend Berichte über die wohltuende Wir-kung von Ritalin oder über die steigenden Umsatzzahlen von Modafinil, woraus zu schliessen ist, diese Mittel seien leicht zugänglich, über Internet oder andere obskure Kanäle. Denn noch sind dies Heilmittel und damit verschreibungspflichtig. Halte die Tendenz zu pharmazeutischen Hirnboostern an, könnte sich das Arzt-Patienten-Ver-hältnis zu einem Lieferante-Kunden-Verhältnis wandeln. Den Hirn-Forschern stehen bei der Suche nach Möglichkeiten kognitiver Leistungs-verbesserung verschiedene Methoden zur Verfügung, so Lutz Jäncke. Bei pharmazeu-tischem Enhancement unterscheidet er zwischen Wachmachern und Aufputschmitteln einerseits – zu denen er Amphetamin zählt -, und Empathieförderern wie etwa Ecstasy anderseits. Er berichtete weiter über die Methoden von TMS (Transcranial Magnetic Stimulatio) und tDCS (Transcranial Direct Stimulation). Sie können bei Tinnitus, De-pression oder Epilepsie eingesetzt werden, aber auch in nichtmedizinischen Bereichen zur Steigerung von Lernfähigkeit, Motivation und Kreativität. Beunruhigend sei die Vorstellung eines cerebralen Persönlichkeitsprofils, eines «Brainom» – gleichsam das Gegenstück zum Genom -, das mit MRI oder fMRI erstellt werden kann. Brainscree-ning erlaube schon heute, aus Hirnscans Hinweise auf erst in Zukunft ausbrechende Erkrankungen zu erkennen. Lutz Jäncke hat mit Brainscreening-Methoden gearbeitet, sie aber wieder aufgegeben. Er würde sich heute nicht mehr freiwillig in einen Scan-ner legen. Zu viele Informationen seien aus den Bildern ableitbar. Die Forscher sehen sich mit schwierigen ethischen Fragen konfrontiert, etwa wie mit Erkenntnissen über eine spätere Demenzerkrankung gegenüber den Patienten selbst, aber auch gegenüber Arbeitgebern oder Versicherungen umzugehen sei. Es gebe schliesslich auch ein Recht auf Nichtwissen. Das Spezialgebiet des Neuropsychologen Lutz Jäncke ist die Hirnplastizität. Er hat die Wirkung von Musik auf das Gehirn erforscht («Macht Musik schlau?» Huber Ver-lag). Nach jahrelanger Forschungstätigkeit ist er der Überzeugung, das beste Hirndo-ping sei nach wie vor – das Lernen.
Lutz Jäncke
Neuro-enhancement – vers un nouveau monde d’apparat ?
Le Séminaire-santé de cette année s’est tenu les 21 et 22 octobre à Neuchâtel. Il fut l’occasion d’un petit jubilée : c’est le 35e séminaire qu’In-terpharma co-organisait avec notre association – qui plus est autour d’une thématique tout à fait dans l’air du temps. L’organisation, du côté de l’ASJS, a été assurée par Sabine Olff et Patrick Imhasly, qui en ont aussi assuré la modération avec brio. Les documents des conférences du séminaire de santé sont disponible à notre website : www.science-journalism.ch/html/veranstaltun-gen.html. Il manque la conférence de Thomas Schläpfer. Ses données ont dépassé en taille la capacité de notre serveur

skwj-bulletin 3/09 | 7
N O U V E L L E S D E L ’ A S J S
Zu einem ähnlichen Resultat kommt der Neuropsychologe Ralph Schumacher von der ETH Zürich. Er hat verschiedene Studien aus dem englischsprachigen Raum ausge-wertet. Bis jetzt gebe es keine wissenschaftliche Arbeit, die eine pharmakologische oder eine technische «Leistungssteigerung» bestimmter Wirkstoffe bestätige. Die po-sitiven Resultate nach Einnahme von Modafinil bzw. nach Hirnstimulation durch elek-trische Impulse seien einfache assoziative Lernresultate – ohne Wirkung auf komple-xere kognitive Aktivitäten wie Verstehen und Denkfähigkeit. Überdies zeigten sich un-erwünschte Nebeneffekte, da nicht zwischen geplanten und ungeplanten Assoziierun-gen unterschieden werden könne. Auch gebe es keine Langzeitbeobachtungen unter Alltagsbedingungen. Schliesslich könne man ja nicht Versuche mit Kindern oder Stu-denten während konkreter Stressphasen unternehmen. Einzig eine Forschungsarbeit mit zwei Gruppen von älteren Piloten im Flugsimulator-Test lege nahe, dass Donepe-zil deren Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit in kritischen Situationen wie schwie-rigen Landeanflügen verbessern könne. Abschliessend zitierte er das Resultat einer 2008 durchgeführten Studie, wonach alle bisherigen klinischen Versuche zur Steige-rung der Leistungsfähigkeit des Gehirns gescheitert seien oder nur sehr begrenzte Ef-fekte gezeigt hätten.
Effekte von Selbstversuchen Angesichts dieser Informationen waren die Zuhörer gespannt auf die Erfahrungen von Felix Hasler (Universität Zürich). Der Neuropharmakologe beschreibt das 21. Jahr-hundert als «Neuro-Zeitalter». Aus journalistischer Sicht habe die Aufarbeitung des Themas 2003 mit einem Artikel in der ZEIT begonnen. Die damalige Dosis betrug noch «100 Milligramm Arbeitswut» (so der Titel 2003). Sechs Jahre später, im August 2009 wurde im MAGAZIN des Tages-Anzeigers der Bericht eines Ritalin-Selbstver-suches mit (nur noch) «10 Milligramm Arbeitswut» betitelt ... Im Rahmen seiner Forschungsarbeiten hat Felix Hasler verschiedene Drogen in Selbstversuchen getestet. Die Wirkung von Modafinil als «kognitiver Muntermacher» klingt unverfänglich: Lange Zeit habe er nichts gemerkt, nach einiger Zeit aber habe er sich aussergewöhnlich wach, konzentriert und motiviert gefühlt. Seiner Meinung nach könne man mit Modafinil zwar einige Tage 14 oder 16 Stunden arbeiten, doch danach würden Körper und Hirn unweigerlich nach Ruhe verlangen. Modafinil, so Hasler, sei eine «Arbeitsdroge mit wenigen Nebenwirkungen». Als positiven Effekt seiner Selbstversuche verzeichnete er einen Gewinn an Klarheit und die Möglichkeit,
Die Vorträge Gesundheitsseminar jetzt verfügbar
Die Unterlagen zu den Vorträgen des Gesund-heitsseminars können jetzt von unserer Website heruntergeladen werden: www.science-journalism.ch/html/veranstal-tungen.html. Es fehlt der Vortrag von Thomas Schläpfer, da dessen Daten die Kapazitäten un-seres Servers übersteigen.
Felix Hasler, Theres Lüthi, Heinz Müller
«Ich muss eine Art Pilot-fisch sein, um zu entschei-den, ob ein Experiment zumutbar ist.»Felix Hasler über Selbstversuche

8 | skwj-bulletin 3/09
G E S U N D H E I T S S E M I N A R 2 0 0 9
etwas über sich selber zu lernen. Unerwünschte Nebenwirkungen wie Probleme mit dem Einschlafen, über die andere Probanden berichteten, habe er nicht erlebt. Modafinil oder Ritalin sind längst vom Medikament zur Lifestyle-Droge avanciert. Das zumindest lassen die von der Journalistin Theres Lüthi (NZZ am Sonntag) präsen-tierten Auswertungen verschiedener Studien aus USA und Canada vermuten. In den an-gloamerikanischen Ländern sei der Verbrauch lange angestiegen, stagniere neuerdings etwas. Eine ähnliche Entwicklung ist wohl in Europa zu erwarten. So zeigen neuere Zahlen etwa aus Deutschland eine steigende Kurve beim Absatz von Modafinil.
Trauma und Depression Menschen, die Bedrohung durch Tod oder schwere Verletzungen erlebt haben oder Zeugen solcher Situationen für andere Menschen waren, leiden häufig an Posttrauma-tischen Belastungsstörungen PTBS. Symptomatisch sind quälende Erinnerungen, hohe körperliche und seelische Anspannung und ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten. Charakteristisch für PTBS sind neben Albträumen sogenannte Flashbacks: Momente, in denen schmerzhafte Erinnerungen die Betroffenen geradezu überfluten. Beat Lutz (Universität Mainz) beschäftigt sich seit langem mit der Frage, ob posttraumatischer Stress mithilfe von Drogen überwunden werden könnte. Die aktuelle Traumatherapie besteht gemäss Beat Lutz aus einer Kombination von Medikamenten und wiederholter Konfrontation mit den panikauslösenden Ereignis-sen. Die Betroffenen werden immer wieder darauf angesprochen und ermutigt, über das Erlebte zu sprechen. Parallel dazu kommen Medikamente zum Einsatz. Die Be-handlung und ihr Beginn müssen sehr vorsichtig geplant werden. Setze eine Therapie zu früh ein oder erhielten die Patienten Schlafmittel, sei eine Behandlung weniger er-folgsversprechend. Vielversprechend seien neue Forschungen zur Traumabehandlung mit Cannabis-Drogen. Diese Substanzen beeinflussen das Verhalten, indem sie auf Rezeptoren für hirneigene Verbindungen wirken, die sogenannten Endocannabinoide. Diese schützen die Nervenzellen u.a. vor den negativen Auswirkungen von Stresshormonen. Um Äng-ste abzubauen, kommt es in bestimmten Hirnregionen – vor allem in der Amygdala, dem Gefühlszentrum – zur Ausschüttung von Endocannabinoiden. Denkbar sei, dass die endogenen Cannabinoide im «Angstgedächtnis» die furchtbaren Erinnerungen aus-löschen könnten. Mit Gemälden Vincent van Goghs illustrierte Thomas Schläpfer von Universitäts-klinik Bonn das Schicksal von Menschen, die Jahre oder gar Jahrzehnte an schweren
Hennric JokeitDavinia Talbot
«Is the urgency of the debate an angloamerican phenomenon?»Davinia Talbots letzte Frage

skwj-bulletin 3/09 | 9
N O U V E L L E S D E L ’ A S J S
Depressionen leiden. Wenn keine der bekannten Therapien mehr helfe, die Patienten austherapiert seien, könnten vielleicht Neuroimplantate Linderung bringen. Der Neu-ropsychiater Schläpfer berichtet über Erfahrungen mit einer Form der Tiefe-Hirnsti-mulation, die er in Zusammenarbeit mit dem Neurochirurgen Volker Sturm erforscht. Aufgrund der Erfahrungen mit Hirnschrittmachern bei schweren Parkinson-Erkran-kungen implantiert man ausgewählten Patienten mit schweren Depressionen zwei Elek-troden im Kern des zerebralen Belohnungssystems, in den paarweise angelegten Nu-cleus accumbens. Sie regulieren die Aktivität von Nervenzellen. Über Kabel sind die Elektroden mit einem Schrittmacher auf dem Brustmuskel verbunden. Den Patienten bietet diese Methode die Möglichkeit, den Schrittmacher selber zu regulieren bzw. aus-zuschalten. Bisher sind 11 Patienten behandelt worden, die längste Erfahrung beträgt 4 Jahre. Etwa die Hälfte der Patienten spricht positiv auf die Behandlung an.
Ausblick: Neurokapitalismus und eine neue Ethik?Mit einer völlig andersartigen Thematik lenkte Hennric Jokeit das Seminar in eine neue Richtung. Er ist Forschungsgruppenleiter am Schweizerischen Epilepsie-Zentrum Zü-rich. Jokeit vertritt die These, es sei ein so genannter Neurokapitalismus am Entste-hen. Die Depression als Volkskrankheit sei dessen logische Folge. Ähnlich wie die Neurose als Antwort auf die gewaltsame Modernisierung des 19. und beginnenden 20. Jh. zu verstehen sei. Allerdings, so Jokeit, sei die Depression die erste seelische Volks-krankheit, gegen die ein Mittel durch die moderne Neurowissenschaft gefunden wor-den sei. Die Stunde der Neuropsychopharmakologie sei angebrochen, als man den Ur-sprung der Depression «im synaptischen Spalt zwischen Neuronen verortet» habe. Der Markt der pharmakologischen Mittel sei riesig und werde weiter wachsen. In der be-vorstehenden libertären Phase des Kapitalismus werden die durch Enhancer erzielten individuellen Verbesserungen zur höchst begehrenswerten Option. Jokeits spannende These war die ideale Überleitung zu den Überlegungen von Da-vinia Talbot (Universität Münster). Die junge Medizinethikerin hat zusammen mit sechs weiteren Autoren ein Memorandum zum Thema Neuro-Enhancement verfasst. Das Memorandum zu verschiedenen Aspekten einer möglichen gesellschaftlichen Ent-wicklung geht vom deutsche Grundgesetz aus, wonach es das Recht eines jeden ent-scheidungsfähigen Menschen sei, über sein persönliches Wohlergehen, seinen Körper und seine Psyche selbst zu bestimmen (das Memorandum ist in voller Länge auf www.scilogs.de/memorandum veröffentlicht).
Thomas Schläpfer
«Es geht um die Menschen, denen es zu helfen gilt.»Thomas Schläpfer
Rechtliche Situation in der Schweiz
Voraussichtlich im März 2010 werden wir zur Abstimmung über eine neuen Bundeskompetenz beim Schutz der Würde und Persönlichkeits-rechte gebeten. Mit einem neuen Verfassungs-artikel würde der Bund die umfassende Zustän-digkeit zur Regelung der Forschung am Men-schen erhalten. Neben der grundsätzlichen Kom-petenznorm enthält der Artikel Grundsätze, die zum Schutz der Würde und Persönlichkeit der beteiligten Personen erfüllt werden müssen.

10 | skwj-bulletin 3/09
G E S U N D H E I T S S E M I N A R 2 0 0 9
Patrick Imhasly und Beat Lutz
Ralph Schumacher und Sabine Olff
«If there would be a way to get rid of negative emotions by implanting electrodes in the brain – on condition that neither intelligence nor critical reasoning would beimpaired – I would be the first patient?»Dalai Lama zit. nach Thomas Schläfer

skwj-bulletin 3/09 | 11
G E N T E C H
Schwindendes Interesse an der Grünen Gentech
Schweizer Forscher pflanzen Gentech-Weizen, keinen interessiert’s und nie-mand will daran was ändern. Das ist verkürzt das Fazit einer Studie des In-stituts für Publizistikwissenschaften und Medienforschung im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 57 zur Grünen Gentechnik. Mitschuldig an diesem Desinteresse seien insbeson-dere auch die Medien, die dem Thema Grüne Gentechnik in den Zeitungen nur noch wenig Platz einräumen.
Von Christian Heuss
Die Meinungen in der Schweiz sind mehr oder weniger gemacht. 60% der Bevölke-rung lehnten die Grüne Gentechnik in der Landwirtschaft ab. Herr und Frau Schwei-zer wollen keinen Gentech-Soja auf den Feldern und noch weniger Gentech-Food auf dem Teller. Das hat weniger mit wis-senschaftlichen Fakten zu tun, als mit dif-fusen Ängsten, politischen Überzeugun-gen und ökologischen Bedenken. Daran ändern will offenbar niemand etwas: «Alle Interessensgruppierungen in der Schweiz wirken etwas gentechmüde,» befindet Heinz Bonfadelli vom Institut für Publi-zistik- und Medienwissenschaften der Universität Zürich (IPMZ). Und tatsächlich: Die Grüne Gentech-nik wird in der Schweiz in der öffentlichen Diskussion immer mehr zur heissen Kar-toffel: Die Forscherinnen und Forscher scheinen sich auf ihre Forschung konzen-trieren zu wollen. Akzeptanz für diese Technologie zu schaffen, das sei nicht Aufgabe der Wissenschaft, sagt etwa Beat Keller, leitendes Mitglied des NFP 57 und Pflanzenforscher an der Universität Zü-rich: «Wir wollen primär Forschung be-treiben.» Auch die Agroindustrie scheint den Schweizer Markt abzuschreiben. Man habe die Ressourcen nicht, die Bevölke-rung über die grüne Gentechnik und ihren Nutzen zu informieren. Die Industrie sei kein Wohltätigkeitsverein, Bildung gehö-re in die Kompetenz von Schule und Staat. Solche Aussagen aus direkten Befragun-gen von Industrievertretern, zitierte Wer-ner A. Meier vom IPMZ bei der Präsenta-
tion der neuen Studie Anfang Oktober in Zürich. Und auch die Medien verlieren offen-sichtlich zunehmend das Interesse an der Grünen Gentechnik. Im Jahr 2005 – dem Jahr der Moratoriumsabstimmung – er-reichte die Berichterstattung einen Höhe-punkt. Seither ist sie stark rückläufig. Da-bei attestieren die Medienforscher den un-tersuchten Medien (NZZ, Tages Anzeiger, Blick, Le Matin, 24Heures und LeTemps) über den ganzen Zeitraum von fünf Jah-ren eine ausgewogene, qualitativ hochste-
hende und breite Berichterstattung. Eines stellen die Medienforscher in ihrer Studie allerdings fest: Wissenschaftsjournalisten fühlen sich noch immer viel mehr der Wis-senschaft verpflichtet und orientieren sich am wissenschaftlichen Establishment. Kontroverse Themen seien nicht die Sa-che der Wissenschaftsressort, befindet Pu-blizistikforscherin Martina Leonarz. Wis-senschaftsjournalisten fühlten sich wohl-er über Themen zu berichten, die nicht po-litisieren. Irgendwie symptomatisch, aber nicht gerade ein Zeichen von journalisti-scher Reife für unseren Berufsstand im 35. Jahr des SKWJ.
Intérêt faiblissant pour les biotechnologies génétiques
Les scientifiques suisses plantent des champs de blé génétiquement modifié. Cela n’intéresse personne. Et personne ne souhaite en changer. Ce sont, en résumé, les faits saillants d’une étude de l’Institut für Publizistikwissenschaften und Medienforschung, menée dans le cadre du Programme national de recherches PNR57 sur les biotechnologies génétiques. La co-respon-sabilité de cet état de fait en revient aussi aux médias, qui ne font plus beaucoup de place dans leurs colonnes à ce thème.
«Alle Interessensgruppie-rungen in der Schweiz wirken etwas gentechmüde. »

12 | skwj-bulletin 3/09
M E D I E N W I S S E N S C H A F T
Diese Erfolgsgeschichte (des Wissen-schaftsjournalismus AdR) spiegelt sich auch in der Schweiz wider. So verfügen inzwischen alle Schweizer Universitäten über Kommunikationsabteilungen, die meist aus den früheren Pressestellen her-vorgegangen sind. Sie erledigen vielfältige Aufgaben, die Presse und Medienarbeit ist nur noch ein Teilaspekt. Die Univer sitäten haben allesamt bemerkenswerte Eigenpu-blikationen. Die genuine Pressearbeit besteht darü-ber hinaus überwiegend aus (meist un-sichtbaren) Pressekontakten sowie aus (sichtbaren) Medienmitteilungen und Pres sekonferenzen. Von den insgesamt 671 Medienmitteilungen der Schweizer Universitäten im Jahr 2008 galten aller-dings knapp zwei Drittel Fragen der in-stitutionellen Kommunikation, zum Bei-spiel der Hochschulpolitik: Nur 34 Pro-zent der Medienmitteilungen widmeten sich der Wissenschaftsvermittlung. Auf die einzelnen Fachrichtungen be-zogen, rangieren Medizin und Gesundheit, Natur und Umwelt sowie Technik vorne, Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissen-schaften sind dagegen unterrepräsentiert. Wie erfolgreich die Medienarbeit der Schweizer Universitäten einerseits insge-samt ist und wie schlecht die Kommu ni-kationsabteilungen der Hochschulen an- dererseits noch immer ausgestattet sind, lässt sich nicht zuletzt daran ermessen, dass – zum Vergleich – ein einziger grosser Schweizer Pharmakonzern mehr PR- Leute und auch mehr Experten für Medienarbeit beschäftigt als alle Schweizer Unis zu-sammen.
Wissenschaftsjournalismus in der Schweiz Wie sieht es auf der «Gegenseite», also im Journalismus aus? Noch sind die einzel-nen Wissenschaftsredaktionen bei den grösseren Medienunternehmen personell meist stärker als die Uni-Pressestellen. Fast alle grösseren Redaktionen verfügen über eine Wissenschaftsredaktion. Insge-samt ca. 60 Wissenschaftsjournalisten ar-beiten bei den wenigen grösseren Redak-tionen festangestellt, verteilt auf über 40 Vollzeitstellen. Die Redaktionen orientie-ren sich nach Selbstauskunft übereinstim-mend am breiten Publikum, weniger an Wissenschaftlern. Vor allem der Service public setzt auf Wissenskommunikation: In den letzten Jahren wurden die Redaktionen beim Schweizer Fernsehen SF und beim Schwei-zer Radio DRS ausgebaut. Allein beim SF arbeiten 20 Wissenschaftsjournalisten, die sich 10 Stellen teilen, beim öffentlich-rechtlichen Radio sind es sechs Journalis-ten auf 4,7 Stellen. Stabil war im Januar 2009 noch die Lage bei den Zeitungen: Beim Tages-An-zeiger arbeiteten zum Erhebungszeitpunkt sieben Wissenschaftsjournalisten, bei der Neuen Zürcher Zeitung waren es vier fest-angestellte Wissenschaftsjournalisten und eine ständige Mitarbeiterin, bei der NZZ am Sonntag fünf und bei der Sonntagszei-tung vier Wissenschaftsjournalisten. Auch die Schweizer Depeschenagentur (sda) hat eine Wissenschaftsredaktion einge-richtet – übrigens mit finanzieller Unter-stützung der Schweizer Rektorenkonfe-renz CRUS.
Que vise une communication des sciences? Contre quoi se brise-t-elle?
Comment le poids se déplace-t-il entre le jour-nalisme scientifique et les PR-scientifiques? Quelles sont les chances de survie de communi-cation des sciences lorsque le journalisme conti-nue à souffrir de la diminution des ressources et menace de disparaître dans le triangle des Ber-mudes (diminution de la propension à payer de la part des institutions publiques, désertion de la publicité, PR de plus en plus agressives). Cette communication d’ouverture cherche à répondre à ces questions. La situation en Suisse est prise en compte sans toutefois se replier sur nous-mêmes. Elle est une invitation, adressée au chercheur et scientifique, à consacrer plus d’attention au transfert de leurs connaissan-ces
Stephan Russ-Mohl
Wissenschaftskommunikation – Bestandsaufnahme, Probleme, Perspektiven
Was bezweckt Wissenschaftskommunikation? Woran scheitert sie? Wie verla-gern sich die Gewichte zwischen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschafts-PR? Und welche Chancen verbleiben für die Wissen- schaftskommunikation, wenn der Journalismus weiter unter Ressourcenschwund leidet und im Bermu-dadreieck (sinkende Zahlungsbereitschaft der Publika; abwandernde Werbung; immer aggressivere PR) zu verschwinden droht? Diesen Fragen ist der Autor auf-grund einer umfangreichen Recherche nachgegangen. Zitiert werden hier die den Wissenschaftsjournalismus betreffenden Elemente, ausgehend von der erfolgrei-chen Kommunikationsarbeit der Universitäten.
Von Stephan Russ-Mohl, Università della Svizzera italiana

skwj-bulletin 3/09 | 13
N O U V E L L E S D E L ’ A S J S
Aus- und Weiterbildungsangebote zum Wissenschaftsjournalismus und zur Wis-senschaftskommunikation offerieren in der Deutschschweiz das MAZ sowie die Universität Zürich.
Probleme der Wissenschaft s-berichterstattung Auf den ersten Blick scheint also alles «paletti»: Wir haben mehr und besser ausge bildete Wissenschaftsjournalisten, ebenso haben wir mehr und besser ausge-bildete PR-Experten im Wissenschaftsbe-trieb. Noch hat sich kein krasses Ungleich-gewicht zu Lasten des Journalismus her-ausgebildet. Dennoch gibt es eine Reihe von Problemen: Wissenschaftsjournalismus war und ist zuvörderst Berichterstattung über Medi-zin, Naturwissenschaften und Technik. Damit fehlt es an einem festen Platz für die Geistes- und Sozialwissenschaften.
Wir haben die paradoxe Situation, dass in den Redaktionen einerseits weiterhin Naturwissenschaftler, Mediziner, Techni-ker unterrepräsentiert sind; Journalisten mit geistes- und sozialwissenschaftlichem Hintergrund nabeln sich aber andererseits offenbar mehr von ihrer akademischen Sozialisation ab – wohl auch deshalb, weil die Sozial- und Geisteswissenschaften nirgendwo und überall ressortieren. Oft-mals scheinen damit nur ihre skurrilen
V arianten im Vermischten auf, vorzugs-weise in Form von demoskopischen Um-fragen oder Rankings.
Die Wissenschaftsberichterstattung ver-lagert sich hin zum «kontextorientierten» Wissenschaftsjournalismus, was oftmals auch darauf hinausläuft, dass sich die Be-richterstattung auf Schlaglichter und kurze Statements reduziert.
Die Konkurrenz um Aufmerksamkeit nimmt zu. Das bedeutet mehr Sensations-mache und weniger Seriosität – nicht so sehr im «klassischen» Wissenschaftsjour-nalismus als dort, wo ausserhalb des Res-sorts über Forschung berichtet wird.
Wenn Themen wichtiger werden, begin-nen sie, in der Redaktion zu wandern. Der Wissenschaftsjournalist verliert dann z.B. die Zuständigkeit für BSE oder die Schweinegrippe – und wenn sich die Kol-legen aus der Politik oder dem Feuilleton darum kümmern, geht das oftmals mit Kompetenzverlusten einher.
Wenn Forscher von Journalisten zu Statements herangezogen werden, zählt oft mehr deren Medienkompetenz als ihre Forscher- und Fachkompetenz. Wissenschaftsjournalismus wird ten-denziell abgelöst von Wissenschaftsjour-nalismus. D.h. das journalistische Han-deln ist weniger von den Erwartungen der Wissenschaftler, vermehrt dagegen von der Konkurrenz um Publika bestimmt.
Das verleitet beileibe nicht nur in der Bou-levardpresse zu Dramatisierung, Sensati-onalisierung und Tatsachenverdrehung, auch wenn dort immer wieder die ein-drucksvollsten Beispiele aufscheinen. Es kommt auch zu Overreporting, zu Hypes und zu Hysterie – mit sehr realen wirtschaftlichen Folgen für die Betroffe-nen, wie sich am Beispiel der Berichter-stattung über BSE und den Rind fleischverzehr in Deutschland zeigen lässt. Die verschärften Wettbewerbsbedin-gungen verleiten die Medien auch dazu, immer dieselben Forscher zu präsentieren. Die Suche nach Fachkompetenz ist auf-wendig. Meist reicht es ja, wenn irgend-ein Wissenschaftler vor laufender Kame-ra sein 1.30-Statement abgibt – am besten einer, den man in der Redaktion bereits kennt.
Ein Blick in die USA Hinzu kommt, dass sich die Zukunftsper-spektiven eintrüben. Ein Blick in die USA zeigt deutlich, in welche Finanzierungs-Zwickmühle der Qualitätsjournalismus und damit wohl auch die Wissenschafts-berichterstattung hineingeraten. Dort verlieren grosse gedruckte Zeitun-gen in atemberaubendem Tempo ihre Le-ser. Sie wandern scharenweise ins Internet ab – auch, weil es dort alles gratis gibt. Die Werbung wandert zwar mit, aber nicht auf die Websites der Zeitungen. Die ersten grossen, einstmals hochangesehenen Ta-geszeitungen wie die Los Angeles Times, die Chicago Tribune und der Philadelphia Inquirer haben Insolvenz anmelden müs-sen. Es wird erwartet, dass Hochburgen des Bildungsbürgertums wie Boston und San Francisco unter Einschluss des Silicon Valley schon bald ohne grosse Tageszei-tung sein könnten. Die Finanzierungsprobleme des Jour-nalismus führen auch zu Gewichtsver-schiebungen zwischen PR und Journalis-mus. Der Journalismus droht im Bermu-da-Dreieck zu verschwinden, d.h. er gerät von drei Seiten gleichzeitig unter Druck.
Schlussfolgerungen für die Schweiz Was heisst das für die Wissenschaftskom-munikation? Ein paar Thesen:
Im Wissenschaftsbetrieb gilt es, die Wissenschafts-PR zu verstärken und vor
Schweizer Wissenschaftsjournalisten in Aktion

14 | skwj-bulletin 3/09
M E D I E N W I S S E N S C H A F T
allem zu dezentralisieren. Die Forscher selbst, ihre Institute und Fakultäten müs-sen sich um die Wissenschaftskommuni-kation kümmern. Zentrale Kommunika-tionsabteilungen können solche Aktivitä-ten unterstützen, aber nicht ersetzen.
In der Forschungsförderung sind mehr Anreize für Wissenschaftler zu schaffen, damit sie Kommunikation über die Fach-grenzen hinaus nicht als lästige Nebentä-tigkeit, sondern als wichtige Herausforde-rung und zentrale Aufgabe begreifen.
Die Forschung zur Wissenschaftskom-munikation ist zu verstärken. Nach einem Anfangsschub in den 80er Jahren sind hier in der Schweiz leider, anders als in Deutschland, bisher keine kontinuierli-chen Anstrengungen zu verzeichnen. Im Journalismus wären
die kontextorientiete und lokale Wis-senschaftsberichterstattung weiter auszu-bauen;
feste Druck- und Sendeplätze für Sozial- und Geisteswissenschaften zu schaffen;
personell in den Redaktionen dagegen eher die naturwissenschaftlich-technisch-medizinische Kompetenz zu stärken;
mehr auf die Quellenvielfalt und vor al-lem auf die Expertise bei den Forschern zu achten;
Quellen und Berichterstattungsbedin-gungen stärker offenzulegen; und
Forscher öfter mal als «Gegenleser» zu engagieren, die Beiträge auf sachliche Richtigkeit prüfen. Weniger hilfreich sind dagegen Initia-tiven, welche die Trennlinien zwischen PR und Journalismus einreissen und im Bereich der Wissenschaftskommunika-tion zum Teil völlig aufheben:
So schön die Hochglanz-Magazine der Universitäten sind, sie sind so etwas wie die «Gratiszeitungen» aus Wissenschaft und Forschung. Einerseits geben sie einer ganzen Reihe von freien Wissenschafts-journalisten Brot und Arbeit, aber ande-rerseits trocknen sie mit Sicherheit den Markt für journalistisch «unabhängigere» Magazine wie z.B. Geo-Wissen, Bild der Wissenschaft aus.
Auch die Finanzierung der sda-Wissen-schaftsredaktion durch die CRUS ist ei-gentlich problematisch. Wir würden es sicher nicht akzeptieren, wenn Daimler die Autoseite der NZZ oder Novartis die
Medizinberichterstattung der Schweizer Nachrichtenagentur sponsern würden. Hier passiert etwas, das journalistische Glaubwürdigkeit untergräbt. Vor allem bei den universitätseigenen Zeitschriften, aber tendenziell auch mit dem Sponsoring der sda-Wissenschaftsredaktion wird unab- hängiger Journalismus tendenziell durch PR nicht mehr ergänzt, sondern ersetzt – eine Form der Subventionierung, die «ordnungspolitisch» zu hinterfragen ist. Andererseits ist angesichts der Finanzie-rungsnöte der Qualitätsmedien vielleicht gerade solches Sponsoring von Fachpubli-kationen und -redakteuren ein zukunfts - weisender Weg, um hochwertigen Journa-lismus zu sichern. Sofern, wie im Fall der CRUS-Finanzierung, gewährleistet ist, dass keine Eingriffe in die redaktionelle Unabhängigkeit erfolgen und allenfalls das Berichterstattungsfeld, aber nicht die Themen, die Nachrichtenauswahl und der Tenor der Berichterstattung vorgegeben werden, sind solche gewöhnungsbedürf-tigen Finanzierungsformen jedenfalls ei-ner Nicht-Berichterstattung vorzuziehen. Nur: Wird der sda-Redakteur, der weiss, dass die CRUS und die Kommunikations-chefs der Schweizer Uni versitäten dem-nächst über die neuerliche Finanzierung seiner Stelle entscheiden, nicht womög-lich doch in vorauseilendem Gehorsam schweigen, wenn er eigentlich uns, den Publika, etwas Wichtiges mitzuteilen hät-te, was aber möglicher weise seinen Job
gefährdet? Wir sollten vom einzelnen nicht heroische Leistungen erwarten, son-dern lieber Anreizsysteme entwickeln, die keine Selbstverleugnung und kein Han-deln gegen die eigenen In teressen nötig machen. Und was können wir – jeder einzelne von uns Forschern ganz praktisch tun? Jeder Wissenschaftler kann gelegentlich sein Scherflein zum öffentlichen Diskurs beisteuern, wobei sicherlich nicht jedes Wissenschaftsgebiet so «medienattraktiv» ist wie die Weltraum oder die Aids for-schung. Eine besondere Verantwortung für die Wissenschaftsvermittlung sehe ich aller-dings bei den Fachrichtungen, die sich mit öffentlicher Kommunikation befassen und die Journalisten und PR-Experten ausbilden. Hier hätten Forscher und Leh-rende die Chance, gemeinsam mit ihren Studierenden wissenschaftliche Einrich-tungen in ein Recherche-Terrain zu ver-wandeln, indem sie über Forschungser-gebnisse aus ihrem Umfeld berichten. Geht es dabei um eigene Erkenntnisse, so wären diese in Medienmitteilungen zu verwandeln. Wird über die Forschungser-gebnisse von Fachkollegen an Hochschu-len und Forschungseinrichtungen berich-tet, können sich Journalistik-Dozenten und ihre Studierenden direkt wissen-schaftsjournalistisch betätigen. Allerdings entsteht auch hier das Problem grosser Nähe. Wer unter dem Dach derselben
Rosemarie Waldner und Ruth von Blarer

skwj-bulletin 3/09 | 15
N O U V E L L E S D E L ’ A S J S
Institution arbeitet, wird womöglich nicht hinreichend unabhängig sein, um wirklich journalistisch glaubwürdig zu sein. Am European Journalism Observatory (www.ejo) in Lugano versuchen wir seit fünf Jahren einen doppelten Brücken-schlag: Statt mit wissenschaftlichen Pub-likationen nur auf eine Handvoll interes-sierter Fachkollegen zu schielen und nur Bibliotheksregale zu füllen, übersetzen wir Forschungsarbeiten, wenn sie für Me-dienpraktiker interessant sind, in journa-listische Stücke – und zwar für Regional-zeitungen wie den Corriere del Ticino, das St. Galler Tagblatt oder den Berliner Tagesspiegel genauso wie für überregio-nale Blätter, etwa die Neue Zürcher Zei-tung oder für Fachzeitschriften, die von Me dienpraktikern gelesen werden, wie Schweizer Journalist, Message, Werbewo-che oder PR-Magazin. Zuletzt landen diese journalistischen Beiträge dann auf unserer viersprachigen Website – in der Hoffnung, damit auch Brücken zwischen den Journalismus- und Forschungs-Kulturen Europas schlagen zu können. Ansonsten wissen wir ja dank einer gross angelegten Studie aus den achtziger Jahren: Die Membran zwischen
Geistes- und Sozialwissenschaft und Me-dienpraxis ist nicht völlig undurchlässig. Sozial und medienwissenschaftliche Kon-zepte, Wortschöpfungen, Zitate, Bonmots finden nachweislich immer wieder Ein-gang in Kommentarspalten und Journa-listensprache. Nur verläuft dieses trickling down eben ereignisabhängig, unberechen-bar und zufällig. Hier gäbe es allerdings Forschungsbedarf, um der Frage nachzu-spüren, wie sich solche Sicker-Prozesse und -Effekte seither verändert haben, zu-mal mit dem Siegeszug von Internet und Web sich auch in der Wissenschaftskom-munikation vielfältige neue, interaktive Möglichkeiten auftun. Dieser Beitrag hätte seinen Zweck er-füllt, würde er den einen oder anderen For-scherkollegen dazu animieren, etwas mehr Zeit und Gedanken darauf zu verwenden, wie wir unsere Erkenntnisse für die Ge-sellschaft nutzbar machen können. Und vielleicht ja sogar den einen oder anderen Fachkollegen aus der Journalistik, sich unserem Experiment, das ja inzwischen auch ein preisgekröntes Ausbildungspro-jekt ist, anzuschliessen.
Vom Journalismus zur Kommunikation: Roland Schlumpf, früher Tages Anzeiger, jetzt Interpharma
Die vollständige Studie
Der Autor dankt der Schweiz. Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) und Christoph Ammann. Letzterer hat die Re-cherchen zur Ausstattung von Wissenschaftsre-daktionen und Kommunikationsabteilungen der Universitäten in der Schweiz besorgt. Befragt wurden im Januar 2009 21 Print-, TV- und Ra-dio-Redaktionen in der Deutschschweiz. Diese Recherchen wurden freundlicher weise von der SAGW finanziert.Der vollständige Be-richt findet sich auf www.sagw.ch

16 | skwj-bulletin 3/09
D A T E N B A N K - R E C H E R C H E
Skandale verstecken sich manchmal in Datenbergen
Alles wird heute überwacht und kon-trolliert. Dabei fällt eine Menge von Da-ten an. Viele verschwinden in Archiven. Sie können aber interessante Geschich-ten enthalten. In den USA basieren zunehmend Publikationen auf Daten - bank-Recherchen. Auch in Europa fan-gen Journalisten mit dem Computer Assisted Reporting (CAR) an.
Von Lena Stallmach
Eine Erfolgsgeschichte des Computer As-sisted Reporting in Europa ist beispiels-weise die Veröffentlichung der Empfän-ger der EU-Agrarsubventionen. Nachdem einige Journalisten und Aktivisten jahre-lang insistierten und Druck ausübten und gleichzeitig in der EU das Gesetz zur In-formationsfreiheit in allen Mitgliedslän-dern in Kraft trat, sahen sich die EU-Agrarminister gezwungen die Daten of-fenzulegen. 2008 einigten sie sich darauf, die Empfänger mit samt der Höhe der er-haltenen Summe bis Ende April 2009 im Internet zu veröffentlichen. Dort sind die Listen nun einsehbar (z. B. auf www.farm-subsidy.org) und bieten Stoff für verschie-dene Geschichten, etwa wo wer am meisten Geld absahnt – in den meisten Ländern nicht kleine Bauernbetriebe, son-dern wohlhabende Grossgrundbesitzer und grosse Nahrungsmittelkonzerne. In der deutschsprachigen Presse sind Geschichten, die auf Datenbank-Recher-chen basieren, aber noch eher selten. Um dies zu ändern, lud die Organisation Initi-ative Wissenschaftsjournalismus diesen Sommer Journalisten aus verschiedenen deutschen Medien und je einen Vertreter aus Österreich und der Schweiz für einen Kurs nach London ein. Das Ziel war es, den Teilnehmern investigativen Wissen-schaftsjournalismus basierend auf Com-puter Assisted Reporting schmackhaft zu machen. Der Däne Nils Mulvad, der einer der treibenden Kräfte bei der Veröffentli-chung der Agrarsubventionen Empfänger-Listen war, führte in das Thema ein und berichtete von seinen Erfahrungen. Eine kurze Einführung in Excel und Biomedexperts (www.biomedexperts.com), mit dem man die Netzwerke von Forschern
analysieren und herausfinden kann, wer mit wem am meisten publiziert hat, gab einen Vorgeschmack, was für ein Poten-zial diese Programme haben. Auch die Anwendung des Informationsfreiheitsge-setzes – in der Schweiz das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Ver-waltung – war ein Thema. Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz sind die Gesetze 2006 in Kraft getreten und ge-ben jedem Bürger das Recht, Einsicht in Dokumente der Bundesbehörden zu ver-langen. Sie bilden damit die Vorrausset-zung für die Daten-Recherche. Der Kurs gab einen interessanten Ein-blick in eine ganz neue Art von Journalis-mus. Die meisten Teilnehmer zeigten sich sehr motiviert, die vorgestellten Metho-den einmal auszuprobieren. Allerdings hatte man nach dem zweitägigen Kurs nur eine vage Vorstellung von der Vorgehens-weise. Den meisten blieb es ein Rätsel, wie und wo man vielversprechende Da-tensätze finden kann und was man damit anstellen kann. Nun war Ausprobieren an-gesagt, es wurde ein Blog eingerichtet, auf dem die Teilnehmer ihre Fortschritte, Pro-bleme und Tipps austauschen konnten. An einer zweitägigen Fortsetzung des Kurses im September in Hamburg wurde die An-wendung der Programme weiter vertieft. Zudem berichteten einige, die in der Zwi-schenzeit mit CAR-Methoden recher-chiert hatten, von ihren Erfahrungen und zeigten erste Ergebnisse. Weitere Beispie-le präsentierte das Regiodata-Team der Deutschen Presse-Agentur. Die Gruppe hat sich darauf spezialisiert Daten und Statistiken für die Lokalpresse aufzube-reiten. Sie liefern damit die Informationen für Geschichten über regionale Unter-schiede beispielsweise in der Müllproduk-tion, Luftverschmutzung oder der ärztli-chen Versorgung. Sowohl Nils Mulvad als auch die Mit-arbeiter von Regiodata vertreten die Mei-nung, das man in praktisch jedem Daten-satz interessante Geschichten finden kann, wenn man die richtige Herangehensweise hat. Allerdings ist es auch eine sehr zeit-aufwendige Art der Recherche und solan-ge man keinen Hinweis oder Verdacht hat, macht es wohl wenig Sinn in irgendwel-chen Datenbanken nach möglichen Skan-dalen zu suchen.
Nützliche Links
Die Initiative Wissenschaftsjournalismus ist an der TU Dortmund angesiedelt, sie bietet Weiter-bildungsprogramme und Vernetzungsmöglich-keiten für Wissenschaftsjournalisten in Deutsch-land an und wird von der Robert Bosch Stiftung, dem Stifterverband für die Deutsche Wissen-schaft und die BASF SE finanziert. www.initiative-wissenschaftsjournalismus.de/
und der Link von Regiodata:www.dpa.de/dpa-DataReporting.197.0.html und die Website von Nils Mulvad:
www.kaasogmulvad.dk/english
Des scandales se cachent parfois sous les montagnes de données
Tout, aujourd’hui, est surveillé et contrôlé. Ce qui génère une quantité de données. Il n’est pas rare que ces archives disparaissent, et ne soient plus consultées par personne. Des histoires in-téressantes et autres scandales pourraient pour-tant bien s’y cacher ; il suffirait seulement que quelqu’un se donne la peine de rendre ces infor-mations accessibles. Aux USA, de plus en plus d’articles se basent sur des recherches dans des bases de données. En Europe aussi, des journa-listes commencent à utiliser le Computer Assis-ted Reporting (CAR). Pour ce faire, une bonne partie du travail se base sur la mise en en for-me de données à l’aide de logiciels idoines, com-me Excel, ou des programmes d’analyse en ré-seau.

skwj-bulletin 3/09 | 17
E U S J A
Wir europäischen JournalistInnen waren für einen Zweitages-Besuch eingeladen, nachdem dieses Jahr ein Artikel in der ita-lienischen Presse erschienen war, mit ei-nem Titel des Inhalts «der verloren ge-glaubte Forschungspark feiert sein 50-Jah-resjubiläum». Das hatte Stephan Lechner, den Direktor in Ispra seit 2007, EX-Sie-mens IT-Sicherheitsfachmann und Leiter des IPSC (Institute for the Protection and Security of the Citizen) doch geärgert, denn das JRC unternimmt vieles, um die nützlichen Forschungsarbeiten bekannt zu machen. Wir besuchten die Kernzone mit den naturwissenschaftlichen Experimenten. Hier sind die Strassennamen nach Län-dern benannt. Allerdings verpassten wir ob der Parkgrösse doch einiges (z.B. An-lagen zur Erforschung der Solarenergie). Zum Areal gehören eine sogenannte Nord-zone mit Infrastruktur, die Westzone mit Logistik und Diensten, die Südzone mit Administration und Zugang und eine Ex-trazone mit Wohnungen, Parkplätzen etc. In der einmal jährlich dem Publikum ge-öffneten Ostzone sieht der Besucher nur die inzwischen stillgelegten Nuklear- und Fusionsenergieanlagen (Euratom 1957 bis 1973). Die Fülle der Referate war überwälti-gend, und dabei hat jeder sich aus Zeit-gründen wirklich auf das wesentlichste konzentriert, beginnend mit Informatio-nen zur Sicherheit im Transport (EC-CAIRS), zur Sicherheit im Umgang mit Digitaler Geschwindigkeitserfassung,Da-
tamining via open source (http://emm.newsbrief.eu/) und zum Krisenmanage-ment, auch Konkretes aus der Front an-hand von Pass- und Zugangskontrollen. Vollbeladen mit Informationen konn-ten wir kurz die sanften Wellen am Ufer der Hotelanlage geniessen, bevor es bei Sonnenuntergang per Boot zum Abendes-sen ins Ristorante Unione auf der Isola dei Pescatori ging.
Austausch mit europäischen Kollegen
Mit schon bestehenden Daten können für Afrikas entlegene Gebiete Wasserfluten vorausgesagt werden
Forschung in Europa
Von einer EUSJA-Reise nach Ispra in Norditalien berichtet Diana Hornung. Dort befindet sich eines der Joint Research Center der European Commission.
Bericht für SKJW von Diana Hornung
Das Joint Research Center
Das JRC ist in verschiedenen Ländern mit ver-schiedenen Schwerpunkten tätig (Überblick auf http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id= 5270). Es umfasst folgende Forschunsgsberei-che: Institute for Reference Materials and Mea-surements in Belgien, Institute for Energy in Holland, Institute for Transuranium elements in Deutschland, for the Protection and the Securi-ty of the Citizen, Prospective Technological Stu-dies in Spanien und eben in Norditalien in Isp-ra drei Bereiche mit fast 900 Mitarbeitern: Ins-titute for Health and Consumer Protection und Institute for Environment and Sustainability.

18 | skwj-bulletin 3/09
M U T A T I O N E N / M U T A T I O N S K L A T S C H / E N B R E F
Beim Gesundheitsseminar vor drei Jahren standen Tropenkrankheiten im Mittel-punkt der Diskussion. Das Seminar hat Klubmitglied Mechthild Regenass-Klotz inspiriert. Die Molekularbiologin hat wei-terrecherchiert und alles zu Papier ge-bracht. Jetzt ist im Birkhäuser-Verlag das Resultat erschienen: «Tropenkrankheiten und Molekularbiologie – Neue Horizon-te» heisst das Buch (24.95 Euro). Schade nur, dass als Veranstalterin des Gesund-heitsseminars die Interpharma angegeben wird und nicht der SKWJ.
Mark Livingston neu Redaktionsleiter von «Rendez-vous»/«Info3» bei DRS Auf Anfang 2010 übernimmt der 38-jähri-ge Mark Livingston die Leitung der Redaktion «Rendez-vous»/«Info3» von Schweizer Radio DRS. Livingston (ehema-liges Vorstandsmitglied des SKWJ) war bisher Produzent des «Rendez-vous», zu-vor arbeitete er als Wissenschaftsredaktor bei SR DRS. Davor war er bei diversen Zeitungen und Zeitschriften tätig. Zuvor hatte er an der ETH Zürich ein Studium in Umweltnaturwissenschaften absolviert. Mark Livingston löst in seiner neuen Funktion Elisabeth Pestalozzi ab, welche in die Bundeshausredaktion wechselt.
Seit kurzem ist auch Thomas Müller bei Schweizer Radio DRS als Produzent der Sendung «Rendez-vous» am Mittag tätig. Auch er ist ein ehemaliges Vorstandsmit-glied unseres Klubs. Zusammen mit Mark Livingstone arbeiten jetzt schon zwei Wissen schaftsjournalisten in einem der Hauptgefässe des Radios – die Unterwan-derung schreitet voran.
Wachstum durch Innovation«Maximale Innovation – durch Manage-ment by Conversation». Autor Roger Aeschacher (SKWJ-Mitglied) räumt in seinem Buch radikal mit Vorurteilen und Misswissen im Bereich Kreativität auf. Als Künstler mit Diplom und Wissenschaftler mit Promotion hat er erfahren, dass es eine Kunst ist, kreative Menschen an eine Unternehmung zu binden. Er schlägt eine neuartige Managementmethode vor: «Mana gement by Conversation». Mehr zum Buch direkt bei Dr. Roger Aeschacher über [email protected].
Prix RadioLe prix des médias SSR SRG idée suisse dans la catégorie «radio» a été décerné cette année à la contribution «Précau-tions anti-dpoage», de la journaliste Lau-rence Bolomey, diffusée le 2 juillet dans le Journal du matin sur la RSR. Alors que le joueur de tennis français Richard Gas-quet, accusé d’avoir pris de la cocaïne, comparaissait devant le Tribunal de la fé-dération internationale de tennis, Lau-rence Bolomey a su, par une enquête ra-pide et bien ficelée, jeter un éclairage ori-ginal sur un aspect méconnu du circuit professionnel. Dans ce monde sans pitié, les joueurs doivent apprendre à se méfier de tout, y compris d’une bouteille encore à moitié pleine dans leur chambre d’hô-tel, pour ne pas risquer de se trouver pris, bien malgré eux, dans les filets d’une af-faire de dopage.
Prix Suva des MédiasLe jury décerne le 1er prix à Mario Fossati. Il récompense son reportage diffusé dans l’émission «36,9°» de la TSR, le 18 février 2009. Le mal de dos, 9 personnes sur 10 en souffrent au moins une fois dans leur vie. Pourtant, dans la majorité des cas, les médecins peinent à en identifier la cause précise. Mal soigné, un banal lumbago peut devenir un enfer. L’idée de bouger son dos pour ne pas le perdre semble tor-dre le cou à certains préjugés. Un acces-sit revient à Sophie Gertsch et prime son reportage diffusé dans l’émission Place-bo de Canal Alpha, en février 2009, sur l’incontinence féminine.
«Visuelles Gedächtnis» aus sieben Millionen FotosDer Medienkonzern Ringier hat sein phy-sisches Bildarchiv dem Staatsarchiv Aar-gau übergeben. Die Sammlung, die sieben Millionen Fotos aus dem Zeitraum von 1930 bis 1999 umfasst, ist das grösste Bildarchiv der Schweiz und gilt als «Bil-derschatz». Für die journalistische Arbeit wird dieses Archiv – wenn es dann einmal zugänglich ist – eine Quelle von unschätz-barem Wert bei historischen Recherchen sein.
Ordentlich• Sandro Buss Après une formation d’ingé nieur en environnement, il a obte-nu à l’EPFZ un doctorat à l’Institut des sciences de l’atmosphère et du climat. Il est directeur technique et scientifique des Editions POLYMEDIA MEICHTRY SA. Il collabore aux revues suivantes: «La Re-vue POLYTECHNIQUE», «Sécurité En-vi ronnement» et «Oberflächen Polysur-faces». Il a effectué des mandats de recher-ches et développement à MeteoSwiss, à Zurich et à l’aéroport de Kloten, ainsi qu’auprès du réassureur Swiss RE .
• Nicolas Dufour est journaliste à la rub-rique «Suisse» du quotidien Le TEMPS, où il s’occupe notamment des questions de politique universitaire et de la recherche en Suisse et en Europe. Il collabore entre au-tres aux pages Sciences&Environnement et Innovation & Technologies du TEMPS. Passionné de séries TV – il a contribué à un livre collectif sur le sujet –, Nicolas Dufour fut l’un des créateurs de Fréquence Bana-ne, la radio du campus lausannois (Univer-sité de Lausanne et EPFL). Il a commencé sa carrière de journaliste au Journal de Genève et Gazette de Lausanne.
• Christoph Keller, M.A. iur, Redaktor im Ressort Gesellschaft bei DRS2, lang-jähriger Mitarbeiter beim MAGAZIN des Tages Anzeigers, zahlreiche Publikationen u.a. zu Themen der Gen- und Biotechno-logie, der Umweltpolitik sowie der Ethik, wissenschaftliche Tätigkeit im NFP 51 «Integration und Ausschluss», freischaf-fender Autor, Vorstandsmitglied Verein zur Förderung einer Menschenrechtsins-titution Schweiz, Dozent an der Universi-tät Basel, der Schweizer Journalistenschule MAZ und an der Zürcher Hochschule der Künste.
Ausserordentlich• Fernanda Costa dos Santos-Wüthrich ist Doktorandin an der Uni Wien/Öster-reich. Sie studiert bei Prof. Dr. Thomas Bauer und arbeitet als Journalistin und Buchautorin bei VS Verlag (DE). Zur Zeit schreibt sie an ihrer Dissertation.
Adressänderungen: Bitte immer schnell an das Sekretariat.

skwj-bulletin 3/09 | 19
L I T E R A T U R
Eins zu hundert«Lerne die Regel, um sie richtig zu bre-chen!» Das ist das Motto von Achim Dun-ker, Diplom-Fotoingenieur, Filmemacher, Hochschuldozent und Buchautor. Nach seinem Meisterwerk über die Lichtgestal-tung bei Film und Fotographie («Die chi-nesische Sonne scheint immer von unten») ist jetzt ebenfalls im Konstanzer UVK-Ver-lag ein neues Werk erschienen: «Eins zu hundert – Die Möglichkeiten der Kame-ragestaltung» (sFr. 33.-). Das Buch rich-tet sich an Video- und TV-Journalisten, ist aber auch ein Einführungswerk für Foto-grafen. Auf zweihundert Seiten arbeitet Dun-ker Schritt für Schritt auf das perfekte Bild hin. In den ersten Kapiteln werden die ver-schiedenen Einstellungsgrössen diskutiert – vom Panorama bis zur Detailaufnahme. Und genau hier unterscheidet sich Dun-kers Buch von anderen Werken: Als Foto-ingenieur alter Schule erklärt Achim Dun-ker, wie sich Brennweite und Bildwinkel gegenseitig beeinflussen. Das findet man heute in den meisten Büchern nicht mehr. Mit besonderer Spannung wurden aber die Kapitel über die Bildwahrnehmung und die Lichtgestaltung erwartet. Und Achim Dunker enttäuscht nicht. Auf meh-reren Seiten erläutert der Autor, wie das Sehen funktioniert. Fliessend wechselt er anschliessend von der Physik zur Kultur, denn von der Malerei könne man viel ler-nen, beispielsweise, wie Rembrandt Gor-don Willis («Der Pate») beeinflusste oder Caravaggio den Kameramann Vittorio Storaros («Der letzte Tango in Paris»). Der «Rembrandt-Stil», so erklärt Dunker, könne erreicht werden, «wenn ein einzel-ner Scheinwerfer direkt von oben auf den Kopf scheint, sodass die Augen gerade so eben ins unergründliche Dunkel abtau-chen können». Der «Caravaggio-Stil» hingegen setze auf einen hartfokussierten Scheinwerfer. Spannend am Buch ist aber auch der Praxisteil, in dem Kameraope-rateure von ihrer Arbeit berichten; Antho-ny Dod Mantle (Kamera-Oscar 2009) be-richtet zum Beispiel, wie ihn der Film «Vom Winde verweht» beim Dreh von «Slumdog Millionaire»beeinflusste. Michael Breu
Ethik und RechtIm Gesundheitsseminar 2009 konnten ethische Fragen in einem «Neuro-Zeital-ter» nur angesprochen werden. Doch wer-den die künftigen Entwicklungen zweifel-los ethisch-rechtliche Fragen aufwerfen bzw. verstärken wie etwa das Thema Tier-versuche. Schon 2006 ist ein Buch er-schienen, das sich mit dem Recht nicht-menschlicher Lebewesen und den Eigen-rechten der Natur beschäftigt: «Rechts-schutz für nichtmenschliches Leben. Der moralische Status des Lebendigen und seine Implementierung in Tierschutz-, Na-turschutz- und Umweltrecht» (Nomos Ver-lag, Baden-Baden). Der Autor, Jurist Mal-te-Christian Gruber, ist ebenfalls Heraus-geber einer Buchreihe «Beiträge zur Rechts-, Gesellschafts- und Kulturkritik», in der jährlich ein Band erscheint. Der Ju-biläumsband zum Thema «Plagiate und Fälschungen» zum 10jährigen Bestehen erscheint im Frühjahr 2010. Diese kriti-sche Reihe hat ihre Wurzeln in der Schweiz: sie wurde 1996 von Dr. Gisela Engel (J.W. Goethe-Universität Frankfurt/M) nach ei-nem Seminar im Bildungszentrum der Stif-tung Salecina (Maloja/Schweiz) begrün-det. In Salecina fanden früher jeweils im Sommer interdisziplinäre Tagungen zur
Gesellschafts- und Kulturkritik statt. In-zwischen finden diese Veranstaltungen in der Universität von Frankfurt am Main statt und stehen auch Interessierten und Autoren verschiedener Fachgebiete aus der Schweiz offen. Weitere Informationen: Unter www.kritische-reihe.de und für das gesamte Buchprogramm: www.trafoberlin.de. (za)
Dank an Heinz Müller für die Organisation des 35. Gesundheitsseminars
Illustrationen dieser Ausgabe:Anna: Seite 11 / Olivier Dessibourg: Seiten 3, 4 / Hughes Siegenthaler: Seite 5 / Mürra Zabel: Seiten 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19 / zVg: Seite 12

Bulle
tin
3 |
09
N
OV
EMB
ER 2
00
9
ww
w.s
cie
nce
-jo
urn
ali
sm.c
h
Schw
eiz
er
Klu
b f
ür
Wis
sensc
haf
tsjo
urn
alis
mus
Ass
oci
atio
n s
uis
se d
u j
ourn
alis
me s
cienti
fique
Swis
s A
sso
ciat
ion o
f Sc
ience
Journ
alis
m
P.P.CH-8021 Zürich
Der
Vor
stan
d
Irèn
e D
iets
chi
Präs
iden
tinFr
eie
Jour
nalis
tinK
irchg
asse
17
4600
Olte
nTe
l. 06
2 20
7 00
18
irene
.die
tsch
i@bl
uew
in.c
h
Han
na W
ick
Sekr
etar
iat
Red
akto
rin N
ZZN
eue
Zürc
her Z
eitu
ngFa
lken
stra
sse
1180
21 Z
üric
hTe
l. 04
4 25
8 12
13
h.w
ick@
nzz.
ch
Mür
ra Z
abel
Bulle
tin R
edak
tion
Red
akto
rin 3
sat /
SF
Post
fach
8052
Zür
ich
Tel.
079
446
58 4
9za
belm
@bl
uew
in.c
h
Oliv
ier D
essi
bour
gJo
urna
liste
scie
ntifi
que
LE T
EMPS
Av.
Lou
is-R
ucho
nnet
22
1003
Lau
sann
eTe
l. 02
1 31
1 35
70
oliv
ier.d
essi
bour
g@le
tem
ps.c
h
Mar
cel H
ängg
iFr
eier
Jour
nalis
tH
ofst
rass
e 16
8032
Zür
ich
Tel.
044
586
39 2
3in
fo@
mha
engg
i.ch
Chr
istia
n H
euss
Red
akto
r Wis
sens
chaf
tSc
hwei
zer R
adio
DR
SPo
stfa
ch40
02 B
asel
Tel.
061
365
33 9
7ch
ristia
n.he
uss@
srdr
s.ch
Patr
ick
Imha
sly
Red
akto
r Wis
sen
NZZ
am
Son
ntag
Post
fach
8021
Zür
ich
Tel.
044
258
14 1
7p.
imha
sly@
nzz.
ch
Sabi
ne O
lffR
edak
torin
Wis
sen
Sonn
tags
zeitu
ngW
erds
trass
e 21
8021
Zür
ich
Tel.
044
248
46 3
6 sa
bine
.olff
@so
nnta
gsze
itung
.ch
Impr
essu
mB
ulle
tin d
es S
KW
JR
edak
tion:
Mür
ra Z
abel
Layo
ut: R
itz &
Häf
liger
, Bas
elD
ruck
: Sih
ldru
ck A
G, 8
021
Züric
h
Adr
essä
nder
unge
n:B
itte
an d
as S
ekre
taria
t