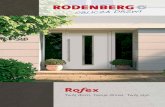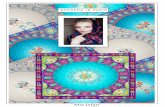s (12)
-
Upload
mica-brljotina -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of s (12)

Prevođenje možemo smatrati nekom vrstom transkulturalne komunikacije, s obzirom na to da je to jedan dinamični proces vezan za socijijalno opštenje i jezike dvejeu kultura. Govoriti drugim jezikom, znači staviti se u poziciju kao da dolazimo iz te zemlje.
.
1 Verstehensprozesse und Verstehensoperationen
Das Verstehen des AT vollzieht sich im Interpreten, hier dem Übersetzer, der sich sowohl die Individualität des Textes als auch dessen Einbettung in ein Gefüge von sprachlichen Funktionen, Textsorten, -gattungen, -konventionen sowie den konkreten Lebensbezug erschließt. Voraussetzung zum Verstehen ist, daß er die textuelle Information in seine eigenen Wissens- und Handlungsstrukturen, das Fremde in das Vertraute, die Andersheit eines Textes - die auf zeitlicher, kultureller und/oder sprachlicher Ferne beruhen kann - in die eigene Textwelt integrieren kann. Der Standort und das Interesse des Übersetzers determinieren wesentlich das Verstehen. Der AT ist also kein objektiv und unveränderbar gegebenes Objekt, da ihm der Übersetzer auf Grund seines unterschiedlichen kulturellen Vorwissens und historischen Standpunktes einen Sinn verleiht und auf seine Empängersituation hin adaptiert. Als Ergebnis der Sinnkonstruktion soll sich ein kommunikativ konsensfähiges Verstehen herausbilden. Inwieweit in bestimmten Handlungszusammenhängen eine kommunikative Notwendigkeit zum expliziten Ausdruck vorliegt, um einen Konsens herbeizuführen, mag an folgender Übersetzung eines französischen Satzes gezeigt werden: "Caractéristique pour lui était un certain savoir vivre", 'Typisch für ihn war ein gewisses savoir vivre, eine den Franzosen zugeschriebene Lebensart'. Die Formulierung des ZT-Satzes überbrückt eventuelles Nichtverstehen dadurch, daß sie die Perspektive des deutschen Rezipienten berücksichtigt.
Der Übersetzer liest den AT mit bestimmten Intentionen und Einstellungen und vergleicht die dort real oder imaginiert dargestellte Lebenswelt mit seiner eigenen, indem er sein sprachliches wie auch sein Weltwissen aus dem Gedächtnis abruft. Auf das Bewußtsein von historisch-kultureller Distanz zwischen Produzenten- und Rezipientensituation folgt das Bewußtsein der unterschiedlichen Voraussetzungen, Hintergründe, SkopoÔ der jeweiligen Textproduktion. Je mehr die Voraussetzungen von AT- und ZT-Produktion, wie z.B.
Sprachstand (unterschiedlicher Formenbestand, andere Gattungen etc.) Relevanz von sprachlichen Äußerungen in gegebener Situation Traditionen, Normen, gesellschaftliche Entwicklung etc. AT- und ZT-Situation Pragmatisch-kohärente Deutung von Handlungsabfolgen Einordnung von Ereignissen in ein kulturelles bzw. gesellschaftliches Gefüge
voneinander abweichen, umso schwieriger ist das Verstehen. Für den Übersetzer bedeutet Verstehen ja immer, Verstehen von etwas und für jemanden, ist also aktives Geschehen. Verstehen impliziert immer schon die Anwendung. Jeder Übersetzer wird also strategisch vorgehen und sich etwa folgende Fragen stellen: Wie ist der AT strukturiert? Was wollte der Text im alten und was will er im neuen Zusammenhang? Was ist sein Sinn in gegebener historischer Situation? Was ist für den deutschen Rezipienten von Belang, welche Themen, welches Wissen, welche Informationen und in welcher Form? Es bringt wenig oder nichts ein, sich Konventionen, die zu gewissen Zeiten gelten, unter veränderten Voraussetzungen zu unterwerfen. Auf Grund der neuen Rezeptionsbedingungen kann als Verstehensstrategie formuliert werden:
1. Verstehen des AT und seiner Entstehungsbedingungen (Ort, Zeit etc.)2. Kohärentes Textverstehen unter Übersetzungsbedingungen als Voraussetzung einer Translation3. Funktionales Textverstehen im Hinblick auf und aus der Sicht des Rezipienten.

Der Verstehensprozeß ist also ein interaktiver Prozeß, da er unter Einbeziehung der bereits vorhandenen sprachlichen wie nichtsprachlichen Wissenstrukturen vor sich geht und in eine neue Sinnkonstruktion mündet.2 Das methodisch-rekonstruierende Verstehen, das die fremdkulturelle Lebenswelt zu begreifen sucht, stellt den Zusammenhang von textimmanenten mit kommunikativen Strukturen, Inhalten etc. und das Zusammenspiel von Sinnzuweisungen zum Text mit dem rezipienteneigenen Voraussetzungssystem bzw. mit der Situation her. Im folgenden wollen wir daher übersetzungsrelevante Verstehensoperationen beschreiben, die sowohl mit Welt- als auch Sprachkenntnis durchgeführt werden. Die aufgelisteten Faktoren, die den Verstehensprozeß steuern, stellen ein analytisches Rahmenkonzept dar; sie greifen ineinander und wirken zusammen.
1.1 Außersprachliche Verstehensbedingungen
Die Textrezeption wird durch einen gemeinsamen Weltausschnitt von AT und ZT erleichtert, da die Erwartungen des ZT-Lesers an spezifische Themen, Verhaltensnormen, Wertvorstellungen, erworbene Praktiken bis hin zu Vorstellungen von standesgemäßer Wohnungseinrichtung, durch ein gemeinsames Bezugsfeld erfüllt werden. Für den Rezeptionsvorgang entscheidend sind aber auch die Bewußtseinsinhalte wie das Vorwissen der Kommunikationspartner voneinander, ihr Verhältnis zueinander, ihre Erfahrungsstrukturen sowie ihre Einstellungen und ihre sozialen Rollen.3 Natürlich wird meist nur ein geringer Prozentsatz des gemeinsamen Weltausschnitts, der in der kommunikativen Begegnung eine Rolle spielt, thematisiert. Da die Übersetzung jedoch die Menge der Rezipienten für einen Text erweitert, muß sie häufig kognitiv und affektiv nicht Integrierbares für die neuen Adressaten verfügbar machen, z.B. Nichtgesagtes aber Mitgemeintes erst verbalisieren.
Außersprachliche Faktoren, die das Verstehen steuern, sind somit:
Konkrete Kommunikationssituation Weltwissen allgemein.
Unter Situation sind alle natürlichen Bedingungen (Umfeld, sinnliche Wahrnehmung eines Raums etc.) und soziokulturellen Gegebenheiten, wie etwa gesellschaftliche Normen und Konventionen, Wertungen, erworbene Praktiken und entsprechendes Verhalten etc. zu verstehen, denen sich ein Individuum konkret oder in einem Text gegenübersieht.4 Die Situation schließt also die Sprech- und Kommunikationkonstellation wie deren kulturelle Implikationen und Voraussetzungssysteme ein (Produzent/ Empfänger, Interrelation zwischen beiden, Zeit, Ort, Sprachhandeln, Inhalte, Erfahrungen, Intention). Mit der Lektüre erweitert der Leser seine Verstehensvoraussetzungen und steigert die Verstehbarkeit des AT, da der Übersetzer bereits zwischen raum-zeitlich getrennter Produktions- und Rezeptionssituation vermittelt hat. Im günstigsten Fall wird im ZT eine - im AT vorgegebene - Übereinstimmung von situativen Bedingungen und Sprachhandeln erreicht. Häufig erfährt der ZT jedoch eine Veränderung dieser im AT intentional gewünschten Einheit: zum einen, weil situative Gegebenheiten im AT und im ZT jeweils anders oder gar nicht verbalisiert werden, zum andern, weil aufgrund unterschiedlicher Orientierungsrahmen und lebensweltlicher Bezüge der Informationsrückstand bzw. Überschuß von AT- bzw. ZT-Leser (meta)sprachlich kompensiert wird durch Umschreibungen, Paraphrasen, Erklärungen, Fußnotentext, Weglassungen etc. So werden in Berichten und Kommentaren der französischen Tagespresse politisch Handelnde oder das nationale Geschehen häufig durch situationelle Lokalisierung ersetzt. So steht fr. Palais de l'Elysée oder fr. L'Elysée für dt. 'Amtssitz des Präsidenten' oder 'dessen Politik' oder 'FranÁois Mitterrand' etc; fr. Quai d'Orsay' für dt. 'das Außenministerium' bzw. 'die französische Außenpolitik', fr. la Coupole für dt. 'die Académie FranÁaise' oder 'die vierzig Unsterblichen' und fr. Rue d'Ulm meint den 'Sitz einer der vier geisteswissenschaftlichen Elitehochschulen Frankreichs' oder auch den Geist, in dem sie erzieht und ausbildet. Vielleicht weiß jeder deutsche Leser, daß Downing Street 10 der Amtssitz des englischen Premiers ist, dagegen ist HÙtel Matignon als Sitz des französischen Premiers (oder in übertragener Bedeutung auch dessen Politik) wohl eher erklärungsbedürftig wie folgender Satz belegen mag: "Le texte préparé par l'Elysée et par Matignon est simple." (Le Monde, 14 avril 1992: 9), dt. 'Der vom Präsidenten (Präsidialamt) und dem Premier (der Regierung) ausgearbeitete Gesetzestext ist einfach.'

Der gerade erwähnte Fall einer kompensatorischen Übersetzung tritt jedoch weit häufiger bei mangelndem Weltwissen allgemein auf. Dieses enzyklopädische Wissen, das viele Verstehensoperationen erst ermöglicht, umfaßt alle Kenntnis- und Wissensbereiche. Auch im AT nicht explizit formulierte Zusammenhänge ergänzt der Übersetzer und mit ihm der deutsche Leser "konstruktiv" auf Grund bestimmter Extrapolationen eben dieses Weltwissens.5 Gelingt diese Konstruktion nicht, so ist angemessenes Textverständnis unmöglich. Für den Übersetzungsdidaktiker stellt sich daher die Frage: welcher Art ist das Wissen, das ein Übersetzer benötigt, um erfolgreich verstehen und kommunizieren zu können? Zum Sprachwissen im engeren Sinn muß er gerade das Wissen vermitteln, das zum Verständnis z.B. französischer Texte nötig ist, wozu neben dem Kanon der klassischen Literatur profunde Geschichtskenntnisse ebenso wie Titel und Inhalt von Comics, Filmen, moderner Trivialiteratur wie das Wissen um politische Skandale oder das Pressewesen gehören.
Ein Beispiel möge zeigen, wie wichtig die Kenntnis kulturell bedingter Verstehensvoraussetzungen für das Übersetzen ist. Noch in den 60er Jahren konnte fr. un flic mit Anspielung auf die grüne Uniform dt. Verkehrspolizei registergerecht mit 'ein Grüner' übersetzt werden; heute wird ein Grüner als Parteigänger ökologisch-alternativ politischer Gruppierungen bezeichnet; der alte flic heute also mit 'Schupo, Polente, Blaumann' etc. übersetzt. Pikant wird für den deutschen Übersetzer aber fr. les verts, bezeichnet dies doch seit allerjüngster Zeit nicht mehr die Anhänger der Umweltparteien sondern - in Anspielung auf grün als die Farbe des Propheten - die fundamentalistischen Parteien, spez. Algeriens. Wir sehen also, wie lern- und erfahrungsbedingt solche Bedeutungskomplexe sind, die die Verwendungsbedingungen (z.B. die Bezeichnung "Grüner" für "Schupo") sogar von Einzellexemen bestimmen. Bei fehlendem oder vom Übersetzer nicht vermitteltem Weltwissen wird Unverständnis die Folge sein. Auch die Unkenntnis von Wert- und Klischeevorstellungen, von Verhaltenskonventionen etc. beeinträchtigen trotz guter Sprachkenntnisse Verstehen und Kommunikation. Unser Beispiel kann hier weitergeführt werden: Weckt grün besonders positive Assoziationen in arabischen Ländern als Farbe des Islam und in Deutschland als Farbe, die Naturverbundenheit, Gesundheit und Frische signalisiert, so wird grün in Ländern mit dichtem Dschungel oft mit Krankheit in Verbindung gebracht, ist also in Teilen des weitgehend muslimischen Indonesiens verpönt.
1.2 Innertextliche Verstehensteuerung
Auch die Verstehenssteuerung durch den Text ist kommunikativ fundiert und als Leistung des Rezipienten und nicht allein des Textes anzusehen. Faktoren der Verstehenssteuerung sind:
Textkohäsion Referenzhinweise Thema Textkohärenz Textorganisation.
Unter Textkohäsion wird das Zusammenwirken aller textkonstitutiven Mittel verstanden, die den Konsistenzbedingungen von Grammatik, Lexik und Syntax genügen, um die Oberfläche eines Textes zu organisieren; sie beschränkt sich auf semantisch-syntaktische Regularitäten wie z.B. die Substitution.6
Referenzhinweise ergeben sich durch das im Text vermittelte Wissen über sprachlich gebundenes Weltwissen. Der Übersetzer als Leser muß davon ausgehen, daß der Gegenstand oder Sachverhalt auf den das Lexem verweist, dem Leser bekannt ist oder bekannt gemacht werden muß. Lexeme können nicht auf eine reine Bezeichnungsfunktion hin eingeengt werden, sagen sie doch etwas über den Benutzer, dessen Herkunft, Alter, Geschlecht etc. aus. Da die gesellschaftliche Praxis in der Zielkultur eine andere ist, bezieht sich die Bedeutung eines übersetzten Wortes auf eine veränderte gesellschaftliche Realität - verändert sich mit der gesellschaftlichen Praxis, ändert seine Bedeutung in Abhängigkeit von neuen sprachlichen Feldern, Kontexten, Situationen, Kontakten mit fremden Kulturen. Nichtsdestoweniger dient der durch AT und ZT im Rahmen verschiedener Wirklichkeitsmodelle erfolgte Referenzakt der Erstellung textueller Bedeutung und der Möglichkeit von Gegenstandserkenntnis.

Das Thema ist das durch Kontext oder Situation Gegebene und Bekannte, worüber etwas ausgesagt wird. Thematische Relationen bilden das Gerüst des Textaufbaus und steuern die Orientierung des Lesers. Dessen Ausmerksamkeit wird natürlich durch seine kulturelle, soziale, individuell-aktuelle Lage bestimmt. Häufig erfolgt die Verstehenssteuerung bereits schon durch Präsignale wie Titel, Untertitel, Gattungs- oder Textsortenangaben wie "Roman, Gesetz, Gebrauchsanweisung", die Angaben über Inhaltsaspekte sind. Im fr. ArrÍté erwartet der fr. Leser, daß Behörde und Behördenleiter explizit als im Sprechakt Handelnde genannt werden, in der dt. behördlichen Verordnung/ dem Erlaß dagegen sind Passiv-Formulierungen die Regel: "Le préfet des Alpes- Maritimes, officier de Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite,... arrÍte..." (Nice Matin 4 avril 1977: 16); "(es)... wird...verordnet." Textmerkmal der fr. Textsorte ist zudem die Nennung der Auszeichnungen der Amtsperson, die nach dem Präsignal dt. Erlaß undenkbar ist. Vor dem in Artikel gegliederten fr. Text des ArrÍté werden alle für die Entscheidung herangezogenen Dokumente, die sog. visas, aufgeführt und syntaktisch-parallel durchvu eingeleitet:
"Vu la loi du 19 juillet 1976...;
Vu le décret du 2 avril 1964...;
Vu l'arrÍté en date du 12 septembre 1976...;
Vu l'avis de classement de...." (Nice Matin 4 avril 1977: 16)
Im Dt. wird die gesetzliche Grundlage nur global genannt, z.B. "Auf Grund des ß 80 Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes in der Fassung vom 9. September 1987..." (Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz, 11. November 1991: 1192). Die darauf folgenden Beweggründe werden in französischen Texten durch considérant que oder attendu eingeleitet. Präsignale kündigen also bereits an, wie etwas gesagt wird.
Die Textkohärenz ermöglicht das Verstehen dessen, was mittels sprachlicher Zeichen verbalisiert wurde in einem pragmatischen Kontext. Textkohärenz nennen wir also den organisierten Zusammenhang von semantisch-logischem Netzwerk, thematischer Information, referentiellen Sachverhalten und sozial-kommunikativem Rahmen als Resultat des Leseprozesses. Sie ist das Produkt von Sinnerstellungsoperationen des jeweiligen Lesers sowie den beziehungsstiftenden Bedeutungszuweisungen, z.B. einem Geschichtenzusammenhang. Die kommunikativ-pragmatische Dimension der Kohärenz, die Relation zwischen Text und außertextlichen Bezügen, läßt sich daher nur über die jeweilige Rezipientensituation erfassen. Was für den dt. Leser kohärent ist, braucht es noch lange nicht zu sein für den Franzosen, der den Text aus seiner eigenen Geschichtlichkeit heraus versteht.
Auf Grund gleicher/ ähnlicher kommunikativer Funktion haben Texte spezifische Merkmale und werden als zusammengehörend empfunden: als Gattungen, Typen, Sorten etc. Für den Übersetzer spielt die Texttypologie eine zentrale Rolle, weil die Beziehung zwischen dominanter kommunikativer Funktion, thematischem Aufbau und sprachlicher Strukturierung von Texten sprach- und kulturspezifisch ist.7 So ergibt sich bei Textsortenkontrastierung, daß außersprachliche soziokulturelle Vorgaben gemeinsam mit spezifisch sprachlichen Konventionen und Vertextungsregeln die Textsorte determinieren. Nach unseren bisherigen hermeneutischen Prämissen sollte der Übersetzer sich an zielkulturellen Konventionen und Normen der Vertextung und am Bedeutungs- und Sinnhorizont der Empfängererwartung orientieren. So will der dt. Leser z.B. bei übersetzten literarischen Werken durchaus das Exotische, die "andere" Denkweise, die "andere" Ausdrucksform spüren; und der Übersetzer tut gut daran, die kulturelle Differenz zu markieren, Fremdheit erfahrbar zu machen. Bei einer Gebrauchsanweisung oder einem Handbuch dagegen versteht sich eine zielkulturell orientierte instrumentelle Übersetzung von selbst.
2 Kommunikationstheoretische Konzepte

Bereits einleitend wurde Übersetzen als Sondersorte transkultureller Kommunikation definiert. Dies setzte stillschweigend die Kenntnis zumindest des Begriffs der Kommunikation voraus. Wir wollen daher die wichtigsten übersetzungsrelevanten kommunikationstheoretischen Konzepte vorstellen.8
Unter Kommunikation versteht man gemeinhin den sprachlichen Akt, der zielgerichtet zwei- oder mehrseitige Beziehungen herstellt, in deren Rahmen die Modi der Verständigung bestimmt und die pragmatische Funktion der sprachlichen Äußerung an den Sinnintentionen überprüft werden. Sprachliche Kommunikation verläuft also unter bestimmten äußeren Bedingungen, in bestimmten Kontexten und mit bestimmter Intention, wobei die Verknüpfung eines sprachlichen Ereignisses mit seinem Zweck in einer bestimmten Situation in einer gegebenen Gesellschaft meist eine Regularität darstellt. Die kommunikative Interaktion wird noch komplexer, da der eingeführte Terminus Verständigung den sozialen Aspekt der Partner impliziert. Erst die verstehende Anerkennung der anderen/ fremden Identität ermöglicht kommunikatives Handeln, d.h. der von den Partnern geteilten Situations-, Handlungs- und Sprachmuster. Verstehen und Verständigung sind daher nur interaktionell zu bestimmen, auch wenn manche Rahmenbedingungen wie z.B. Textsortenkonventionen diese erleichtern, da die Partner die Regeln der Bedeutungsverwendung von Wörtern in Handlungsmustern und Handlungszusammenhängen kennen.9
Daraus folgert eine für die Übersetzung relevante Bestimmung von Kommunikation als intentionale, situationsbedingte, interlinguale und interkulturelle Interaktion. Entscheidend ist demnach eine zweckgerichtete, auf eine Situationsdeutung gestützte und um Verständigung bemühte sprachliche Äußerung. Der Adressat muß also die Intention und Wirkungsabsicht der sprachlichen Handlung erkennen können. Die hiermit bereits vorgestellten kommunikationstheoretischen Konzepte sind Faktoren10, die in hohem Maße geignet sind, den Übersetzungsvorgang (Wer, wo, warum, wozu, was, wie etc.) zu modellieren:
Kommunikationspartner (Produzent des AT und Empfängerkreis: historisch-gesellschaftliche Zuordnung, Beziehungen zueinander, Status, Rolle, Vorwissen, Erfahrung, Kulturwissen etc.)
Kommunikationssituation (Kommunikationsart: mündlich/schriftlich/öffentlich etc., aktuelle Umstände, Orts- und Zeitindikatoren, Bezugsrahmen, Wertesystem, Publikationsorgan etc.)
Mitteilungs- und Wirkungsabsicht (Text- und Diskurstypen, Illokutionen etc.) Referenzhinweise (Thematik, Inhalt, Darstellungsweise etc.) Kommunikationsakte (Organisationsstruktur von Texten mit sozio-kommunikativer Funktion und
thematischer Entwicklung: situationell erlaubt/ erfordert etc.)
Die aufgelisteten Faktoren stellen Variable dar, die die Analyse und die Produktion von partnerspezifischen, situationsadäquaten, sachbezogenen, intentionsgerechten und funktionsorientierten Sprachgebrauch determinieren. Sie berücksichtigen die Dynamik des an das soziale Handeln und die Sprache zweier Kulturen gebundenen Übersetzungsprozesses.
3 Kulturdifferenz und transkulturelle Kommunikation
Nach dem eingangs skizzierten hermeneutischen Verstehensbegriff meint übersetzungsrelevante Kulturdifferenz nicht nur den Unterschied zwischen Kulturen, sondern den zwischen ausgangssprachlicher und zielsprachlicher Kultur.11 Solche Unterschiede können sich daher sprachlich manifestieren als:
Unterschiedliche Sprachkonvention bei vergleichbarer Situation, wie z.B. Verbalisierung von Gruß, Dank, Entschuldigung oder der Durchsage am Bahnhof: fr. "en voiture s'il vous plaÓt", dt. 'Bitte einsteigen'.
Unterschiedliche Textform bei vergleichbarem kommunikativem Zweck; hierzu gehören Argumentationsschemata, Diskurstypen12, Textsorten, ästhetische Textnormen.
Unterschiedliche Gebrauchsnorm, wie z.B. Verwendung von Soziolekten (im Fr.) und Dialekten (im Dt.), Phraseologismen13

Unterschiedliche Textform bei gleicher Textsorte; dies betrifft v.a. Fachtextsorten (s.o. den Erlaß), ihre Publikationsformen bis hin zum Layout.
Nun haben wir Übersetzen als des auf Verständigung angelegten, zweckbestimmten Sprachhandelns, als transkulturelle Kommunikation bestimmt. Daraus ergeben sich wichtige Konsequenzen für den Übersetzungsvorgang, dessen Rahmen und Maßstab die bereits beschriebenen hermeneutischen und kommunikationstheoretischen Konzepte bilden. Nach diesen Konzepten folgt eine Übersetzung bei gegebener Situation historischen sprachkulturspezifischen Mustern, damit eine Mitteilungsabsicht mit bestimmter Thematik überhaupt erst in organisierter Textform erfolgen und verstanden werden kann. Jeder Übersetzer muß also zuerst die Voraussetzungen der Kommunikationssituation - der Partner und der Situation im engeren Sinn - klären. Die nächste Überlegung ist, ob in dieser neuen Situation die vom AT gewollte Kommunikations- und Mitteilungsabsicht zu realisieren ist bzw. welches die Intention des Übersetzers ist; ob er informieren , Wissen übermitteln, Handlungen fordern etc. will. Daraus ergibt sich direkt die Entscheidung über die Textfunktion des Translats, die sich, wenn zielkulturell irgend möglich, aus der des AT ergibt. Der Zweck sollte durch einen angemessenen und präzise formulierten Übersetzungsauftrag festgelegt werden. In der Festlegung der Textfunktion erfolgt dann die Kopplung zwischen Intention und Textsorte und deren einzelsprachlich spezifischen Vertextungsnormen z.B. von Sprechakten oder Handlungsmustern. Gerade um diese konkrete Verwendung einer spezifischen Sprache in Diskurs und Text und die Kulturspezifik der Textproduktion geht es in der Übersetzung.
Eine Einschränkung der transkulturellen Transferproblematik auf außersprachliche kulturelle Realia wie Empfänger, Ort, Zeit, Sender, Intention etc. ist also nicht möglich, da das Gelingen transkultureller Kommunikation die Kenntnis der Regeln ihrer Herstellung voraussetzt. Diese Kenntnis nun umfaßt zweierlei: zum einen die Kenntnis der kulturellen Normalformen, wie z.B. der sozialen Strukturen, der Handlungsmuster, des Sach- und Wissenshintergrunds von Ausgangs- und Zielkultur und zum andern das Sprachhandeln, die sprachkulturspezifische Realisierung von Sprechakten, Verhaltensmustern etc., die Diskursformen und Textsorten in AT und ZT. Die Kenntnis dieser kulturellen Normalformen erlaubt auch, fiktive von realen Texten oder den Tenor Ernst von Ironie unterscheiden zu können.
Weltwissen und Sprachwissen werden in sprachspezifischer Weise kombiniert im Verstehensprozeß. Und so kann auch die kommunikative Funktion einer Übersetzung nur relativ zur Situation im Rahmen soziokultureller Konventionen der Sprachverwendung und den Erwartungen des Rezipienten erschlossen werden. Diese Konventionen enthalten Hinweise, wie die Übersetzung zu deuten ist. Der ZT wird also je nach Sprache für den ZT-Leser andere Mißverständnisse oder gar Nichtverstehen ausräumen müssen und den Zusammenhang von kommunikativen Zwecken und sprachlichen Mitteln neu gestalten. Dazu gehört auch, Nichttextualisiertes für den ZT-Leser explizit zu machen. Aus diesem Grund benötigt der Übersetzer eine hermeneutisch-konstruktive Kompetenz, die die rezeptionsorientierte Ausrichtung seines Translats impliziert, damit eine Applikation auf die Lebenspraxis des ZT-Lesers ermöglicht wird. Was mit einem Text zu verstehen gegeben wird, ist dann eine Verständigungsleistung von Übersetzer und Leser und hängt auch davon ab, ob in bestimmten Handlungszusammenhängen ein Bedarf oder sogar eine kommunikative Notwendigkeit besteht. Der Sinn eines Textes wird somit im Verstehen erfaßt durch seine Einbettung in einen übergreifenden Zusammenhang und ein Mitteilungsgeschehen. Der Übersetzer fügt dem AT, auch wenn dieser interpretationsbedürftig ist, keinen zusätzlichen Sinn bei, der nicht in ihm selbst angelegt wäre. Im Rahmen der neuen Situation sowie der textuellen Wirkungsgeschichte ergibt sich aber ein neues Verstehen, werden neue Sinnbezüge entdeckt. Eine so verstandene kontrollierte Vermittlung zwischen fremdkultureller und eigener gegenwärtiger Erfahrung wird dem Anspruch der Übersetzung als transkulturellem Kommunikationsvorgang gerecht. In einer Ära der Homogenisierung in Gestalt ökonomischer und technischer Vernetzung einerseits und der Fundamentalisierung von Differenz andererseits ist die Übersetzung als Form einer gegenseitigen Wachsamkeit, als besondere Form des transkulturellen Grenzverkehrs geradezu unverzichtbar.
Bower, Gordon Howard/ Graesser, Arthur C.Inferences and text comprehension. San Diego: Acad. Pr., 1990.

De Beaugrande, Robert-Alain/ Dressler, Wolfgang.Introduction to text linguistics. London and New York: Longman, 1981.
Harweg, Roland.Pronomina und Textkonstitution. München: Fink, 1968.
Gülich, Elisabeth/ Raible, Wolfgang.Linguistische Textmodelle. Grundlagen und Möglichkeiten. München: Fink, 1977 (=UTB 130).
Habermas, Jürgen. "Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz." Sprache und Gesellschaft. Ed. Holzer, Horst/ Steinbacher, Karl. Hamburg: Hoffmann & Campe, 1972. 208-236.
Habermas, Jürgen.Theorie des kommunikativen Handelns. Bd.I und II. Frankfurt: Suhrkamp, 31985.
Knobloch, Clemens.Sprachpsychologie. Ein Beitrag zur Problemgeschichte und Theoriebildung. Tübingen: Niemeyer, 1984.
Kupsch-Losereit, Sigrid (1988):"Die Übersetzung als soziale Praxis. Ihre Abhängigkeit vom Sinn- und Bedeutungshorizont des Rezipienten." Fremdsprachen Lehren und Lernen, 17 (1988): 28-40.
Kupsch-Losereit, Sigrid."Sprachlich-konzeptuelle Verarbeitung von Kulturdifferenz in der Übersetzung." Lebende Sprachen 35 (1990): 152-155.
Kupsch-Losereit, Sigrid."Die Relevanz von kommunikationstheoretischen Modellen für Übersetzungstheorie und übersetzerische Praxis." TEXTconTEXT 6 (1991): 77-100.
Meggle, Georg.Grundbegriffe der Kommunikation. Berlin: De Gruyter, 1981.
Neubert, Albrecht."Thesen zur Translationstheorie und zu Problemen ihrer Anwendung in der Translationsdidaktik." Translationstheorie - Grundlagen und Standorte. Ed. Justa Holz-Mänttäri. Tampere: Universität, 1988. 72-80.
Nord, Christiane.Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlage, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg: Groos, 1988.
Reese, Susanne.Gerundialkonstruktionen im Spanischen. Ansatz zu einer grammatisch-pragmatischen Beschreibung. Tübingen: Narr, 1991.
Rehbein, Jochen, ed.Interkulturelle Kommunikation. Tübingen: Narr, 1985.
Reiß, Katharina.Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg: Groos, 21983.
Reiß, Katharina/ Vermeer, Hans J.Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer, 1984.
Scherner, Maximilian.Sprache als Text. Ansätze zu einer sprachwissenschaftlich begründeten Theorie des Textverstehens. Forschungsgeschichte - Problemstellung - Beschreibung. Tübingen: Niemeyer, 1984.
Schmidt, Siegfried J.Texttheorie. Probleme einer Linguistik der sprachlichen Kommunikation. München: Fink, 1973 (=UTB 202).
Vermeer, Hans J.Voraussetzungen für eine Translationstheorie - einige Kapitel Kultur- und Sprachtheorie. Heidelberg: Selbstverlag, 1986.
Wilss, Wolfgang.Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. Stuttgart: Klett, 1977.

Fußnoten
1. Vgl. Neubert 1988 zu den unterschiedlichen Übersetzungsmodellen.2. Zu dieser konstruktivistischen Verstehensauffassung, die das Verstehen kommunikativer
Zusammenhänge als Produkt der Sinnkonstruktion für einen Text auffaßt vgl. Knobloch 1984 und Vermeer 1986, 335-355. Die Übereinstimmung dieses Verstehensbegriffs mit dem von der kognitiven Linguistik entwickelten Konzept der Informationsverarbeitung belegen Bower und Graesser 1990.
3. Ausführlich zum Begriffsinhalt der Präsupposition Scherner 1984, 60-62.4. Zur näheren Begriffsbestimmung der Situation beim Übersetzen vgl. Kupsch-Losereit 1988, 32-34.5. Reese 1991 weist nach, daß sich sogar die Bedeutung von spanischen Gerundialkonstruktionen nicht
aus der Satzsemantik sondern einzig aus pragmatischen Präsuppositionen ergibt.6. Vgl. Harweg 1968 zur syntagmatischen Substitution und vgl. De Beaugrande/Dressler 1981, Kap. IV
und V zur Unterscheidung von Kohäsion und Kohärenz.7. Grundlegend zum Zusammenhang zwischen Textsorten und Übersetzungsmethode sind die Schriften
von Reiß 1983, Reiß/ Vermeer 1984 und Nord 1988.8. Ein auch für interlinguale Kommunikation brauchbares texttheoretisches Kommunikationsmodell
entwickeln Schmidt 1973: 144-164, Gülich/ Raible 1977: 21-59 sowie Meggle 1981.9. Zur analytischen Bestimmung und theoriegeschichtlichen Rekonstruktion des Begriffs der
Kommunikation grundlegend Habermas 1972 sowie Habermas 31985: Bd.I, 141-151 und Bd.II, 327-351.
10. Ausführlich zu den Komponenten dieser Faktoren Kupsch-Losereit 1991: 80-83.11. Vgl. dazu Kupsch-Losereit 1990: 152-153.12. Solche Diskursformen in bestimmten gesellschaftlichen Einrichtungen sind Untersuchungsgegenstand
mehrerer Aufsätze in Rehbein 1985: 242-419.13. Vgl.Wilss 1977, 205-209 zur Differenzierung von situationsabhängiger und situationsunabhängiger
Gebrauchsnorm.