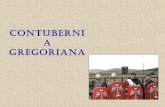Refloreat disciplina : ein Erneuerungsmotiv bei Petrus Damiani · tur». AIPL 144, Sp. 206AB. Vgl....
Transcript of Refloreat disciplina : ein Erneuerungsmotiv bei Petrus Damiani · tur». AIPL 144, Sp. 206AB. Vgl....
-
HANS PETER LAQUA
i
"Refloreat disciplina" :
ein Erneuerungsmotiv bei Petrus Damiani
4 44
. a
CESENA CENTRO STUDI E RICERCHE
SULLA ANTICA PROVINCIA ECCLESIASTICA RAVENNATE
-
4
-
HANS PETER LAQUA
"Refloreat disciplina" : ein Erneuerungsmotiv bei Petrus Damiani
RIASSUNTO In due lettere di augurio al papa e al re, come an- che nella Disceptatio synodalis, Pier Damiano esprime il suo desiderio di riforma della Chiesa con le parole « refloreat disciplina ».
Questo studio, avendo esaminato la metafora verbale del motivo di rimiovamento, ritiene che qui essa derivi da tit; contesto (greco-) biblico e dal commento d' Agostino (« refloruit ... id est ... resur- rexit »), contemporaneo con la decisiva revisione della Bibbia latina secondo il testo dei Settanta.
Agostino esegeta congiungeva appunto la metafora in origine ve- getativa-vitalistica con la dottrina paolina: congiunzione di cui Pier Damiano approfittava nella ep. 7,3, dove, in contesto di riforma della Chiesa, assegna la funzione centrale per la sperata « risurrezione »e «rifioritura» della «Ecclesia» al giovane sovrano imperiale, Enrico IV, incitandolo a seguire lo splendido esempio del padre. Il Santo Raven- nate ci tramanda cosi un concetto tradizionale (e « pregregoriano ») di
regalitä sacra.
I
Dreimal äusserte Petrus Damiani in Hochphasen seiner literarischen Produktion den Reformwunsch ' refloreat disci- plina'. Er schrieb ihn dem Oberhaupt des Sacerdotium (a) wie dem höchsten Vertreter des Regnum (c) in Briefen zum Herr- schaftsantritt und trug ihn am Schluss einer dialogischen Schrift auch beiden Häuptern der im vorgregorianischen Sinne begrif- fenen Ecclesia zusammen vor (b).
279
-
Insbesondere derB egrüs sungsin omen t, dem die beiden Briefe entstammen, konnte Petrus Damiani veranlas- sen, seine Wünsche und Hoffnungen auf Reform der kirchlich- religiösen Ordnung so gesteigert zu formulieren, wie es verglei- chbar in Alteuropa den thematischen und topischen Konven- tionen der zeremoniell geprägten, messianischen Adventus-U- berhöhung eigentümlich war (1).
a) Bei der Begrüssung des neuen Papstes Gregor VI. in ep. 1,1 von 1045 erhoffte Petrus Damiani eine Erneuerung des goldenen Zeitalters der apostolischen Urkirche. Zu diesem Wunschbild gehört auch unser Motiv:
« Reparetur nunc aureum apostolorum saeculum, et prae- sidente vestra prudentia, ecc1esiasticarefl o- reat disciplina» (2).
Das Erneuerungsmotiv steht in einer Kette konjunktivisch
gebrauchter Verben, worin Petrus Damiani seine reformerischen Erwartungen äusserte (3). Sie stilisierte er im Fortgang sei- nes Schreibens zur Hoffnung der Menschheit auf Welt-Erneue-
rung hoch und verband dabei einen dreifachen 'Test' -Fall auch
(1) E. H. KANToRowicz, Kaiser Friedrich II. und das Königsbild des Helle-
nismus (Marginalia miscellanea) (Varia variorum. Festgabe für Karl Reinhardt, Münster -Köln 1952, S. 169-193) = jetzt in E. H. KANroROWICZ, Selected Studies, New York 1965, S. 264-283, zum «messianisch zeitlose(n) Frühling» erneuernden Blühens vgl. SI. 180 (= 278). In Münster initiierte Karl Hauck (vgl. Anm. 2) ein Interesse an Adventus-Problemen, dem jetzt Dissertationen folgen von P. A. WILLMES zum Herrscher-Adventus im Kloster des Frühmittelalters (im Druck)
und von J. AHRENDTS zur literarischen Tradition der zeremoniellgebundenen pan- egyrischen ' Adventus Rede' (in Vorbereitung).
(2) MIGNE, Patrologia Latina (= 11MPL) 144, Sp. 205C. Zur Adventus-Struktur
von Erwartungen, wie sie auch dieser Brief manifestiert, vgl. K. HAUCK, Helden- dichtung und Heldensage als Geschichtsbewusstsein (Alteuropa und die moderne Gesellschaft. Festschrift für Otto Brunner, Göttingen 1963, S. 118-169) S. 159.
(3) « Conteratur ... cesset ... nullam monetam fabricet ... nulla ... dona re. portet ... revertatur ... nuntiet ...
Reparetur ... refloreat ... Reprimatur
evertantur », MPL 144, Sp. 205BC.
280
-
schon mit der nachdrücklichen Warnung vor den Folgen, die enttäuschtes Hoffen und Vertrauen für die weitere Beurteilung der Reformqualität des apostolischen-Stuhles hätte (4).
b) Vergleichbar hochgestimmt war die Erwartung der Fol- gen neuer gegenseitiger 'caritas', die Petrus Damiani 1062 in der « Disceptatio synodalis » nach dem Leitbild des christli- chen-Messias von den höchsten Gewalten der einem Ecclesia forderte:
« Sanctae ergo aecclesiae principes quam propensiori in-
vicem debent karitate congruere, quibus iniunctum est karitatem precipue christiano populo predicare, ut ex eo- rum, quae procedat ex pietate, concordia sancta univer-
salis gratuletur aecclesia ac gemino utriusque studio
(4) « Verumtamen utrum ista, quae scribimus, mundo sperare sit licitum, pri. mo Pisaurensis Ecclesia bonae spei darum dabit indicium. Nisi enim praedicta Ecclesia de manu illius adulteri, incestuosi, perjuri, atque raptoris auferatur, omnispopulorumspes, quae derepa- ratione m undi erecta' fuerat, funditus enervatur. Omnes siquidem ad hunc finem oculos tendunt, omnes ad hanc Imam vocem aures erigunt. Et si ihe tot criminibus obvolutus ad episco- patusarcemrestituitur, ab apostolica sede boni aliquid ulterius posse fieri, penitus denegatur. Tres equidem Bunt, quae testimonium dabunt, Castellana sedes, Fa. nensis, et Pisaurensis; ut in ore duorum, vel trium testium stet omne verbum (Deut. 19,15; Matth. 18,16). In histribuspatenter ostenditur quid spei de caetero relinqua - tur». AIPL 144, Sp. 206AB. Vgl. G. MICCOLI, Chlesa Gregoriana, Ricerche sulla Riforma del secolo XI, Firenze 1966, S. 257f. - Zum antiken Muster einer Verbindung von kosmologischer Welt-Erneuerung, der Mythe vom 'aureum sae- culum' und vitalistischen Erneuerungsvorstellungen in Vergils Vierter Ekloge siehe Lev», z, Idea of Reform (wie Anm. 9) S. 12f.; vgl. auch S. 20f. >Alle drei Elemente kehren verchristlicht in Damianis Brief wieder: 'reparatio mundi', 'aureum apostolorum saeculum', 'reflorere'. Auch wenn wir uns hier allein dem dritten Element zuwenden werden, ergänzt wohl der Aufweis dieser dreifachen Anverwandlung in einem kirchenreformerischen Zeugnis des 11. Jahrhunderts das väterzeitliche Panorama Ladners, der jene Vorstellungen aufgrund seines Ansatzes (dazu unten) von der christlichen Reform-Idee abgrenzte.
281
-
christianae religionis refloreat di- sciplina» (5).
Am Schluss des Plädoyers (clausula dictionis) für das Zusammenwirken der beiden im Schisma zwischen Alexander II. und (Honorius II: ) Cadalus zerstrittenen Gewalten trug der Wunsch ein besonderes Gewicht. Damian erhoffte dort
als reformerische Wirkung der 'caritas', 'pietas' und 'concordia' letztlich, dass zur Freude der ganzen Kirche durch gemeinsa- mes Bemühen ihrer beiden Häupter (« principes ») die Ord- nungderchristlichenReligion wiederb1ühte.
c) Wohl im Spätjahr 1066 erinnerte Petrus Damfan den
neuen König Heinrich IV. in ep. 7,3 an die Reformerfolge sei- nes Vaters Heinrich III. in der Kirche. Denn jetzt hoffte er, der als « Erbe des Reiches » (6) begrüsste Sohn werde sie erneuern:
« Sed sicut olim per ilium, non amodo per to et collapsa resurgatEcclesia, et ecclesiastica quae con- fusa est refloreat disciplina» (7).
Dieser Wunsch stammt wiederum aus einem aktuellen Zeugnis des literarischen Kampfes Damianis gegen Cadalus von
(5) Ed. v. HEINEMANN (Monumenta Germaniae Historica = HIGH, Libelli de lite 1) S. 93f.; vgl. im Kontext: « sicut in uno mediatore Dei et hominum haec duo, regnurn scilicet et sacerdotium, divino sunt conflata mysterio... » (S. 93). Dass 'caritas' zwischen beiden Gewalten prinzipiell ist, sah K. SCHNITH, Recht und Friede. Zum Königsgedanken im Umkreis Heinrichs III. (Historisches Jahr- buch 81,1962, S. 22-57) S. 35.
(6) « Porro quia splendidae memorise pater ejus magnificus imperator subli- miter exaltavit Ecclesiam, tu quoque sicut ejus haeresimperii, sic etiam in ecclesiasticae cautionis jura succede ». NPL 144, Sp. 441B. - Zu ep. 7,3 ist noch immer ausgezeichnet H. v. SCHUBERT, Petrus Damiani als Kirchenpolitiker (Festschrift für Karl Müller zum siebzigsten Geburtstag, Tübingen 1922, S. 83 - 102), der S. 97 die Datierung auf Ende 1066 gegen die 'communis opinio' (1065) begründet hat, was nie weiter beachtet worden ist.
(7) MPL 144, Sp. 441C.
282
-
Parma. Auch er steht dabei im Zusammenhang grundsätzlicher Ausführungen über das rechte Verhältnis vor Sacerdotium und Regnum (8). Wir werden auf die Stelle noch zurückkommen.
II
Der verbale Teil des im Wandel der Zeit zwischen 1045 und 1065/66 konstanten Motivs - jedesmal auch Satzschluss im Cursus velox! - bewahrt mit 'r ef1orea t' Damianis Reformwunsch in dem metaphorisch gebrauchten Ausdruck der vegetativen Erneuerungs-Vorstellung des Wiederblühens.
Es ist ein Verdienst von Gerhart B. Ladner, in seinem grudlegenden Buch « The Idea of Reform » auch die Erneue-,
rungs-Terminologie nach ihren traditionellen Verwurzelungen hin genauer-differenziert zu haben. Das half ihm, die Erneu-
erungs-Ideen aufzufächern, wobei sein Interesse dort hauptsä-
chlich den verschiedenen Ausprägungen der christlichen Re- form-Idee in der Väter-Epoche und den Wortfeldern ihres Vo- kabulars galt (9).
(8) «Utraque praeterea dignitas, et regalis scilicet, et sacerdotalis, sicut prin- cipaliter in Christo sibimet invicem singulari sacramenti veritate connectitur, sic in Christiano populo mutuo quodam sibi foedere copulatur. Utraque videlicet al- ternae invicem utilitatis est indiga, dum et sacerdotium regni tuitione protegitur, et regnum sacerdotalis of&cii sanctitate fulcitur ». MMPL 144, Sp. 440AB. Vgl. die Parallele in ep. 3,6 von 1063 an Erzbischof Anno von Köln (MPL 144, Sp. 294C), dazu V. SCHUBERT (wie Anm. 6) S. 85ff. F. DRESSLER, Petrus Damiani. Leben und Werk (Studia Anselmiana 34) Rom 1954, S. 96f. Die gelasianische Grundlage benannte J. J. RYAN, Saint Peter Damiani and his Canonical Sources. A Preliminary Study in the Antecedents of the Gregorian Reform (Pontifical Institute of Medae.
val Studies. Studies and Texts 2) Toronto 1956, S. 94 nr. 181 und S. 105f. nrr. 203,204; vgl. noch zur 'clausula' der «Disceptatio synodalis» S. 91f. nr. 175
und als Resümee insgesamt S. 154. (9) G. B. LenanR, The Idea of Reform. Its Impact on Christian Thought and
Action in the Age of the Fathers, Cambridge, Mass. 1959. Gerade unter dem
terminologischen Aspekt würdigte dessen Verdienst J. LECLERCQ, Die Bibel in der Gregorianischen Reform (Concilium. Internationale Zeitschrift für Theolo-
gie 2,1966, S. 507-514) S. 507. - Von verwandten Arbeiten des Autors gehören
283
-
. Der Münsterer Germanist und Begründer einer lexikolo-
gischen Wortfeld-Theorie Jost Trier hatte nachgewiesen, dass die metaphorische Bedeutung von 'renasci' auf 'Wiederwuchs',
neues Ausschlagen nach Hieb im Niederwald-Bereich zurück- geht (10). Im Anschluss daran nannte Ladner in der einleiten- denAbgrenzung vitalistischer Erneuerungs- Ideen von seinem eigenen Thema neben anderen Beispie- len ursprünglich vegetativer Bezeichnungen auch (und nur) das Inchoativum 'r eflorescer e' und gab in dem Zusam-
menhang zwei Belege: einem aus der « Naturalis historia » des älteren Plinius für die ursprüngliche Verwendung dieses Verbs im Pflanzenbereich und einen aus des Silius Italicus « Puni-
ca », wo die metaphorische Bedeutung des Worts den am Me- taurus gegen Hasdrubal siegreichen Konsul Livius im Erblü- hen einer sich erneuernden Jugend zeigt (11).
Weiterhin wies Ladner 'reflorescere' dann noch einmal in den « Confessiones » nach, wo Augustinus es parallel zu 're- formare' und 'renovare' gebrauchte:
in unseren Zusammenhang a) zeitlich: G. B. LADNER, Two Gregorian Letters. On the Sources and Nature of Gregory VII' Reform Ideology (Studi Gregoriani 5, 1956, S. 221-242) bes. S. 221 mit Anm. 2; b) thematisch: G. B. LADNER, Vegetation Symbolism and the Concept of Renaissance (De Artibus Opuscula XL. Essays in Honor of E. Panofsky, New York 1961, S. 303-322) = jetzt auch deutsch: Pflanzen-symbolik und der Renaissance-Begriff (Zu Begriff und Problem der Re-
naissance, hg. A. BucK, Wege der Forschung 204, Darmstadt 1969, S. 336-394).
(10) J. TRIER, Zur Vorgeschichte des Renaissance-Begriffs (Archiv für Kul-
turgeschichte 33,1950, S. 45-63) = auch in: J. TRIER, Holz. Etymologien aus dem
Niederwald, Münster - Köln 1952, S. 144ff.; auf das Echo in der Forschung erwi-
derte J. TRIER, Wiederwuchs (Archiv für Kulturgeschichte 43,1961, S. 177-187). - \Vortfeldtheorie: J. TRIER, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstan-
des. Geschichte eines spracblicben Fecdes 1, Heidelberg 1931. (11) LADNER, Idea of Reform (wie Anm. 9) S. 20. - Plinius, Naturalis bistoria
18 c. 43: (Medica externa) a secatur incipiens florere et quotiens ref1oru1tu,
ed. H. RACKHAM (Loeb Classical Library 371, London 1950) S. 280,282. - Silius, Punica 15 v. 738: aref1orescente iuventa u, ed. J. DUFF (Loeb Clas-
sical Library 278, London 1950) S. 378.
284
-
«anima mea(: )... et reflorescen t putriatuaet sanabuntur omnes languores tui et fluxa tua reformabun- tur et renouabuntur » (12 ).
Der Gebrauch vitalistischer Erneuerungs-Termini im Kontext von (christlicher) « Reform » sei nicht selten, urteilte Ladner schliesslich (13).
Ehe wir von Augustinus wieder auf Damiani blicken wer- den, wollen vir noch weitere Belege für die Umschreibung von Reform mit Hilfe des Verbenpaares 'reflorere' / 'reflorescere'
nennen. Denn ausser vier Stellen bei Paulinus von Nola (353 - 431) (14) gibt es vor allem auch je einen Beleg aus der Vul-
gata des Alten und des Neuen Testaments:
« Et refloruit caro mea » (Ps. 27,7);.
«ref lo ruis ti s pro me sentire » (Phil. 4,10).
(12) LADNER, Idea of Reform (wie Anm. 9) S. 212. - Augustinus, Confes-
siones 4,11,16, ed. P. KNÖLL (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum = CSEL 33, Wien 1896) S. 77.
(13) LADNER, Idea of Reform (wie Anm. 9) S. 299 Anm. 6, vgl. S. 26; «flo- reat» bei Vincenz on Lerins im frühen westlichen, nicht augustinisch gepriigten Mönchtum: S. 412 Anm. 49. - Im Zeithorizont
Damianis erscheinen die beiden
Grund-verben 'florere' /' florescere' in einem hagiographischen Text der lothrin-
gischen Mönchsreform, was mein Lehrer Karl Hauck mir zeigte: « divini fervor
servitii ... f1orescendo crevit et divina opitulante gratia in longas post
generationes crescendo f1orebit». ('Touler' Vita Leonis IX. I c. 13, cd. J2 L WATTERICII, Pontifrcum Romanorunt Vitae 1, Aalen 21966 [1862] S. 143). Zur umstrittenen Verfasserfrage der Vita zuletzt H. HoEscu, Die kanonischen
Quellen im Werk Humberts von hfopenmoutier. Ein Beitrag zur Geschichte der
vorgregorianiscben Reform (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 10) Köln-Wien 1970, S. 243-253 (« Exkurs zur Vita Leonis »).
(14) Ep. 21 c. 5: «rcf1orescere non, solum spiritu sed et corpore », ed. W. V. HARTEL (CSEL 29, Wien 1894) S. 152; ep. 23 c. 13: « gratia ref1o- rente» (CSEL29)S. 170; ep. 40c. 3: «refloruisti sapere»(CSEL 29) S. 342; Carmen 28 (= eines der vierzehn ' natalicia' auf den hl. Felix) v. 217:
« in pueram fadem ueterana ref1oruit aetas », ed. in R. C. GOLDSCHMIDT,
Paulinus' Churches at Nola. Teats, Translations and Commentary, Amsterdam 1940,
S. 82; cd. v. HARTEL (CSEL 30, Wien 1894) S. 300.
285
-
III
Als eine Wurzel von Damianis entsprechender Reform- Vorstellung kommen diese biblischen Vorbilder auch deswe-
gen am ehesten in Frage, weil seine früher vermutete Plinius- Kenntnis' inzvischen angezweifelt wurde (15) und nichts da-
rauf schliessen lässt, dass er mit den Werken des Silius oder des grossen Verehrers des heiligen Felix von Nola vertraut war. Der kommt in Damianis zahlreichen hagiographischen Texten
nicht vor. Dagegen kann man zeigen, dass an der Vermittlung der
christlich-reformerisch verstandenen Erneuerungs-Bezeichnung des 'Wiederblühens' zu Petrus Damiani wahrscheinlich Augu-
stinus beteiligt war. Wir greifen dazu auf unseren alttestamen- tlichen Beleg zurück und erinnern daran, dass Damiani als Vor-
steher von Fonte Avellana seit 1043 aus den Bibelkommenta-
ren auch de Augustinus für die Klosterbibliothek abschrei- ben liess (16).
In seiner « Enarratio in Ps. 27 » (v. 7) allegorisierte Au-
gustinus den Ausdruck für die neubelebende Wirkung der Hil- fe Gottes
, die Davids « vox deprecationis » (v. 2) erfleht
hatte, mit der neutestamentlichen Verheissung der Aufer-
stehung:
«'Et refloruit caromea', idest, et resurre- xit caro mea » (17).
(15) DRESSLER (wie Anm. 8) S. 188 Anm. 70. (16) Petrus Damiani, «De ordine eremitarum et facultatibus eremi Fontis A-
vellani» (op. 14): «ex commentariis, allegoricas sacrae Scripturae sententias expo- nentium, ...
Augustini ... »,
MMPL 145, Sp. 334CD; dazu und abwägend zur Be- deutung Augustins für Damiani DRESSLER (wie Anm. 8) S. 206 mit Anm.
161 u. 163. (17) Ed. D. E. DEKKERs - I. FR. iiPo\r (Corpus Christianorum = CC 38,
Turnhout 1956) S. 169. Denselben allegorischen Zusammenhang verwandte Bischof Maximus von Turin (+ 408/23) in Sermones 55 u. 56, ed. A. MUTZENBECHER
(CC 23, Turnhout 1962) S. 222,224. - J. SCHREINER, Zur Geschichte der sittesta-
286
-
Die Metapher in Ps. 27,7 geht zurück auf das Griechische der Septuaginta: xai äyiAaXEy A Sccý you (18).
Während die sprachliche Herkunft des Erneuerungsmo- tivs dort ungeklärt bleibt, hat man zum neutestamentlichen Be- leg des Paulus (Phil. 4,10) den Einfluss der Koine disku-
tiert (19). Im lateinischen AT machten Hieronymus und Alkuin die
Vorstellung für lange Zeit fest (20). Denn Hieronymus revi- dierte bald nach 386 den altlateinischen Psalter zunächst an- hand der fünften Kolumne der Hexapla, also der origeneischen Septuaginta-Rezension. Dieser Fassung des Psalters gab Alkuin bei der Textnormierung den Vorzug gegenüber der aus dem Hebräischen übersetzten. Seit dem 9. Jahrhundert als « Psal-
tnentlichen Exegese. Epochen, Ziele, Wege (J. SCHREINER, cd., Einführung in die Methoden der biblischen Exegese, Würzburg 1971, S. 1- 17) II. Auslegung des Alten Testaments inder Zeit der Väter, S. 4- 10, hier S. 9f.
(18) Sekundäre Lesart im Vergleich zum Hebräischen: H. HERKENNE, Das Buch der Psalmen überselzt und erklärt (Die Heilige Schrift des Alten Testamen.
tes 5,2) Bonn 1936, S. 124 Anm. C (= Schluss der Anm. von S. 123! ). Noch
an acht weiteren Stellen hat die Septuaginta Formen des Verbs äyae6cXXety
(Sap. 4,4 - Sir. 1,18; 11,22; 46,12; 49,10; 50,10 - Hos. 8,9 - Ez. 17,24). - Zum
Fortleben der Metapher im Griechischen vgl. den Beleg a00uS &yGt 8(x5a
aus dem Synodalschreiben des Konzils von Ancyra von 357 bei LADNER, Idea of Reform (wie Anm. 9) S. 299.
(19) J. H. MOULTON - G. MILLIGAN, The Vocabulary of the Greek Testament
illustrated frone the Papyri and Otber Nort-literary Sources, London '1952 (1930),
S. 33. Ilias 1,236 belegt früh das sehr selten und nur in der griechischen Poesie
gebrauchte Verb: H. THAYER, transl., rev. and enlarged, A Greek - English Lexi-
COn of the New Testament beeing Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti, Edin- burgh 1961 = '1901 (1885), S. 37.
(20) Eine neue Psalter-Revision hat erst Papst Pius XII. am 24. März 1945
«Pro usu liturgico » approbiert: Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam. Nova
Editio, cd. R. P. A. COLUNGA - L. TuRRano, Madrid ' 1959 (1946) S. 476 Anm. *;
danach lautet Ps. 27(28), 7: « ... Ideo exsu1 tat cor meum ... »,
S. 498 (kursiv).
- Vgl. für das Folgende K. TH. SCHÄFER, « Bibelübersetzungen » (Lexikon
für Theologie und Kirche 2, Freiburg 11958, Sp. 375 - 384) Sp. 378,382ff. (mit
Literatur).
287
-
terium Gallicanum » bekannt, wurde sie nachmals auch ins Römische Brevier aufgenommen.
Die eigenen Bemühungen des Augustinus um einen ver- besserten Psalmentext galten anfangs gleichfalls einer Revision nach dem griechischen Text, mit dessen Lesart er beim « re- floruit » in der zitierten Auslegung von Ps. 27,7 arbeitete. Augustinus verknüpfte dort die damals überprüfte und später im offiziellen Bibellatein befestigte Metapher des Psalms so- gleich mit, der paulinischen Lehre von der Auferstehung des Fleisches in einen verklärten Zustand.
Damit konnte er am Beginn der Wirkungsgeschichte des
revidierten lateinischen Textes, der zur « Vulgata » werden sollte, das alte « refloruit caro mea » vor jeder noch immer
möglichen, bloss vitalistischen Assoziation heidnischer Her- kunft theologisch abschirmen.
IV
Der Rückgriff auf diesen exegetischen Zusammenhang
von Wiedererblühen und Auferstehen aus der Wende des 4.
und-, 5. Jahrhunderts lohnt sich für unseren Beleg (c) von «ref1oreat disciplina » in Damianis programmatischem Begrüssungs- und Mahnschreiben an Heinrich IV.
Denn dort kehrt die Verknüpfung der beiden Gedanken
wieder, wie sie in Augustins Auslegung der « allegorica sa- crae Scripturae sententia » (21) von Ps. 27,7 vorlag:
« ... et collapsa resurgat Ecclesia, et ecciesia-
stica quae confusa est ref1oreat disci-
plina (22).
Die Individualität dieses Zeugnisses aus Damianis ep. 7,3
(21) So verstand Petrus Damiani die Kommentare, vgl. Anm. 16. (22) Petrus Damiani, ep. 7,3,. gfPL 144, Sp. 441C.
288
-
kann man doppelt markieren. Einmal, wurde dort ; auch das Verb ' resurgere '- bezogen auf die « collapsa ... Ecc1e-
sia»= metaphorisch, und zwar vom theologischen Stand- punkt der personalen Auferstehung aus gesehen uneigent- lich gebraucht, was jedoch bei der geläufigen Entsprechung Christus - Ecclesia (' corpus Christi mysticum') ganz legitim war (23). Zum anderen ist entscheidend, dass Damiani in Erinnerung an Heinrichs III. erfolgreiche Reformhilfe dem Sohn und Nachfolger des Kaisers als Adressaten des Briefes eine ebenso zentrale Rolle bei der Verwirklichung seines neuen Reformwunsches zuwies (24).
Kirchenreformerische Aktivität gehörte für Petrus Da- miani mit zur Herrschafts-Funktion des imperialen Monarchen in der Ecclesia. Aus solchem Verständnis hat er auch, nach der enttäuschten Hoffnung auf Gregor VI., das Eingreifen des Herrschers im Jahre 1046 erlebt und immer hochgehalten (25). Ohne diese Anschauung vom heilsgeschichtlichen Königtum war die Formulierung der brieflichen Aufforderung an Hein- rich IV. nicht möglich (26). Petrus Damiani blieb damit wie
(23) O. J. BLUM, St. Peter Damian. His Teaching on the Spiritual -Life (Ca- tholic University of America. Studies in Mediaeval History. New Series 10) Wa-
shington 1947, S. 140-145 (a The Mystical Body of Christ »). (24) Vgl. vor Anm. 7: a Sed sicut olim per i11um, non amodo
per te... ». (25) Zum Eingreifen des Königs gegen \Vidger von Ravenna vgl. die 'laudatio'
in ep. 7,2, MPL 144, Sp. 436; Heinrichs III. Eingriffe in Sutri und Rom rühmte Damian im c. 38 des « Liber gratissimus », cd. v. HEINEMANN (MGH, Libelli de fite 1) S. 71 und rechtfertigte die 'Papstwahlordnung' des Patriziats von 1046
ausdrücklich noch in der « Disceptatio synodalis » (wie Anm. 5) S. 80f. DRESSLER (wie Anm. 8) S. 95f.
(26) Neuere Einsichten fördern das Verständnis solcher Anschauungen. Es
seien hier als Auswahl genannt: P. E. Sctiw . s, Kaiser, Könige und Päpste. Ge-
sammelte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters 1-4 (in fünf Teilen), Stuttgart
1968-1971; Das Königtum. Seine geistigen und rechtlichen Grundlagen. Mäinau-
vortrvge 1954 (Vorträge und Forschungen 3) Darmstadt '1965 (1956); M. MAC-
cARRo. NE, II socrano 'Vicarius Dei' nell'alto nredio evo (La regalitä sacra. Con-
tributi al tuna dell' VIII congresso intcrnazionale di scoria delle religioni - Roma,
289
-
mit seinem Kirchenbegriff, der Regnum und Sacerdotium tra- ditionsgemäss als Einheit umschloss, in der alten Ord- nungswelt des Frühmittelalters verwurzelt (27). Man hat sie auch mit der Formel vom « ungeschiedenen Einheitsdenken » erläutert (28). Dieses Denken kannte nicht den Kampf swi- schen beiden Gewalten um den Vorrang, sondern liess den Reformmönch aus Ravenna auch als römischen Kardinalbischof noch für den gemeinsamen Kampf plädieren, den Sacerdotium und Regnum zu führen hätten, damit die gefallene Kirche aufer- stehe und die verwirrte kirchliche Ordnung neu erblühe.
aprile 1955 - Studies in the History of Religions. Supplements to «Numen» 4, Leiden 1959, S. 581 - 594) mit den anderen einschlägigen Beiträgen dieses Kon- greß-Bandes. Aus den Arbeiten einer Münsterer Historiker-Gruppe unter Karl Hauck im interdisziplinären Sonderforschungsbereich 'Mittelalter' erschienen zur religionsgeschichtlichen Monarchieforschung bisher: L. BORNSCHEUER, Miseriae re- gum. Untersuchungen zum Krisen- und Todesgedab, n in den herrschaftstheologi- schen Vorstellungen der ottoniscb-saliscber. Zeit (Arbeiten zur Frühmittelalterfor- schung = AFMF 4) Berlin 1968; K. H. KRÜGER, Königsgrabkirchen der Fran- ken, Angelsachsen und Langobarden bis zur Mitte des B. Jahrhunderts. Ein histo- rischer Katalog (Münstersche Mittelalter-Schriften = MMS 4) München 1971; CHR. SCHNEIDER,
, Prophetisches Sacerdotium und heilsgeschichtliches Regnum im Dialog 1073-1077. Zur Geschichte Gregors VII. und Heinrichs IV. (AMIS 9) Afiin- chen 1971. Der Verf. selbst schreibt in der Gruppe eine Dissertation über die von lokalen (d. h. auch imperialen) Traditionem mitgeprügte frühere Zeit Petrus Da- mianis im Kreis der Ravennater Reformer.
(27) Uber die « Funktion » von Regnum und Sacerdotium « in der Phase der Kohärenz» des Frühmittelalters grundsätzlich F. Ke spF, Zur politischen Lehre der früh- und hochmittelalterlichen Kirche (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 78, Kanonistische Abteilung 47,1961, S. 305 - 319) S. 307, bes. S. 317 (Zitat).
(28) DRESSLER (wie Anm. 8) S. 98.
290