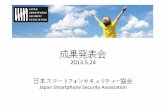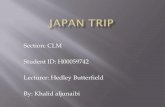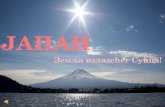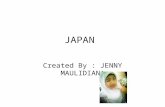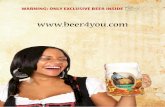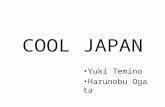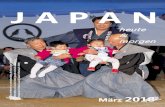Japan
-
Upload
ala-mushkei -
Category
Documents
-
view
20 -
download
0
Transcript of Japan
-
1
Jochen A. Br (Heidelberg)
Sprachtheorie und Sprachwissenschaft der deutschen Romantik 0 Einleitung 1 Sprache als Poesie 2 Sprachskepsis 3 Verstehenslehre 4 Rhetoriktheorie 5 Philologie 6 Fazit 7 Zitierte Literatur
0 Einleitung 0.1 In der Geschichte der Sprachtheorie und Sprachwissenschaft wird die deutsche Romantik traditionell stiefmtterlich behandelt. Zeitlich und auch konzeptionshistorisch eingerahmt von Autoren wie Hamann und Herder einerseits und Wilhelm von Humboldt andererseits, werden spezifisch romantische Beitrge zur Sprachtheorie oft kaum zur Kenntnis genommen, und auch in der Wissenschaftsgeschichte gelten, von der frhen germanistischen Philologie mit Vertretern wie Jacob Grimm und Karl Lachmann und der historischen Grammatik mit Vertretern wie Franz Bopp aus gesehen, Vorlufer wie Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck kaum als relevant. Seitens der Historiographie der Sprachphilosophie vollends werden selbst Autoren, die der Sprache weitaus weniger Beachtung geschenkt haben als die Romantiker (so z. B. Kant und Hegel), blicherweise in jeder berblicksdarstellung behandelt, whrend etwa Novalis oder August Wilhelm Schlegel ignoriert werden. Die vergleichsweise bersichtliche Forschung der letzten 30 Jahre (zur lteren Forschung vgl. Br 1999a, 1) lsst sich grob in vier Strnge einteilen: Untersuchungen zur Dichtungstheorie (z. B. Vietta 1970, Huge 1971, Frhwald 1983, Jaeger/Willer 2000 und Jaeger 2001), zur Hermeneutik und bersetzung (z. B. Huyssen 1969, Gebhardt 1970, Frank 1978, Behler 1987a, Hrisch 1987, Hrisch 1988, Di Cesare 1996, Br 2003a), zur Sprachtypologie und zur historischen Grammatik (z. B. Schmidt 1986, Schmitter 1993, Br 2002) und zur Philologie (z. B. Brinker-Gabler 1980, Rother 1988, Br 2003b). Zudem finden sich Arbeiten zu einzelnen Themen, z. B. zur Sprachursprungstheorie (Hausdrfer 1989), und zu einzelnen Autoren, z. B. zu F. Schlegel (Di Cesare 1990, Behler 1994), zu Novalis (Di Cesare 1995) und Bernhardi (Schlieben-Lange/Weydt 1988, Wild-Schedlbauer 1990). Gesamtberblicke, im Einzelnen gleichwohl stark selektiv mit dem Fokus auf Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie , bieten Gipper/Schmitter (1985) und Gipper (1992). Defizitr ist aber auch die bislang umfassendste Arbeit, die Untersuchung von Br (1999a) zur Sprachreflexion der deutschen Frhromantik: Abgesehen vom thematischen Zuschnitt, der die sptere Romantik ausklammert, fehlen hier beispielsweise eine einlsslichere Beschftigung mit der Sprachtypologie und mit der Rhetorik-theorie. 0.2 Geistesgeschichtlich ist die deutsche Romantik in die Zeit des spten 18. Jahrhunderts und der ersten Hlfte des 19. einzuordnen (ca. 1795 bis ca. 1830, in bestimmten Auslufern sogar bis ca. 1850). Dabei scheint sich auch in der deutschen Forschung immer mehr die Auensicht durchzusetzen, das weit gefasste Romantikverstndnis, wie es beispielsweise in Frankreich und Grobritannien vertreten wird. Zur deutschen Romantik in solch weitem Sinn gehren nicht allein Autoren wie die Brder Schlegel, Novalis, Tieck, Wackenroder, Schleiermacher, A. F. Bernhardi, Arnim, Brentano, E. T. A. Hoffmann, Eichendorff und Ludwig Uhland, sondern auch beispielsweise Goethe und Schiller, Hlderlin und Heinrich von Kleist. Der damit gezogene geistesgeschichtliche Rahmen ist freilich zu gro, als dass er durch eine berblicksdarstellung wie die vorliegende auch nur annhernd gefllt werden knnte. Es muss daher
-
2
eine thematisch orientierte Auswahl getroffen werden. Der Beitrag gliedert sich in fnf Teile; behandelt werden die romantische Theorie der Sprache als Poesie (1), die romantische Sprachskepsis (2), die romantische Hermeneutik oder Verstehenslehre (3), die romantischen Beitrge zur Rhetoriktheorie (4) sowie die romantischen Beitrge zur vergleichenden Sprachwissenschaft und zur Herausbildung der Germanistik (5); er versammelt Erkenntnisse aus mehreren eigenen Arbeiten (Br 1999a; ders. 2000; ders. 2002), aus denen auch Formulierungen und einzelne Passagen bernommen sind. 1 Sprache als Poesie 1.1 Fr August Wilhelm Schlegel ist die Sprache das Gedicht des gesamten Menschengeschlechtes, dessen Ursprung einer poetischen Anlage zuzuschreiben ist (Schlegel 1801/02, 388). Das heit vor dem Hintergrund der Genietheorie der Zeit: Die Sprache ist zwar ein Werk des menschlichen Geistes, aber ein ursprngliches und nothwendiges (ebd., 184), ein Produkt des menschlichen Dichtungsvermgens, gleichsam eine Urpoesie des Menschengeschlechts (Schlegel 1798/99, 49). Noch unmissverstndlicher heit es an anderer Stelle, dass das Vermgen, welches die Poesie zur eigentlichen schnen Kunst bildet, dasselbe, nur in einer hheren Potenz ist, welches der Sprache ihren Ursprung giebt (1801/02, 251). Schlegel denkt also nicht nur an Dichtung, sondern an ein im weitesten Sinne historisches Universalprinzip, eine Hervorbringung und Bildung letztlich der ganzen Welt. An eine Poiesis eben, denn das griechische Wort poiein, von dem Poesie kommt, bedeutet nichts anderes als machen, bilden, schaffen, hervorbringen. Von eben dieser Wortbedeutung geht der Autor aus und begreift Poesie als schpferische Handlung, genauer gesagt als eine freye schaffende Wirksamkeit der Fantasie (1801/02, 186). Das bedeutet: Weder bildet der Mensch eine uere Welt mittels seiner Sprache einfach ab und macht sie sich so bewusst, noch bringt er eine innere Welt in einem Akt reiner Willkr nur aus sich selbst hervor. Vielmehr verarbeitet er alle Gegenstnde seiner Erkenntnis nach bestimmten durch sein Erkenntnisvermgen gegebenen Regeln im Erkenntnisakt und schafft damit zwar eine neue Welt nach eigenen Gesetzen, indes nicht unabhngig von jener anderen, die auf sein Erkenntnisvermgen eingewirkt hat. Eben diese Umbildung, hinter der man natrlich die Transzendentalphilosophie Kants und des deutschen Idealismus erkennt, nennt Schlegel Poesie (und das ist natrlich dann nicht mehr typisch transzendentalphilosophisch, sondern typisch romantisch):
Der erste Mensch bildete nicht die Gegenstnde passiv nach, er artikulierte sie (gliedbildete sie), vermensch-lichte sie (und verhnlichte sie sich) und unterwarf sie sich so seiner Vorstellung, bildete sie daher um. Poesie ist eine bildende Darstellung der innern Empfindungen und der uern Gegenstnde vermittels der Sprache (1798/99, 7).
In ihrem Ursprung also ist Sprache eine umbildende Abbildung der Welt, gleichsam eine Bearbeitung gegebenen Materials genau das meint der Satz: Sprache ist ursprnglich poetisch (ebd.). Allerdings bleibt nun die Sprache nicht poetisch, und das hat damit zu tun, dass sie von der Verarbeitung sinnlicher Eindrcke immer strker zur reinen Begrifflichkeit tendiert, d. h. zu einem Werkzeug des Verstandes wird. Der Ursprache selbst schreibt Schlegel noch etwas Gesang-hnliches zu, womit er meint, sie sei sonor und stark accentuirt gewesen (1801/02, 400). Im Laufe ihrer historischen Entwicklung schleift sie sich aber immer mehr ab; aus ursprnglicher Poesie wird Prosa (wobei natrlich klar ist, dass das Wort Prosa hier in einem hnlich weiten und von seiner heutigen Bedeutung verschiedenen Sinne verstanden wird wie zuvor das Wort Poesie). Das Prosaische kommt dadurch in die Sprache, dass sich, so Schlegel (1801/02, 403), der Verstand der Zeichen bemchtigt, welche die Einbildungskraft ursprnglich geschaffen hat. Die Symbolik in der Sprache, das Produkt der Phantasie, muss den strengeren aber todten Bestimmungen des Verstandes weichen (ebd., 404). So wird Sprache im Fortgange der Cultur von einer Einheit lebendiger Bezeichnung zu einer Sammlung willkhrlicher conventioneller Zeichen. Am weitesten geht dies in der wissenschaftlichen Sprache, die vom beseelten Hauch zur algebraischen Chiffer herabsinkt (ebd.).
-
3
Es wre allerdings nicht zutreffend, Schlegel aufgrund solcher Aussagen unreflektierten Kultur-pessimismus zu unterstellen. Die ursprngliche Poetizitt wirkt seiner Meinung nach immer gewisser-maen als Gegenkraft der Prosa, so dass er eine Repoetisierung der Sprache fr mglich hlt. Selbst in der prosaischsten Sprache findet sich noch poetisches Grundmaterial:
Begreift man denn nicht, da, da die Poesie ursprnglich in der Sprache daheim ist, diese nie so gnzlich depoesirt werden kann, da sich nicht berall in ihr eine Menge zerstreute poetische Elemente finden sollten, auch bey dem willkhrlichsten und kltesten Verstandesgebrauch der Sprachzeichen, wieviel mehr im gemeinen Leben, in der raschen, unmittelbaren oft leidenschaftlichen Sprache des Umgangs. Viele Wendungen, Redensarten, Bilder und Gleichnisse, die, sogar im plebejesten Tone, vorkommen, sind un-verndert auch fr die wrdige und ernsthafte Poesie brauchbar; und unstreitig liee sich bey einem Geznk von Hkerweibern die Lebhaftigkeit der Vorstellungen eben so gut als Prinzip demonstriren, wie bey jenen ausgehobnen Dichterstellen (1801/02, 389).
Will man Schlegels Vorstellung vom historischen Werdegang der Sprache auf den Punkt bringen, so besteht sie in einem gleichsam dialektischen Dreischritt: Ursprngliche Poesie Prosa (fr ihn der aktuelle Stand) Neue Poesie. Im Sinne der Dialektik soll allerdings im angestrebten Endzustand nicht der Ausgangszustand als solcher wiederhergestellt, sondern der Sprache durch eine Synthesis von ursprnglicher Poetizitt und Prosa eine neue Qualitt gegeben werden.1 Auf den Punkt gebracht ist das Konzept der Repoetisierung in einer Notiz von Novalis, der diesbezglich ganz hnliche Auffassungen vertritt wie Schlegel: Unsre Sprache war zu Anfang viel musicalischer und hat sich nur nach gerade so prosaisirt so enttnt. [...] Sie mu wieder Gesang werden (Novalis 1798a, 283 f.). Derselbe Gedanke findet sich bei Hlderlin (vgl. Br 1999a, 330 f.) und auch bei August Ferdinand Bernhardi:
Der Mensch ist [...] in allem seinem Thun und Treiben nichts als eine Kraft, welche, nur mit Verschiedenheit der uern Bedingungen, ewig in sich zurckkehrt. [...] Im Physischen hat man dies lngst eingesehn, und das Alter oft eine zweite Kindheit genannt. [...] was ist Weisheit anders, als die wiederhergestellte, durch Freiheit und innere Kraft gewonnene Unschuld der Kindheit? Dieser Cyklus, welcher aus der innersten Natur des Menschen erklrbar ist [...], mu sich ebenfals in der Sprache vorfinden. Denn sie ist Allegorie des Menschen und seiner Natur, eine sinnliche Konstruktion seines Wesens, und den Gesetzen desselben, eben so gut wie eine jede andere Aeuerung, unterworfen. Und so mte demnach [...] die gebildeteste Sprache, eben in dem hchsten Punkte ihrer Bildung und um desselben willen, freier und schner zu ihrem Ursprunge zurcklaufen. (Bernhardi 1801, 68 f.)
1.2 Das harmonische Zusammenwirken der menschlichen Seelenkrfte, aus dem Schlegel (1801/02, 388) zufolge die Sprache hervorgeht, findet sein Ende in dem Augenblick, in dem eine dieser Krfte fr Schlegel, wie erlutert, der Verstand die Vormacht im Ensemble anstrebt und tatschlich gewinnt. Repoetisierung heit demzufolge nichts anderes, als der Sprache wieder zu sinnlicher Qualitt zu verhelfen. Die konkreten Vorschlge, die Schlegel hierzu unterbreitet, nehmen vor allem in den Blick: den Bereich der Symbolik und Tropik, die Frage nach einem spezifischen Inventar der poetischen Diktion im Wortschatz (ausdrcklich behandelt werden Archaismen, Neologismen und Provinzia-lismen) wie in der Grammatik (ausdrcklich behandelt werden Flexion, Wortbildung und Satz-stellung), die Theorie des Wohlklangs (insbesondere Reim und Silbenma), die Verwendung von Epi-theta und die (Re)motivierung arbitrrer sprachlicher Zeichen durch Rckbesinnung auf etymologi-sche Zusammenhnge (vgl. Br 1999a, 119139). Ziel der in sich durchaus divergenten berlegungen ist neben der Strkung der sinnlichen Qualitten der Sprache zugleich eine Elitarisierung des Sprachgebrauchs, da Schlegel als prosaisch auch das allgemein bliche ansieht. Die intensive gedankliche Beschftigung mit den Fragen der Repoetisierung zeigt deutlich, wie wichtig dieser Aspekt aus romantischer Sicht ist. Das Gewicht, das darauf gelegt wird, kann jedoch nur verstndlich werden, wenn man im romantischen Sinne die Sprache als conditio humana begreift: Sie ist dasjenige, wodurch der menschliche Geist berhaupt zur Besinnung gelangt, und als solches ist
1 Das Anliegen ist am angemessensten vielleicht als rckwrtig orientierte Progression zu fassen (vgl. Br
1999a, 49 u. .).
-
4
sie Poesie in dem erluterten umfassenden Verstndnis, das mit der heutigen Bedeutung des Wortes nicht viel gemein hat. Es liee sich annehmen, dass, wer eine so hohe Meinung von der Sprache hat, an ihren Mglich-keiten niemals zweifeln, und dass, wer sie sogar fr Poesie hlt, ihr gerade in Bezug auf den Ausdruck von Gefhlen sehr viel zutrauen werde. Aber das Gegenteil ist der Fall, und auch das hat mit der romantischen Auffassung der Sprache zu tun. Denn zur Dichtung gehrt die (in aller Regel weitaus problematischer) Deutung. 2 Sprachskepsis 2.1 Im Jahre 1801 beginnt August Wilhelm Schlegel eine Liaison mit Sophie Tieck-Bernhardi, der Schwester seines Freundes und literarischen Mitstreiters Ludwig Tieck und Frau des ebenfalls dem Frhromantikerkreis nahestehenden Sprachtheoretikers und Kunstkritikers August Ferdinand Bern-hardi. Da niemand davon erfahren soll, mssen alle Liebesbriefe heimlich geschrieben werden. Schle-gel versucht dabei aus Vorsicht, kompromittierende uerungen und Bekenntnisse mglichst zu vermeiden, was ihm jedoch die exaltierte Sophie Bernhardi als Gefhlsklte auslegt. Schlegel ist darber verrgert: Ich stellte mir vor, mein Eifer, die Rckkehr zu veranstalten, kaum da ich von der Reise hier zur Ruhe gekommen war, wrde hinreichen, Dir die wahre berzeugung von meinen Gesinnungen zu erhalten, und statt alles Schreibens gelten knnen. Aber so seyd ihr, immer mehr auf Reden als auf Handlungen zu geben. (In: Krner 1936, 17 f.) Die Briefpartnerin protestiert ihrerseits: Du hast mich [...] mit Deinem so seid ihr immer unter die Rubrik von Weibern bringen wollen und ich kan nicht lugnen da Du mir mit diesem Bemhen recht wie ein Mann vorgekommen bist. (Ebd., 23) Sie macht deutlich, dass sie mit solch oberflchlicher Art der Auseinandersetzung nicht einverstanden ist, dass sie vielmehr intellektuell ernst genommen sein und ihre Aussagen vor sprachtheoretischem Hintergrund verstanden wissen will:
Freilich bin ich so albern da ich weit mehr auf Worte als auf Handlungen gebe. Ich lugne es nicht und da es uns einmal nicht mglich ist etwas anders als au unserm Innern herau zu betrachten so lt sich dies sehr leicht erklren da ich mit meinen Handlungen eben weil ich sie als usserligkeit betrachte weit freigebiger bin als mit meinen guten Worten die ich als eine usserung meines Gemths betrachte und nur gegen sehr wenige verbrauche. (Ebd.)
Dass solche Aussagen ber den Wert ebenso wie die Problematik der Worte tatschlich durch sprachtheo-retisch-hermeneutische berlegungen fundiert sind, zeigt der Blick auf einen anderen Text von Sophie Bernhardi, der bereits vor ihrer Beziehung mit Schlegel im Athenaeum, der literarischen Programm-zeitschrift der Frhromantik, verffentlicht worden war. In ihm wird ein prinzipieller Zweifel an den Mglichkeiten des Verstehens greifbar, welche die sprachliche Mitteilung von Empfindungen, die ue-rung und Preisgabe des Inneren als prekre und daher nur gegenber wenigen, besonderen Menschen mgliche Angelegenheit erscheinen lassen.
Vergeblich ist es, zu wnschen, da der Freund, den wir lieben, uns ganz in unserer eigensten Eigenthm-lichkeit verstehen mchte; wir wnschen es auch im Grunde nicht, sondern immer mchten wir nur die Falten unsers Herzens vor ihm auseinander schlagen, wo wir die Verwandtschaft zu ihm fhlen. Das was unsere Scheidung von allen andern Wesen ausmacht, wodurch wir auch von dem geliebtesten Freunde abgesondert und einzeln stehen, suchen wir sorgfltig zu verhllen, damit er sich nicht vor dem fremden Wesen entsetzen mge und wre es einem Menschen mglich, die innerste Eigenthmlichkeit seines geliebtesten Freundes aufzufassen und auszusprechen, so wrde den Freund ein Schauder wie vor einem Zauberer ergreifen, der die Gewalt htte, den Geist aus unsern Krpern zu ziehen und ihn uns selbst anschaulich hinzustellen, und wir wrden auf immer entfremdet von ihm zurcktreten. (Tieck-Bernhardi 1800, 210.)
In solchem Zusammenhang wird das Besondere und Heikle verstndlich, das Sophie Bernhardi der sprachlichen uerung beimisst. Es ist die Verschiedenheit der Menschen, die Tatsache wesentlicher Nicht-bereinstimmung, welche die Sprache offenbart sie, die doch gerade den Zweck der Verbindung und Gemeinschaftsstiftung erfllen sollte. In der Tat schafft sie aber beides, Trennung und Verbindung, indem sie immer aus zwei Komponenten (uerung und Deutung) besteht. Gemeinschaft kann daher zwar nicht einseitig gestiftet werden, wohl aber zwischen einander vertrauten und gewogenen Menschen
-
5
sich aktuell ereignen. Das ist der Grund fr das Aufsparen der persnlichen, Zugang zum eigenen Inneren gewhrenden Worte fr wenige, besonders nahestehende Menschen, bei denen eine besondere Kom-petenz der Deutung vorausgesetzt wird. Der bei Sophie Bernhardi zum Ausdruck kommende Zweifel an den Mglichkeiten der Sprache und des Verstehens ist in der deutschen Romantik weit verbreitet. Der Mensch bleibt nach dieser Auffassung wesentlich auf sich selbst zurckgeworfen. Was seine Persnlichkeit ausmacht, ist im Wortsinne individuell: nicht teilbar, also auch nicht mit-teilbar. Eine Verstndigung ist daher nur dort problemlos mglich, wo es um Unwesentliches, Unpersnliches geht.
Man spricht wohl gerne, man plaudert, wie die Vgel, so lange die Welt, wie Mailuft, einen anweht; aber zwischen Mittag und Abend kann es anders werden, und was ist verloren am Ende? [...] [D]ie Sprache ist ein groer berflu. Das Beste bleibt doch immer fr sich und ruht in seiner Tiefe, wie die Perle im Grunde des Meers. (Hlderlin 1799, 118.)
Die Mglichkeiten einer uerung des Inneren, einer Mitteilung dessen, was den Menschen emotional bestimmt, sind beraus beschrnkt: Der Mensch ist sehr arm [...]; denn wenn er auch einen recht kostbaren Schatz im Busen trgt, so mu er ihn wie ein Geiziger verschlieen, und kann seinem Freunde nichts davon mittheilen oder zeigen. Thrnen, Seufzer, ein Hndedruck sind dann unsre ganze Sprache. (Tieck 1797 [1796], 70.) Zumindest die Flle der Empfindung und ihren unmittelbaren Andrang kann die Sprache weder darstellen noch vermitteln; sprachliche Fassung bedeutet stets Reflexion und Brechung, Abstraktion und Reduktion: Allmhlig lste mein Taumel sich in Worte auf. Ich fhlte weniger, da ich sagen konnte, wie viel ich fhle. Die Sprache ist nur Folge der Empfindung. Der wahre Augenblik der Empfindung duldet keine Sprache. (Mereau 1794, 39 f.) Es ist der Gegensatz zwischen emotionaler und rationaler Sphre, zwischen Empfindung und Begriff2, der hier angesprochen ist. Aus romantischer Sicht steht die Sprache zwischen beiden in der Mitte. Das Problem dabei ist, dass fr beide Sphren dieselben Zeichen gebraucht werden mssen. Sobald es vorrangig um die Darstellung von Empfindungen geht, erscheint daher die Wortsprache als wenig geeig-netes Medium: Die Empfindung inhriert [...] in der Sprache immer der Bezeichnung der Begriffe. Die Sprache kann daher auch nur indirekt zum Ausdruck der Empfindungen dienen, sie ist gegen die unendlichen Nuanzen der Empfindung erstaunlich arm. (A. W. Schlegel 1798/99, 72.) Insbesondere fr die Empfindungen der Liebe gilt die Sprache als unangemessen:
Sprechen? o ich bin ein Laie der Freude, ich will sprechen! Wohnt doch die Stille im Lande der Seeligen, und ber den Sternen vergit das Herz seine Noth und seine Sprache. [...] O wer die Stille dieses Auges gesehn, wem diese sen Lippen sich aufgeschlossen, wovon mag der noch sprechen? (Hlderlin 1797, 50 f.)
Dem gem ist Sprache auch als Kommunikationsmittel zwischen Liebenden kaum brauchbar. Wir sprachen sehr wenig zusammen, berichtet Hyperion ber seinen Umgang mit Diotima: Man schmt sich seiner Sprache. Zum Tone mchte man werden und sich vereinen in Einen Himmelsgesang. (Ebd., 53.) Dieser Gedanke: den Ausdruck des geheimnivollen Strome[s] in den Tiefen des menschlichen Gemthes (Wackenroder 1799, 220), fr den die Wortsprache als Organon des Verstandes nur unzu-reichend geeignet ist, der Musik als einer reichere[n] Sprache zu berlassen (ebd., 219), ist ein Topos der romantischen Theorie. Die Musik ist Darstellung des Un- oder Halbbewussten fr das Un- oder Halbbewusste; sie ist Medium einer undeutlichen Erkenntnis:
Sie greift beherzt in die geheimnivolle Harfe, schlgt in der dunklen Welt bestimmte, dunkle Wunder-zeichen in bestimmter Folge an, und die Saiten unsres Herzens erklingen, und wir verstehen ihren Klang. In dem Spiegel der Tne lernt das menschliche Herz sich selber kennen; sie sind es, wodurch wir das G e -f h l f h l e n lernen; sie geben vielen in verborgenen Winkeln des Gemths trumenden Geistern, lebendes Bewutseyn, und bereichern mit ganz neuen zauberischen Geistern des Gefhls unser Inneres. (Ebd., 220.)
2 Vgl. auch Mereau (1800, 138): Warum uns so wenig ergreift? Weil der Begriffe so viele; | denn es begeistert nur
das, was unbegreiflich uns bleibt.
-
6
2.2 Eine solche besondere Rolle der Musik ist philosophiegeschichtlich neu. Zweierlei hat sie mglich gemacht: die Aufwertung der sinnlichen Erkenntnis gegenber der rationalen durch Alexander Gott-lieb Baumgarten und die Aufwertung des Gehrs gegenber dem Gesichtssinn durch Johann Gottfried Herder. Von der rationalistischen Philosophie cartesianischer Prgung wurde die sinnlich-anschauliche Erkenntnis im Unterschied zur rationalen Erkenntnis traditionell als cognitio inferior gesehen. Erst Baumgarten, der das Ensemble der sogenannten niederen Erkenntnisvermgen als analogon rationis fasst, fhrt die sensitive Erkenntnis als eigenwertigen Gegenstand der erkenntnisphilosophischen Theorie ein. Sie ist als analogon rationis in der Aufklrungsphilosophie freilich immer noch von der ratio her bestimmt und bewertet. Gleichwohl werden Gegenstnde und Bereiche genannt, die rational nicht adquat zu fassen sind.3 Damit ist der Weg bereitet fr den bergang von einem Ideal der deutlichen Erkenntnis (cognitio distincta) zu einem der Intuition und Ahnung, wie ihn die Frhro-mantik vollzieht. Fr sie erscheint es im Gegensatz zur Aufklrung nicht mehr allein wnschenswert, die Welt durch analytische Erkenntnis in den Begriff zu bekommen, sondern ebenso, sich mit dem Universum auf dunkle Weise verknpfen4 zu lassen. Im selben Zusammenhang ist auch die Modifikation der traditionellen kognitionstheoretischen Hierarchie der sinnlichen Erkenntnisvermgen zu sehen, in welcher der Gesichtssinn den hchsten Rang einnimmt: Herders Meinung, dass die Vorrangstellung unter allen Sinnesorganen dem Gehr zukomme. Bedenkt man, dass das Sehen herkmmlicherweise als Manifestation deutlicher Erkenntnis gilt, so kann diese akroamatische Wendung (Di Cesare 1990, 128), die Abkehr vom Primat der Optik und damit von der aufklrerischen Licht- und Erleuchtungsmetaphorik, als gegen-aufklrerisch im Sinne von Ulrich Gaier (1989, 272) gelten: Sie steht im Dienste einer Aufklrung der ratio-nalistischen Richtung der Aufklrung ber ihre Grenzen (ebd.). Diese Grenzen eben sind gemeint, wenn das Gehr als direkt korrespondierend mit dem inneren Sinn geschildert wird (A. W. Schlegel 1801/02, 267 f.5). Nur das Gehrte kann den ganzen Menschen erreichen, nur das akustisch Wahrge-nommene affiziert nicht allein den Verstand oder allein die Empfindung, sondern beide zugleich. Nur das Gehrte nimmt der Mensch ganz in sich auf, verbindet es ganz mit sich und setzt sich dadurch in Verbindung mit der Auenwelt: Das Hren ist ein Sehen von innen, das innerstinnerste Bewutseyn (Ritter 1810, 224). Das Gehr ist daher der eigentlich synthetische, der zwischen Subjekt und Objekt ebenso vermittelnde, wie zwischen Subjektivitt und Objektivitt in der Mitte stehende Sinn; es ist unter allen Sinnen des Universums der hchste, grte, umfassendste, ja es ist der einzige allgemeine, der universelle Sinn (ebd.). Direkt und ausschlielich auf den inneren Sinn (die reine Subjektivitt) bezogen ist allein die Musik. Sie ist die von allen ueren Objekten unabhngige Sprache der Empfindung, die eine innere Welt darstellt (A. W. Schlegel 1798/99, 71). Die Wortsprache bleibt ihr gegenber uerlich, denn eine blo sinnliche Anschauung mu zu Begriffen werden, wenn sie ausgedrckt werden soll (ebd., 159), mit anderen Worten, das nur subjektiv Empfundene muss objektiviert werden. Allerdings ist festzustellen: Die Aufwertung des emotionalen Bereichs bedeutet zumindest fr die Frhromantik noch keineswegs eine Geringschtzung des rationalen. Bei aller Rationalismuskritik geht es den Frhromantikern nicht darum, den Verstand auszublenden, sondern darum, ihn zu relativieren im Wortsinn: ihn in eine Beziehung zu setzen, und zwar mit seinem Komplement, dem Gefhl. Nur beide zusammen machen den Menschen aus, und nur die Erkenntnis ist vollstndig, die zugleich analytisch-
3 Insbesondere gilt dies fr das Gebiet der Schnheit, das zwischen Intellekt und reiner Sinnlichkeit in der Mitte
angesiedelt ist: Die Warheit stehet fest, kein deutlicher auch kein vllig dunkler Begrif, vertrgt sich mit dem Gefhle der Schnheit. Jener, weil unsere eingeschrnkte Seele keine Mannigfaltigkeit auf einmal deutlich zu fassen, vermag. Sie mu nothwendig ihre Aufmerksamkeit von dem Gantzen gleichsam abziehen, und einen Theil des Gegenstandes nach dem andern berdenken. Dieser hingegen, weil die Mannigfaltigkeit des Gegen-standes in seine Dunkelheit gleichsam verhllt, und unsrer Wahrnehmung entzogen wird. (Mendelssohn 1755, 50.)
4 Ludwig Tieck an August Wilhelm Schlegel (in: Lohner 1972, 74). 5 Schlegel bezieht seine Unterscheidung zwischen innerem und uerem Sinn vermutlich aus Kants Transzen-
dentaler sthetik. Der uere Sinn richtet sich nach Kant auf Objekte, der innere auf das Subjekt der Er-kenntnis: Vermittelst des ueren Sinnes [...] stellen wir uns Gegenstnde als auer uns [...] vor (Kant 1787, 37). Durch den inneren Sinn schaut das Gemt sich selbst, oder seinen inneren Zustand an (ebd.).
-
7
scharfe Wahrnehmung der Dinge als einzelner und, wie Novalis (1798c, 537) schreibt, Gefhl des undeutlichen Ganzen, [...] Anschauung der Gegenstnde zusammen in mannichfacher Erleuchtung und Verduncklung ist. Auch fr das Verhltnis von Sprache und Musik gilt daher: Obwohl die Musik der Wortsprache als Ausdrucksmedium des inneren Menschen, seiner Emotionalitt und Subjektivitt, berlegen ist, wird sie doch nicht prinzipiell ber sie gestellt. Die Wortsprache, wenngleich sie nicht ausschlielich das Gefhl affiziert, so wie die Musik, hat dennoch Anteil am Gefhl und umfasst daher, anders als die Musik, die ihrerseits den Verstand nicht affiziert, das ganze Gebiet des menschlichen Geistes (A. W. Schlegel 1801/02, 269). Sie besteht aus hrbaren Zeichen, aber von Gegenstnden, deren Vorstellung in sich zu erwecken, die Einbildungskraft durch sie aufgefordert wird (ebd., 270). Damit hat sie zugleich Anteil an dem auf Objekte gerichteten ueren Sinn; sie ist folglich eine Combi-nation des innern und des uern Sinnes, und umfat das ganze Gebiet des menschlichen Geistes (ebd.). Erst in dem Augenblick, in dem das Interesse an diesem ganzen Gebiet zugunsten einer einseitigen Betonung der subjektiven Empfindung aufgegeben wird, kommt die Musik zu absoluter Wertschtzung. Nietzsche hat dies in einem Rckblick auf die erste Hlfte des 19. Jahrhunderts auf den Punkt gebracht: Der Cultus des Gefhls wurde aufgerichtet anstelle des Cultus der Vernunft, und die deutschen Musiker, als die Knstler des Unsichtbaren, Schwrmerischen, Mrchenhaften, Sehnschtigen, bauten an dem neuen Tempel erfolgreicher, als alle Knstler des Wortes und der Gedanken. (Nietzsche 1887, 171 f.) Die Frhromantiker bleiben dagegen, zumindest solange sie Frhromantiker sind, Knstler des Wortes und der Gedanken. Sie gebrauchen in Bezug auf die Wort-sprache zwar schon dieselben Armuts- oder rmlichkeitstopoi, die dann spter beispielsweise in Kierkegaards Mozart-Enthusiasmus eine Rolle spielen, aber sie sind zu sehr Transzendentalidealisten, um nicht eine Tatsache ber alles andere zu stellen: Sprache ermglicht Selbstbewusstsein: Die Musik kann selbst fr die Stille einen Ausdruck finden; der Musiker drckt Gedanken aus, Spiele der Empfindung. Die Sprache ist ein unendlich rmeres Medium, als jene reine Sprache der Tne; aber der Musiker kann nicht sagen, was er in ihr ausgedrckt hat. (A. W. Schlegel 1798/99, 121.) Vor allem aus diesem Grund halten die Frhromantiker die Sprache fr nicht verzichtbar. Folglich suchen sie nach Mglichkeiten, sie fr den Ausdruck des Emotionalen geeigneter zu machen. Als gangbarer Weg erscheint es insbesondere, die Sprache in einen angenommenen Urzustand zurckzu-fhren, in dem sie noch nicht hauptschlich zu Verstandeszwecken ausgebildet war, d. h. noch nicht ausschlielich aus allgemeine[n] und willkrliche[n] Zeichen (A. W. Schlegel 1801/02, 244) be-stand. In der Tat wird dieser Urzustand als qualitativ nher an der Musik beschrieben: Die lteste Sprache wird gesanghnlich gewesen sein (A. W. Schlegel 1798/99, 8). Dabei ist freilich nicht an Gesang im knstlich ausgebildeten Sinne, etwa an Lieder oder Arien zu denken, sondern an uerungen, die strker als das artikulierte Sprechen der Passivitt (A. W. Schlegel 1801/02, 374), der Leidenschaft unterworfen sind und daher unmittelbarer das Unbewusste, Unwillkrliche zum Ausdruck bringen knnen. 2.3 Die Rckfhrung der Sprache in einen Zustand, in dem sie nicht vorrangig vom Verstand be-herrscht ist, soll unter anderem durch eine Remotivierung der sprachlichen Zeichen erreicht werden (vgl. oben). Vorbildhaft fr ein solches Sprachverstndnis ist ein ungebrochenes Verhltnis zum Wort und seiner Semantik, wie es naive Menschen haben. Selbst Gru- und Abschiedsfloskeln erscheinen hier in einer ursprnglichen Bedeutung:
Annonciata ward durch die Rede ihres Vaters sehr gerhrt, die letzten Worte nmlich, gehe mit Gott, mein Kind, bewirkten ihr eine heftige Bewegung, denn in diesen selbstgebildeten Ausdrcken des Herzens, die wie die Wnsche: guten Morgen, guten Abend, die Frage: wie geht es? bey den meisten Menschen durch die Gewohnheit ganz bedeutungslos werden, lag fr sie eine tiefe Bedeutung, und ich glaube dieses mit Recht fr den Zug eines kindlichen und tiefen Gemths halten zu drfen, welches fromm an das Wort glaubt, und dem der Sinn nie verloren geht. (Brentano 1801, 411.)
Fr die Frhromantiker selbst ist ein derart ungebrochenes Vertrauen auf das Wort freilich Wunsch-denken. Selbst Autoren, die wie Sophie Bernhardi weit mehr auf Worte als auf Handlungen gebe[n] (vgl. oben), stimmen immer wieder in die Klagen ber die Unzulnglichkeit der Sprache ein. Ursache fr
-
8
ein solch ambivalentes Verhltnis zur Sprache ist eine tief empfundene Sehnsucht nach dem Unendlichen, die als Movens der gesamten frhromantischen Philosophie gelten kann. Die Sprache dient aus romantischer Sicht nmlich nicht allein dazu, die Welt zu benennen (und dabei in einer bestimmten Weise zu fassen), sondern sie dient auch, und ebenso ursprnglich, zur Kommunikation. Im Empfin-den eigener Endlichkeit und Beschrnktheit fhlt der Mensch den Trieb, andre gleichsam in sein eignes Dasein aufzunehmen, und wiederum in ihnen vervielfacht zu leben (A. W. Schlegel 1795/96, 148). Dem ursprnglich-poietischen Sprechakt, in dem die Welt benannt und erkannt wird, ist daher das Kommunikationsbedrfnis immer schon implizit. Das Streben, [...] den Augenblick festzuhalten, die Empfindung zu wiederhohlen, ihr Dauer zu geben, sie allgemeiner zu machen ist nicht nur Be-drfnis der Selbstkonstitution, sondern zugleich Bedrfni der Mittheilung (F. Schlegel, Brief an A. W. Schlegel, in: Behler 1987b, 283). Auf diesen Grundgedanken kommt vor allem Friedrich Schlegel immer wieder zurck. Besonders eindrcklich formuliert er ihn im Gesprch ber die Poesie (1800): Der Mensch ist ein beschrnktes, unvollkommenes Wesen; seine Sicht der Welt ist eine beschrnkte, unvollkommene. Dies nun kann der Geist nicht ertragen: ohne Zweifel weil er, ohne es zu wissen, es dennoch wei, da kein Mensch schlechthin nur ein Mensch ist, sondern zugleich auch die ganze Menschheit wirklich und in Wahrheit seyn kann und soll (F. Schlegel 1800a, 285 f.). Die Kommunikation ist eine Art und Weise, mit dieser Beschrnktheit und Unvollkommenheit umzugehen und sie zumindest augenblicksweise zu kompensieren: Der Mensch, sicher sich selbst immer wieder zu finden, geht immer von neuem aus sich heraus, um die Ergnzung seines innersten Wesens in der Tiefe eines fremden zu suchen und zu finden. Das Spiel der Mittheilung und der Annherung ist das Geschft und die Kraft des Lebens, absolute Vollendung ist nur im Tode. (Ebd., 286.) Es ist dieses Bedrfnis nach Erweiterung, nach berwindung der Beschrnktheit des Individuums, das die bekannte frhromantische Leidenschaft fr Symbiose und Synergie (Symphilosophie, Sym-poesie, Synkritik etc.) erst ganz verstndlich werden lsst. In der Tat empfindet besonders Friedrich Schlegel es zutiefst. Schon frh sieht er im Menschen zwar etwas wunderbar Schnes und unend-lich Reiches, aber dabei zerfrit zugleich das Gefhl unsrer Armuth ihm jeden Augenblick seines Lebens (Brief an August Wilhelm Schlegel, in: Behler 1987, 283). Er ahnt, dass er ewig unbe-friedigt seyn werde (ebd., 18) und berichtet von einer verzehrenden [...] Sehnsucht nach dem unendlichen (ebd., 24). Diese ewig ungestillte Sehnsucht, von Hegel (1835, 103) in Verkennung ihrer hermeneutischen Relevanz als romantische Befriedigungslosigkeit verhhnt, fhrt zu einer besonderen Bedeutung der Kommunikation, die nicht zuletzt auch im erkenntnistheoretischen Zusammenhang angenommen wird. Die menschliche Gemeinschaft, die kommunikative Interaktion erscheint dann als Vorausset-zung der Erkenntnis: Umsonst ist alles fr denjenigen da, der sich selbst allein stellt; denn um die Welt anzuschauen [...], mu der Mensch erst die Menschheit gefunden haben, und er findet sie nur in Liebe und durch Liebe (Schleiermacher 1799, 228). Die Aussage wird durch eine deutende Nacher-zhlung des biblischen Schpfungsmythos erlutert:
Solange der erste Mensch allein war mit sich und der Natur, waltete freilich die Gottheit ber ihm, sie sprach ihn an auf verschiedene Art, aber er verstand sie nicht, denn er antwortete ihr nicht; [...] der Sinn fr die Welt ging ihm nicht auf; auch aus dem Innern seiner Seele entwikelte er sich nicht [...]. Da erkannte die Gottheit, da ihre Welt nichts sei so lange der Mensch allein wre, sie schuf ihm die Gehlfin, und nun erst regten sich in ihm lebendige und geistvolle Tne, nun erst ging seinen Augen die Welt auf. In dem Fleische von seinem Fleische und Bein von seinem Beine endekte [sic] er die Menschheit, und in der Menschheit die Welt; von diesem Augenblik an wurde er fhig die Stimme der Gottheit zu hren und ihr zu antworten. (Ebd., 227 f.)
Das aus Genesis 2,18 bernommene Wort Gehlfin gewinnt hier einen kognitiven Sinn: Das kommu-nikative Gegenber erst verhilft dem Menschen zur erkenntnisgenerierenden Konfrontation mit sich selbst und der Welt. Eine derart radikale Sichtweise steht zwar im Gesamtkontext der Frhromantik eher vereinzelt da, aber die prinzipielle Relevanz des kommunikativen Aspekts ist allgemein aner-kannt. Der Ansatz ist stets der gleiche: Der Mensch sprt seine eigene Unvollkommenheit und empfindet daher Sehnsucht nach Gemeinschaft. Nur ein hheres Wesen oder ein schlechteres als der Mensch kann fr sich glcklich seyn. (Tieck-Bernhardi 1800, 206.) Der edlere Mensch kann nichts fr sich thun, es wird ihm alles nur etwas in Beziehung auf andere (ebd., 205).
-
9
Im kommunikativen Akt wird der menschlichen Unvollkommenheit augenblicksweise etwas abge-holfen. Kommunikation meint fr die Frhromantiker immer eine partielle Vereinigung, ein berein-kommen getrennter Individuen: [D]er Zweck der Darstellung ist zunchst Mittheilung, das empfan-gende Subjekt nimmt Theil an den Bildern, Begriffen, Ideen des Darstellenden, ihm wird mitgetheilt (Bernhardi 1803, 4). Dabei ist zu beachten, dass Gemeinschaftsstiftung unbedingten Vorrang vor Informationstransfer hat: Wir wollen nicht blo Vorstellungen in dem andern erregen, sondern als die unsrigen (A. W. Schlegel 1803/04b, 290; Kursivierung von mir, JAB). Es geht aber den Romantikern nicht allein um die Verbindung von Menschen untereinander, sondern da der Mensch allseitig perfektibel ist und in jeder Hinsicht einen Drang nach Gemeinschaft und Teilnahme fhlt um die Verbindung des Menschen mit allen anderen Lebewesen: Jedes Thier vernimmt die Stimme seines Geschlechts. Der Mensch die Stimmen aller (F. Schlegel 1795, 223). Dieser panhermeneutische Ansatz kann in seiner radikalsten Ausprgung bis hin zur Forderung nach schlechthin universaler Kommunikation, nach Kommunikation mit der gesamten Schpfung gehen: Wird nicht der Fels ein eigenthmliches Du, eben wenn ich ihn anrede? (Novalis 1798b, 100.) Solche Allverstndigung setzt voraus, dass alles Bedeutung hat und dass diese Bedeutung prinzi-piell auch erschlossen werden kann. Das ist nach frhromantischer Auffassung mglich durch Liebe, die Fhigkeit zur Einfhlung, zur Allsympathie. Durch Liebe
versteht die Seele die Klage der Nachtigall und das Lcheln des Neugebornen, und was auf Blumen wie an Sternen sich in geheimer Bilderschrift bedeutsam offenbart, versteht sie; den heiligen Sinn des Lebens wie die schne Sprache der Natur. Alle Dinge reden zu ihr und berall sieht sie den lieblichen Geist durch die zarte Hlle (F. Schlegel 1799, 82).
Eine anschauliche Zusammenstellung der gesamten Allsympathie-Topik prsentiert Sophie Mereau in ihrem Roman Das Blthenalter der Empfindung:
Gleich einem rein gestimmten Instrument, das nur auf den Knstler wartet, welche Harmonien er darauf hervorrufen will, war mein Herz fr jeden Eindruk empfnglich, von sen Ahndungen beflgelt, und mit heitern Bildern erfllt. Ich drkte die ganze Welt an meinen Busen, und drstete nach dem Genu aller der Herrlichkeiten, die ich in ser Trunkenheit verworren vor mir verbreitet sah. Die ganze Natur schien in mein Schiksal verwebt zu seyn. Das frohe Aufstreben ihrer Krfte, das lebendige Spiel ihrer Erzeugnisse, der jugendliche Reiz ihrer Formen, alles trug so sichtbar die Farbe meiner innern Erscheinungen. Im frohen Taumel gab ich mich allem hin, und fand mich in allem wieder (Mereau 1794, 4 f.). Die Kehle des Vogels hatte willkhrlichen Ausdruk; das Wehen des Blthenbaums war Zeichen innrer Gefhle. Beides wirkte innig auf mich; mit beiden fhlte ich mich verwandt, und es schien mir, als verstnde ich ihre stille Sprache, ohne sie in Worte bersezzen zu knnen. Gieng ich dann aus meinen Blthenwldern hervor, und trat auf die Hhen hin, wo ich in die unermeliche Sphre von Gewsser hinaussah ha! wie ergriff mich da der Anblik dieser ungeheuern Wasserwelt, die, wie die Phantasie keine Grnzen hat! Es drohte mir die Brust zu zersprengen; verschlungen in die Unermelichkeit des Weltalls, verschmolzen in die allgemeine Harmonie der Wesen, fhlte ich mich selbst in dieser Gre untergehen. Ich kannte keinen entzkkendern Gedanken als den, mit allen Geistern ein Ganzes auszumachen (ebd., 7 f.).6
All dies ist keineswegs nur phantastische Exaltation, sondern vielmehr wahrer poetischer Ernst (Tieck, Brief an F. Schlegel, in: Lohner 1972, 57). Das Einfhlen ins Universum, das Sich-eins-Fhlen mit demselben bleibt fr die Frhromantiker nicht nur Theorie, sondern wird zum wirklichen Erlebnis:
6 Der innig empfundene Einklang mit der Natur wird hier allerdings nicht, wie es auch mglich wre, zum
Argument fr eine rousseauistisch-kulturskeptisch motivierte Absage an die zwischenmenschliche Kommuni-kation. Obgleich die Verfasserin ausdrcklich Kritik am zivilisierten menschlichen Zusammenleben bt, zweifelt sie nicht daran, da der Mensch von Natur aus fr den Umgang mit seinesgleichen bestimmt sei: In der Gesellschaft umgeben den Menschen berall die Ringmauern des Gebrauchs [...];berall ragt ihm das stolze Selbst eines andern hochmthig entgegen; berall luft er Gefahr, da eine fremde Vernunft ihr Siegel auf seine Eigenthmlichkeit drkke. Er kmpft um die natrlichsten Rechte qult sich mit erknstelten Bedrfnissen und bt Gerechtigkeit auf Kosten seiner Ruhe. Und doch bildete die Natur ihren Menschen fr ein geselliges Leben. Sie verlieh ihm nicht allein Sprachorgane; auch auf seine Stirn, in seine Augen legte sie den zarten Ausdruk seiner innern Gefhle. Kaum ist das zarte Gebilde seiner Empfindungen vollendet, so erscheint es auch auf seinem Gesicht. Warum trachteten die Menschen diese gttliche Schrift zu verwischen? Warum fanden so wenig Nationen das Geheimni, das Glk des Einzeln im Wohl des Ganzen zu begrnden? (ebd., p. 9 f.).
-
10
Ich kann es dir nicht ausdrcken, wie mir alles in der Welt immer mehr Eins wird, wie ich gar keine Unterschiede von Rumen oder Zeiten mehr statuiren kann, es wird mir Alles bedeutend, alles was Geschichte giebt und Poesie, so wie alle Natur, und alles in mir, sieht mich aus einem einzigen tiefen Auge an, voller Liebe, aber schreckvoller Bedeutung. (Ebd.)
Die auch hier anklingende Klage ber die Unzulnglichkeit der Sprache (Ich kann es dir nicht ausdrcken ...) angesichts der Erfahrung undeutlich empfundener Einheit mit dem Universum ist symptomatisch. Fr die Dunkelheit und Ahnungsflle solcher Erfahrungen, die deutlich nicht ausge-sprochen werden knnen, dienen bevorzugt Schilderungen nchtlicher Naturerlebnisse als Chiffre:
[W]enn der Mond in die Stube scheint, kann ich nicht ruhen, und mu ans Fenster hin. Es ist mir, als rufe er mich, ich msse ihn wieder ansehen, die ganze schne Nacht sprche mit mir, und frage mich scharf aus; die Antwort aber liegt mir tief im Herzen begraben, und es ist mir oft, als msse mir das Herz brechen, damit ich es nur sagen knnte. (Brentano 1801, 386)
3 Verstehenslehre 3.1 Sehnsucht nach dem Unendlichen beinhaltet immer, dass diese Sehnsucht prinzipiell ungestillt bleiben muss.7 Ihre Befriedigung ist eine ins Unendliche hin unabgeschlossene Aufgabe. Hermeneutik, die Deutungskunst bzw. Lehre von der Interpretation, ist unter diesem Aspekt weniger eine Methode des Verstehens als ein Versuch, mit der letztlichen Unmglichkeit des Verstehens zurechtzukommen. Die frhromantische Philosophie stellt sich der Erkenntnis, dass es nicht mglich ist, die Welt totaliter (bei gleichem Recht des Ganzen wie des Einzelnen) auf eine Sinnlinie zu bringen. Sie lsst demgegenber das Unerklrbare zu, d. h. sie rumt die Mglichkeit des Versagens einheitlicher Erklrungsprinzipien ein und beschftigt sich sogar bevorzugt mit dem Phnomen solchen Versagens: Es ist eine hohe und viell[eicht] die lezte Stufe der Geistesbildung, sich die Sphre d[er] Unverstndlichkeit und Confusion selbst zu setzen. Das Verstehen des [Chaos] besteht im Anerkennen (F. Schlegel 1798/99, 227). Unverstndlichkeit ist im Sinne einer transzendentalidealistischen Sichtweise, wonach die Welt im Erkenntnisakt, bestimmten Regeln des menschlichen Erkenntnisvermgens gem, konstituiert wird der Grund, auf dem alle Verstndlichkeit beruht: [I]st [...] diese [...] Welt nicht durch den Verstand aus der Unverstndlichkeit oder dem Chaos gebildet? (F. Schlegel 1800b, 370.) Indem die romantische Hermeneutik das Phnomen der Unverstndlichkeit thematisiert, stellt sie die kritische Frage nach den Bedingungen ihrer eigenen Mglichkeit. Die Antwort auf diese Frage ist mit gutem Grund als Antihermeneutik bezeichnet worden (Hrisch 1987; ders. 1988, 50 ff.). Glcklich gewhlt ist dieser Terminus vor allem deshalb, weil er nicht den falschen Eindruck entstehen lsst, die Frhromantiker htten die Hermeneutik als solche abgelehnt: Antihermeneutische Entwrfe sind nicht ahermeneutisch, sie sind Gegenentwrfe zur herkmmlichen Hermeneutik, indem bei solchen Verste-henskonzeptionen der Nachdruck auf dem skeptischen Aber, auf der Unverstndlichkeit liegt (Behler 1987a, 146). Als Kernsatz dieser frhromantischen Antihermeneutik kann die Aussage gelten, dass man sehr viel Verstand haben [mu], um manches nicht zu verstehen (F. Schlegel 1796/98, 114). Aufgabe der Deutung und Auslegung ist nach frhromantischer Auffassung nicht, einen Autor besser als er [sich] selbst, sondern ihn gerade so gut wie er [sich] selbst zu verstehen (F. Schlegel 1798, 241; vgl. auch Behler 1987a, 148 ff.). Der Interpretierende darf daher auf keinen Fall gewaltsam
7 Dies gilt auch bei gleichzeitiger Empfindung der Aufgehobenheit im Universum. So bemerkt beispielsweise
ein im nchtlichen Park lustwandelnder Spaziergnger, wie die Bsche, die Springbrunnen, der helle Schein, der zwischen den Blttern herabfiel wie das alles miteinander verkehrte, und sich vertraulich unterhielt. [...] Er ging mit all seinen Gedanken in der herrlichen Nacht herum, und verkehrte mit allen Gedanken innerlich. Da fhlte er, wie die ganze Welt ihn als ihres Gleichen behandele, und freuete sich der Gemeinschaft recht sehr; aber doch schien ihm etwas zu fehlen bei aller dieser Herrlichkeit, und wenn er so in den tiefen Himmelssee hinein-blickte, und groe Wolken, wie majesttische Schiffe, vorbersegeln sah: so htte er gewnscht, da droben einen Hafen zu besitzen, wo er die Schiffe anhalten, und zusehn knnte, was fr fremde kstliche Dinge sie geladen htten. (Brentano 1800, 23 f.)
-
11
interpretieren. Gleich ob aus religisem Antrieb, wie beim frhen Schleiermacher, oder aus skular-kritischer Motivation, wie beim frhen Friedrich Schlegel: Die Wuth des Verstehens (Schleier-macher 1799, 252) wird genau dort kritisiert, wo vermittelndes Verstehen-Wollen [...] an die Stelle von Gefhl, Anschauung und Abhngigkeit vom schlechterdings hermeneutisch uneinholbaren Sein des Sinns tritt (Hrisch 1987, 25). Abgelehnt wird ein Verstehen um jeden Preis, eine Hermeneutik, die nicht universal, sondern totalitr wre auch wenn ihr Totalitarismus in freundlichstem Gewande und unter dem Schleier allumfassender Verstndigungsbereitschaft daherkommt (ebd., 29). 3.2 Fr eine Deutungsleistung im Sinne der Frhromantik wird ein Leser vorausgesetzt, der mit dem Autor bzw. dem Text in einen Dialog zu treten bereit und imstande ist, der entgegenkommt, ergnzt, aufs halbe Wort versteht (A. W. Schlegel 1803/04a, 108) und auf diese Weise durch Selbstthtigkeit seiner Fantasie (ders. 1802/03, 719) aktiven Anteil an der Sinnstiftung und (bei poetischen Texten) an der Konstitution berhaupt des literarischen Kunstwerks nimmt (vgl. auch Huyssen 1969, 63 f.). Ein solchermaen ttiger Leser setzt aber wiederum einen Autor voraus, der eine produktive Rezeption fordert und frdert und bereit ist, den Leser als Teilnehmer eines hermeneutischen Dialogs zu akzeptieren und ernstzunehmen:
Der analytische Schriftsteller beobachtet den Leser, wie er ist; danach macht er seinen Kalkl, legt seine Maschinen an, um den gehrigen Effekt auf ihn zu machen. Der synthetische Autor konstruiert und schafft sich einen Leser, wie er sein soll; er denkt sich denselben nicht ruhend und tot, sondern lebendig und entgegenwirkend. Er lt das, was er erfunden hat, vor seinen Augen stufenweise werden, oder er lockt ihn, es selbst zu erfinden. Er will keine bestimmte Wirkung auf ihn machen, sondern er tritt mit ihm in das heilige Verhltnis der innigsten Symphilosophie und Sympoesie. (F. Schlegel 1797a, 161.)
Vorbilder fr die Konzeption dieses synthetischen Autors, der an die Einbildungskraft seiner Leser appelliert und sie zur Mitarbeit ntigt, sind u. a. Petrarca (A. W. Schlegel 1803/04a, 157 f.) und Goethe (ders. 1809/11b, 416 f.). Vor allem eine Eigenschaft muss der ideale Autor aufweisen, um keine bestimmte Wirkung auf den Leser zu machen: Er darf seine Aussagen nicht auf eine einzige Interpretationsmglichkeit reduzieren lassen. Der Sinn eines Textes darf nicht ein einziger sein, den der Autor vorgibt, sondern muss in einer Pluralitt von Mglichkeiten bestehen. Natrlich wird dadurch derjenige Leser, der mit seiner Idealrolle als aktiver Rezipient nicht vertraut ist, verunsichert. Der allgemeine Vorwurf des Publikums gegenber den synthetischen Autoren des Athenaeum ist folgerichtig derjenige der Unverstndlichkeit. Die Tatsache, dass damit zwei unterschiedliche Sichtweisen der Aufgabe eines Autors vorliegen, muss fr ein angemessenes Verstndnis der frhromantischen Verstehenskonzeption bercksichtigt werden: Den Frhromantikern geht es nicht um eine ahermeneutische Apotheose echter Unverstndlichkeit, sondern um eine antihermeneutische der Vieldeutigkeit, idealiter der Alldeutig-keit, wenn sie in ironisch-perspektivischer Redeweise die Bezeichnung derselben als Unverstndlich-keit (F Schlegel 1800b, passim) bernehmen. In diesem Sinne unverstndlich (will sagen: nicht einheitlich und von allen Seiten gleichermaen deutbar) zu sein ist in ihren Augen keine Schwche, sondern eine Strke des Autors; wo es ihm gelingt, ruft er eine Vielfalt von Meinungen hervor und schafft neue Mglichkeiten des hermeneutischen Dialogs, auf den letztlich alles ankommt. Freilich ist der Anspruch des lebendigen Entgegenwirkens von seiten des Rezipienten so hoch, dass nicht einmal die Frhromantikerfreunde als Leser [...] die lesen knnen durchgehen (F. Schle-gel 1800b, 371). Friedrich Schlegel berlegt, wie seine Freunde zu echten Symphilosophen, und das heit eben zugleich zu idealen Lesern seiner Texte werden knnten: Tieck durch [Mythologie]. Wilh.[elm Schlegel] durch Hist[orische] [Philosophie] und [kritische Philosophie] und [Philologie] der [Philosophie]. Hardenb.[erg] fehlt es an [Philologie] und [Kritik]. Schlei[ermacher] an [Poesie] und [Kunst]. Zur [Symphilosophie], da fehlts allen. (F. Schlegel 1796/98, 87.) Entsprechend erprobt Schlegel seine antihermeneutischen Verwirrtaktiken auch an den Gesinnungsgenossen und rechnet es sich als Erfolg an, wenn es ihm gelungen ist, sie hinters Licht zu fhren: Es ist gewissermaen der grte Triumph fr mich, da sogar Du, dem das Geheimnis doch gesagt war, durch meine sokratische Verstellungskunst bist [...] angefhrt worden, schreibt er an Novalis (in: Behler 1987b, 363). Dieser hatte zuvor eine Schlegelsche Rezension mit den Worten kritisiert, sie habe
-
12
den gewhnlichen Fehler Deiner Schriften sie reizt, ohne zu befriedigen Sie bricht da ab, wo wir nun gerade aufs Beste gefat sind Andeutungen Versprechungen ohne Zahl [...]. Augen haben Deine Schriften genug helle, seelenvolle, keimende Stellen aber gieb uns auch endlich [...] wo nicht etwas Brauchbares, doch etwas Ganzes, wo man auch kein Glied mehr suppliren mu. (Brief an F. Schlegel, in: Samuel 1975, 226.)
Da die Aufgabe des idealen Lesers aber gerade in dem besteht, was Novalis hier ablehnt: im Supplieren, so ist einsichtig, dass Schlegel sich durch die Kritik nicht getroffen fhlt, sondern im Gegenteil meint, seine Pflicht als synthetischer Autor getan zu haben. Er ist mit seinem Text zufrieden, weil ich meine innerste Absicht vollkommen dabey erreicht [habe]. Das wollte ich eben: [...] Jedermann sollte es vollkommen verstehn, aber jeder anders. Ganz klar und doch unergrndlich tief. (Brief an Novalis, in: Behler 1987b, 362 f.) 3.3 Dass die Vieldeutigkeit seiner Texte beim Leser, wie er ist (F. Schlegel 1797a, 161) nicht auf Gegenliebe stt, ist fr den sich selbst als ideal empfindenden Autor lediglich ein Beweis fr die Richtigkeit der Vermutung, der Grund der Unverstndlichkeit liege im Unverstand (ders. 1800b, 363) in dem des Lesers. Er fasst den Entschluss, sich mit dem Leser in ein Gesprch ber diese Materie zu versetzen, und vor seinen eignen Augen, gleichsam ihm ins Gesicht, einen andern neuen Leser [...] zu construiren, ja [...] sogar zu deduciren (ebd.). Die Vision des idealen Lesers ist Teil des groangelegten frhromantischen Geschichtsprojektes einer ins Unendliche hin unabgeschlossenen Vervollkommnung des Menschen. Ziel der Frhromantik ist dabei eine Ausbildung des modernen Menschen nach dem Vorbild der (vor allem in sthetischer, jedoch auch in moralischer Hinsicht) fr exemplarisch gehaltenen klassischen Antike. Die dadurch in Aussicht genommene neue Qualitt der Moderne, als deren Wegbereiter sich die Frhromantiker verstehen, wird als so bedeutend empfunden, dass in diesem Zusammenhang die Rede von einer anbrechenden neue[n] Zeit ist (ebd., 370). Der Gedanke der unendlichen Vervollkommnung ist ganz und gar aufklrerisch; in der Tat ist ja die Frhromantik weithin eine Fortsetzung der Aufklrung mit anderen Mitteln (vgl. Br 1999a, 24 f.). Nicht von ungefhr wird der erwartete und angekndigte Anbruch der neuen Zeit in Anlehnung an aufklrerische Lichtmetaphorik mit dem Bild der Morgenrthe beschrieben (F. Schlegel 1800b, 370; ders. 1800c, 272). In seinem Aufsatz Ueber die Unverstndlichkeit stilisiert Friedrich Schlegel das bevorstehende 19. Jahrhundert zu einer Epoche des Verstandes. Wo aber dieser ist, kann das Verstehen nicht fehlen sogar er selbst wird verstanden werden (F. Schlegel 1800b, 371) , und so beschwrt Friedrich Schlegel eine Zeit, in der die ihm und seinen literarischen und philosophischen Freunden vorgeworfene Unverstndlichkeit nicht mehr als solche empfunden wird:
Dann nimmt das neunzehnte Jahrhundert in der That seinen Anfang, und dann wird auch jenes kleine Rthsel von der Unverstndlichkeit des Athenaeums gelst sein. [...] Dann wird es Leser geben die lesen knnen. Im neunzehnten Jahrhundert wird jeder die Fragmente mit vielem Behagen und Vergngen in den Verdauungsstunden genieen knnen, und auch zu den hrtesten unverdaulichsten keinen Nuknacker bedrfen. Im neunzehnten Jahrhundert wird jeder Mensch, jeder Leser die Lucinde unschuldig, die Genoveva protestantisch und die didaktischen Elegien von A. W. Schlegel fast gar zu leicht und durchsichtig finden. (Ebd., 370 f.)
Die Rede vom 19. Jahrhundert ist freilich nicht wrtlich, sondern symbolisch zu nehmen. Dass er nicht ernsthaft damit rechnet, im Jahr nach der Verffentlichung seines Aufsatzes ein Zeitalter des Ver-standes und des Verstehens anbrechen zu sehen, sagt Schlegel selbst. Der beschwrende Unterton lsst allerdings erkennen, dass er die Hoffnung nicht aufgeben will:
Ich [...] erklre [...], alles sey nur noch Tendenz, das Zeitalter sey das Zeitalter der Tendenzen. Ob ich nun der Meynung sey, alle diese Tendenzen wrden durch mich selbst in Richtigkeit und zum Beschlu gebracht werden, oder vielleicht durch meinen Bruder oder durch Tieck, oder durch sonst einen von unsrer Faction, oder erst durch einen Sohn von uns, durch einen Enkel, einen Urenkel, einen Enkel im siebenundzwanzigsten Gliede, oder erst am jngsten Tage, oder niemals; das bleibt der Weisheit des Lesers, fr welche diese Frage recht eigentlich gehrt, anheim gestellt. (Ebd., 367.)
-
13
4 Rhetoriktheorie 4.1 Die Romantik steht bis heute (wenngleich flschlich) im Ruf einer rhetorikverachtenden Epoche, die pauschal als rhetorikfern eingestuft wird (Schanze 1994, 336). Viele Belege scheinen tatschlich dafr zu sprechen. In Deutschland wird sie nicht gebraucht, behauptet A. W. Schlegel (1798/99, 148) von der Redekunst, und Adam Mller meint, dass die Deutschen die Kunst, mit der lebendigen Rede zu zwingen und zu verfhren [...] eigentlich nie besessen [...] und das Wort nie bei der Hand gehabt haben (Mller 1812, 297). Diese konstatierte Abstinenz, unabhngig davon, ob sie historisch den Tatsachen entspricht, scheint programmatisch. Stereotype Kollokationen wie Redekunst und Sophisterei (Tieck 1839, 209) legen den Gedanken nahe, dass das Verhltnis der Romantik zur Rhetorik nicht das beste ist. Der kantische Gedanke der zweckfreien schnen Kunst spielt in der Romantik eine zentrale Rol-le, und die Skepsis gegenber der Rhetorik ist daher weit verbreitet. Dabei wird nicht nur auf Kant, sondern auch auf den platonischen Gorgias (465be) zurckgegriffen: Angenehme Redekunst ist mit der schnen Poesie nicht nher verwandt als jede andre sinnliche Geschicklichkeit, welche Plato Kunst zu nennen verbietet und mit der Kochkunst in eine Klasse ordnet. [...] Die Kunst ist [...] entweder eine freie Ideenkunst oder eine mechanische Kunst des Bedrfnisses, deren Arten die ntzliche und die angenehme Kunst sind. (F. Schlegel 1795/97, 243.) Die Rhetorik ist zwar durch ihren Stoff oder ihr Werkzeug [Sprache] mit der Poesie verwandt, aber indem sie einem bestimmten Zwecke dient, lsst sie sich am meisten mit der Architektur vergleichen. (A. W. Schlegel 1798/99, 119.) Der Zweck der Redekunst ist seit der Antike das berreden, das Gewinnen des Zuhrers (Dockhorn 1944, 13). Dafr werden traditionell zwei Hauptmittel unterschieden, die als Grundkate-gorien die Disposition antiker Rhetoriken beherrschen: der Appell an den Verstand, das docere, das durch Beweise [...] erfolgt, und die Erregung der Gefhle, die Weckung der Affecte, das movere (ebd.). Eben diese Unterscheidung wird erkennbar, wenn Schelling den Zweck des Redners darin sieht, sich anschaulich zu machen, oder [...] zu tuschen und Leidenschaft zu erwecken (Schelling 1803/04, 639). Rhetorik ist die praktische Erkenntnis der Sprache (F. Schlegel 1805/06, 187), die mit der Lehre von der Anwendung verbundene Sprachlehre im Gegensatz zur Grammatik, die ihrerseits als theoretische Erkenntnis der Sprache definiert wird, als Wissenschaft der Sprache blo in der Absicht, die Sprache zu kennen und zu verstehen (ebd., 186). In der Rhetorik ist dabei nicht nur von der Richtigkeit, sondern auch von der Schnheit und Knstlichkeit des Ausdrucks die Rede (ebd., 187), denn oft ist es fr praktische Zwecke nicht hinreichend, sich blo verstndlich und richtig auszudrcken, sondern man mu der Rede durch die Schnheit und Kunst des Ausdrucks eine hhere Bedeutung und Wrde geben (ebd.). Damit wird die Rhetorik gewissermaen in die (frh)romantische Kunsttheorie integriert. Romantik ist eine Transformation der Rhetorik. Sie hebt Rhetorik auf, im Hegelschen Doppelsinn des Wortes (Schanze 1994, 339) eine Tatsache, die dadurch mglich ist, dass Rhetorik schlechterdings mit Kunstgriff (F. Schlegel 1795/97, 315) gleichgesetzt wird. F. Schlegel versteht Rhetorik zunchst ganz traditio-nell als die Kunstlehre der Prosa (Schanze 1974, 132). Da es im Sinne des kantischen Begriffs der Zweckmigkeit ohne Zweck eine Technik oder Kunstlehre auch im Bereich der schnen Kunst gibt und geben muss, hat auch die Poesie im eigentlichen Sinne, die nie einen Zweck auer sich hat (Schelling 1803/04, 639), stets eine rhetorische Komponente: Alle Poesie, die auf einen Effekt geht, [...] ist rhetorisch (F. Schlegel 1798, 209). Es gibt demnach eine Rhetorik im hhern Sinn (ebd. 208), eine materiale, enthusiastische Rhetorik die unendlich weit erhaben ist ber den sophistischen Mibrauch der Philosophie, die deklamatorische Stylbung, die angewandte Poesie, die improvisierte Politik, welche man mit demselben Namen zu bezeichnen pflegt (ebd. 187). Mit eben dieser Rhetorik im hheren Sinne will F. Schlegel die Poesie im Rahmen seines Programms einer progressive[n] Universalpoesie in Berhrung [...] setzen (ebd. 182). 4.2 Was die zweckfreie Poesie von der angewandten, zweckorientierten Redekunst uerlich unter-scheidet, ist die Mglichkeit des gehobenen Tons, einer von der Alltagssprache deutlich unterschiede-nen poetischen Diktion. Insbesondere A. W. Schlegel fordert eine solcherart eigenstndige Dichter-sprache. Dabei hlt er es zwar fr selbstverstndlich, dass die Poesie ihren eignen Zweck vernichten
-
14
[wrde], wenn sie so weit von aller Analogie des Sprachgebrauchs abwiche, da sie vllig un-verstndlich werden mte (A. W. Schlegel 1801/02, 406). Die poetischen Lizenzen gehen aber sehr weit: Lediglich absolute Dunkelheit und Verworrenheit welche durch kein Nachdenken sich ins klare setzen lt ist fehlerhaft, und selbst sie ist es nicht, wenn sie partienweise in einem Gedicht angebracht ist, um dem Eindrucke des Ganzen zu dienen (ebd.). Jede darber hinausgehende Unverstndlichkeitskritik wird mit elitrer, dem horazischen odi profanum volgus et arceo (Horaz, Oden III/1, 1) verwandter Geste zurckgewiesen: Der Dichter braucht nicht fr alle zu schreiben (A. W. Schlegel 1801/02, 406). Auch der Rhetor muss sich nicht an alle wenden, aber da er einen ueren Zweck verfolgt, kann es ihm im Unterschied zum Dichter nicht gleichgltig sein, ob er sein tatschlich angesprochenes Publikum erreicht. Dies hebt besonders A. F. Bernhardi hervor: Die Rede will berreden (Bernhardi 1803, 227), daher mu ihre Sprachdarstellung [...] die Sprache des gemeinen Lebens in sich aufneh-men und darf sich, obgleich sie dieselbe zu erhhen und veredeln streben soll, nicht so weit von derselben [...] entfernen, da sie unverstndlich, da dem Zuhrer die Folge der Ideen schwierig aufzu-fassen wrde (ebd., 229). Die einigermaen paradoxe Konsequenz des hier entworfenen Poesie- und Rhetorikverstndnisses ist, dass die Sprache des Dichters weitaus knstlicher u. a. mittels der klassischen Redefiguren (vgl. Br 1999a, 121 ff.) durchgebildet sein darf und soll als die des Redners. In dieser Auffassung unterscheiden sich die deutschen Frhromantiker deutlich von den englischen, v. a. von William Wordsworth. Dieser fordert etwa zeitgleich eine mglichst volkstmliche Dichtung mit einer der Alltagssprache mglichst nahe verwandten Dichtersprache: The Poet thinks and feels in the spirit of human passions. How, then, can his language differ [...] from that of all other men who feel vividly and see clearly? (Wordsworth 1802, 398.) Wordsworths Postulat einer language really used by men (ebd., 386) steht in einer direkten Tradition der antiken Rhetorik (Dockhorn 1944, 42). Er will human passions und human characters darstellen (Wordsworth 1798, 383) und knpft damit, wie Klaus Dockhorn zeigt, an die auf Aristoteles zurckgehende und von Quintilian adaptierte Unterscheidung von Pathos und Ethos an: Die stark erregte Leidenschaft und das sanfte, humane Gefhl, perturbatio und benevolentia, das sind bei Quintilian und , zusammengefat unter dem Oberbegriff der affectus, zum leidenschaftlichen Erregen und sanften Rhren bestimmt. (Dockhorn 1944, 16.) Die dem Redner und bei Wordsworth eben auch dem Dichter aufgegebene Verstndlichkeit ist freilich nicht allein Angelegenheit einer natrlichen Sprache, sondern wird gleichgesetzt mit einer mglichst unmittelbaren Ansprache des Hrers. Adam Mller (1812, 308) identifiziert die wahre Rede daher mit einem Gesprch des Redners mit seinem Zuhrer und stellt als wichtigste rhetorische Regel auf: Wisse zu hren, wenn du reden willst; versetze dich in das Herz, dahinein du greifen willst [...]. Verstehe, Redner, mich, deinen Gegner, wenn du dich mir verstndlich machen willst: bist du verstndlich, dann will ich glauben, dann werde ich es im innersten Herzen empfinden, da du verstehst. Kurz, es gibt kein Mittel, den Verstand zu beweisen, als die Verstndlichkeit [...]. (Ebd., 307.) Das Vorhandensein dieser Verstndlichkeit wird in der Reaktion des Auditoriums erkennbar: Die herrlichen begeisterten Reden eines vortrefflichen Redner[s] dringen seinen Zuhrern ins Innerste, wo sie die inbrnstigste Andacht erzeugen; der Feuerstrom seiner Worte reit alle un-widerstehlich fort (E. T. A. Hoffmann 1815/16, 37). Die unmittelbare Wirkung einer guten Predigt sind [h]eftiges Weinen und unwillkrlich den Lippen entfliehende Ausrufe der andachtvollsten Wonne (ebd., 38). Demgegenber wird auch die Wirkung des schlechten Redners direkt an der Reaktion des Publi-kums sichtbar:
[S]eine Reden schlichen wie ein halbversiegter Bach mhsam und tonlos dahin, und die ungewhnlich gedehnte Sprache, welche der Mangel an Ideen und Worten erzeugte, da er ohne Konzept sprach, machten seine Reden so unausstehlich lang, da vor dem Amen schon der grte Teil der Gemeinde, wie bei dem bedeutungslosen eintnigen Geklapper einer Mhle, sanft eingeschlummert war, und nur durch den Klang der Orgel wieder erweckt werden konnte. (Ebd., 37.)
-
15
4.3 Die Frage, wie die Kommunikation mit der Zuhrerschaft gelingen knne, wird in unterschied-licher Weise beantwortet. Allen Positionen gemeinsam ist die in Kants Rhetorikkritik prformierte Forderung nach unbedingter Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit des Redners. Diese Forderung kann jedoch zum einen praktisch-ethisch, zum anderen sthetisch motiviert sein. Im ersten Fall liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf dem Verhltnis von Redner und Auditorium, im zweiten auf der Person des Redners selbst. 4.3.1 Eine praktisch-ethische Rhetorik-Auffassung vertritt z. B. Adam Mller. Er nennt vor dem Hintergrund seiner dialogischen Rhetoriktheorie als Bedingung der gelingenden Ansprache die Bereitschaft des Publikums, sich ansprechen zu lassen, was v. a. Vertrauen in die Integritt des Red-ners voraussetzt:
Wer nicht ber gewisse Dinge mit mir einig ist, mit dem kann ich ber die anderweiten nicht streiten. Glaubt ihr an mich, so bin ich ein Redner; zweifelt ihr an mir, so bin ich stumm: [...] weil mir wirklich das Vermgen, das Talent der Rede im Munde verlscht. Glaubt ihr an mich, kann wohl nichts anderes heien als glaubt ihr, da ich etwas Hheres will als mich: nmlich die Wahrheit oder die Gerechtigkeit. (Mller 1812, 312 f.)
An der Wahrheit muss dem Redner aufrichtig liegen, insofern er kein bloer Sophist sein will (Bernhardi 1803, 174). Allenfalls in der vornehmen Gelehrtenpoesie ist es mglich, dass ein Mangel an sittliche[r] Haltung und Wrde sich mit verschnrkelter Rhetorik verhllen oder gar verschnern lt (Eichendorff 1857, 723). Ein lediglich durch rhetorische Knste erschlichnes Ansehn ist dagegen nur von kurzer Dauer (F. Schlegel: 1795/97, 273). Das heit nicht, dass die Techniken der Pathopie prinzipiell verpnt wren. Affecte sind aber Arzeneyen, d. h., man darf mit ihnen nicht spielen (Novalis 1799, 560). Wo dies doch geschieht, ist der letzte Zweck des Redners, die Gewinnung der Herzen seines Publikums, nicht zu erreichen:
Das Anregen der Leidenschaften und Rhrungen ist ein armseliges Substitut dessen, was ich hier meine [...]. Entweder ihr ergreift den Gegner bei seiner gewaffnetsten Seite [...], indem ihr vorwegnehmt seine Grnde, sie verstrkt, sie durch den Zusammenhang eurer Anklage belebt, indem ihr alle die Wunden zeigt, die er erst schlagen will; und ihr erhebt euren Gegner an seiner schwchsten Seite, [...] die empfnglich ist fr das Gttliche und an welcher strker zu sein als er, euch zum Redner macht und ihn zum Hrer oder ihr ergreift ihn gar nicht, ihr spielt nur an der Oberflche seines Herzens umher, ihr bestimmt das Tun seiner Hnde, aber nicht seinen Willen, ihr habt Maschinen in Bewegung gesetzt, aber nicht Herzen. (Mller 1812, 319.)
Verwerflich ist die Rhetorik als manipulative Technik allerdings nicht nur, wenn sie auf positiver, zweckorientierter Unaufrichtigkeit beruht, sondern auch dann, wenn sie mit negativer Unauf-richtigkeit, d. h. Gesinnungslosigkeit, Austauschbarkeit der berzeugungen, zumindest einem Mangel an Consistency (Heine 1831, 140) einhergeht:
Burke besa nur rhetorische Talente, womit er in der zweyten Hlfte seines Lebens die liberalen Grundstze bekmpfte, denen er in der ersten Hlfte gehuldigt hatte. Ob er durch diesen Gesinnungswechsel die Gunst der Groen erkriechen wollte, ob Sheridans liberale Triumphe in St. Stephan, aus Depit und Eifersucht, ihn bestimmten, als dessen Gegner jene mittelalterliche Vergangenheit zu verfechten, die ein ergiebigeres Feld fr romantische Schilderungen und rednerische Figuren darbot, ob er ein Schurke oder ein Narr war, das wei ich nicht. Aber ich glaube, da es immer verdchtig ist, wenn man zugunsten der regierenden Gewalt seine Ansichten wechselt (ebd. 140 f.).
Diese Kritik greift auch dort, wo den Worten, die Taten versprechen, eben diese Taten nicht folgen:
Seit mehreren Jahren warte ich vergebens auf das Wort jener khnen Redner, die einst in den Versamm-lungen der deutschen Burschenschaft so oft ums Wort baten und mich so oft durch ihre rhetorischen Talente berwunden und eine so vielversprechende Sprache gesprochen; sie waren sonst so vorlaut und sind jetzt so nachstill. (Heine 1830, 270.)
Solche Vorbehalte gelten allerdings nicht lediglich der Rhetorik im besonderen, sondern gehren in den allgemeineren Kontext der romantischen Sprachskepsis (s. o.), fr die ein volles, kostbares, glhendes Schweigen [...] mehr sagt als alle Beredsamkeit, als jeder rhetorische Wortschwall (Heine 1839, 37).
-
16
Die geforderte Wahrhaftigkeit des Redners setzt voraus, dass er die Empfindungen, die er bei sei-nen Zuhrern wachruft, tatschlich empfindet. Jede Art von Autosuggestion, also knstlichem Sich-Versetzen in die auch beim Publikum beabsichtigte Stimmung, wird dadurch von vorneherein ausge-schlossen. Das gilt auch fr die zweite in der Romantik vertretene Ansicht, wie der Zuhrer zu errei-chen sei: fr die dem Genie-Konzept des 18. Jahrhunderts verpflichtete sthetische Rhetorik-Auffas-sung. 4.3.2 Das Wirken des rhetorischen Genius ist ein unverfgbares Ereignis, das nur eintreten kann, wenn es der Redner vermag, sich ganz dem Feuer der Beredsamkeit zu berlassen (Hoffmann 1815/16, 43). Dabei wird freilich der Verstand, das klare Bewusstsein, die Besonnenheit (Jean Paul 1813, 46 ff.) keineswegs ausgeblendet; [n]ur der unverstndigte Jngling kann glauben, geniales Feuer brenne als leidenschaftliches (ebd. 48), d. h. unreflektiert, ohne Ma und Ziel. Vielmehr wird die Begeisterung des Genies, sein Enthusiasmus (ebd.) als geniale Ruhe verstanden. Sie gleicht der sogenannten Unruhe, welche in der Uhr blos fr das Migen und dadurch fr das Unterhalten der Bewegung arbeitet (ebd.). Dass das Wirken des Genies kein unbewusstes Ereignis ist, zeigt sich auch daran, dass sich der Redner beim Reden gleichsam selbst beobachten kann:
Bald [...] war es, als strahle der glhende Funke himmlischer Begeisterung durch mein Inneres ich dachte nicht mehr an die Handschrift, sondern berlie mich ganz den Eingebungen des Moments. Ich fhlte, wie das Blut in allen Pulsen glhte und sprhte ich hrte meine Stimme durch das Gewlbe donnern ich sah mein erhobenes Haupt, meine ausgebreiteten Arme, wie von Strahlenglanz der Begeisterung umflossen. (Hoffmann 1815/16, 33.)
Selbst scheinbare Kunstfehler wie das Klammern am Manuskript gereichen dem mit rednerischem Genie gesegneten Rhetor unbeabsichtigt zur positiven Wirkung:
Im Anfange blieb ich meiner Handschrift getreu, und Leonardus sagte mir nachher, da ich mit zitternder Stimme gesprochen, welches aber gerade den andchtigen wehmutsvollen Betrachtungen, womit die Rede begann, zugesagt, und bei den mehrsten fr eine besondere wirkungsvolle Kunst des Redners gegolten habe. (Ebd., 38.)
Dabei drfen aber solche Kunstfehler (ebenso wie die Kunstgriffe) nicht absichtsvoll erfolgen. Der Redner darf sich seines Handelns bewusst sein, aber er darf es nicht kontrollieren:
[H]ier braucht man die Beispiele ruchloser Geistes Gegenwart nicht aus dem Denken, Dichten und Thun der ausgeleerten Selbstlinge jetziger Zeit zu holen, sondern die alte gelehrte Welt reicht uns besonders aus der rhetorischen und humanistischen in ihren frechen kalten Anleitungen, wie die schnsten Empfindungen darzustellen sind, besonnene Gliedermnner wie aus Grbern zu Exempeln. Mit vergngter ruhmliebender Klte whlt und bewegt z. B. der alte Schulmann seine nthigen Muskeln und Thrnendrsen (nach Peucer oder Morhof), um mit einem leidenden Gesicht voll Zhren in einer Threnodie auf das Grab eines Vorfahrers ffentlich herabzusehen aus dem Schul-Fenster, und zhlt mit dem Regenmesser vergngt jeden Tropfen. (Jean Paul 1813, 49.)
Bereits in dem Augenblick, in dem die Selbstbeobachtung in Selbstgeflligkeit und Selbstgewissheit umschlgt und die rednerische Begeisterung planmig ins Kalkl gezogen wird, erfolgt der Umschlag zur absichtsvoll-knstlichen Rhetorik. Der Redner geht seines Genies verlustig und fllt stattdessen dem Geist des Truges (Hoffmann 1815/16, 50) anheim. Dadurch verliert er zwar nicht unmittelbar seine Wirkung auf das groe Publikum, aber vor dem scharfen Blick des Kundigen kann er nicht lnger bestehen. Eben dies widerfhrt dem Mnch Medardus in Hoffmanns Erzhlung Die Elixiere des Teufels. Voll Vertrauen auf sein rednerisches Talent bereitet er sich auf eine Predigt vor, [o]hne das mindeste aufzuschreiben, nur in Gedanken die Rede, in ihren Teilen ordnend (ebd., 49). Er verlsst sich ganz auf die hohe Begeisterung, die das feierliche Hochamt, das versammelte andchtige Volk, ja selbst die herrliche hochgewlbte Kirche in mir erwecken wrde (ebd.). Das Laienpublikum ist zwar beeindruckt in allen auf mich gerichteten Blicken, las ich Staunen und Bewunderung (ebd.) , aber die btissin des Klosters, in dem die Predigt stattfindet, tadelt ihn scharf:
-
17
Der stolze Prunk Deiner Rede, Deine sichtliche Anstrengung, nur recht viel auffallendes, glnzendes zu sa-gen, hat mir bewiesen, da Du, statt die Gemeinde zu belehren und zu frommen Betrachtungen zu entznden, nur nach dem Beifall, nach der wertlosen Bewunderung der weltlich gesinnten Menge trachtest. Du hast Gefhle geheuchelt, die nicht in Deinem Innern waren, ja Du hast selbst gewisse sichtlich studierte Mienen und Bewegungen erknstelt, wie ein eitler Schauspieler, Alles nur des schnden Beifalls wegen. (Ebd., 50.)
Medardus allerdings will diesen Tadel nicht akzeptieren; er geht auf dem einmal eingeschlagenen Weg weiter und fhrt fort, seine Predigten mit allen Knsten der Rhetorik auszuschmcken (ebd.) und sein Mienenspiel und seine Gestikulationen sorgfltig zu studieren (ebd., 51). 4.4 Die Ablehnung absichtsvoll eingesetzter rhetorischer Kunstgriffe ist in der Romantik allgemein verbreitet, und meist wird die Kritik an ihnen mit romantischer Ironie vorgebracht. Dies kann z. B. durch die bertreibende Affirmation rhetorischer Topoi erfolgen ein Redner darf dem Zuhrer nochmals sagen, was dieser schon erfahren bis zum berdru (Hoffmann 1820/22, 352) , ebenso durch ihre scheinbare Verteidigung, die sie in Wahrheit lcherlich macht:
Es ist gebruchlich, da der Trauerredner den Anwesenden die ganze vollstndige Biographie mit lobprei-senden Zustzen und Anmerkungen vortrgt, und dieser Gebrauch ist sehr gut, da durch einen solchen Vor-trag auch in dem betrbtesten Zuhrer der Ekel der Langeweile erregt werden mu, dieser Ekel aber nach der Erfahrung und dem Ausspruch bewhrter Psychologen am besten jede Betrbnis zerstrt, weshalb denn auf jene Weise der Trauerredner beide Pflichten, die, dem Verewigten die gehrige Ehre zu erweisen, und die, die Hinterlassenen zu trsten, auf einmal erfllt. Man hat Beispiele, und sie sind natrlich, da der Gebeugteste nach solcher Rede ganz vergngt und munter von hinnen gegangen ist; ber der Freude, erlst zu sein von der Qual des Vortrags, verschmerzte er den Verlust des Hingeschiedenen. (Ebd., 351.)
Eine weitere Mglichkeit der Ironisierung besteht im Ausdruck rhetorischen Selbstbewusstseins, in der ffentlich vorgetragenen Reflexion des Redners ber seine Rolle, die ihn aus eben dieser fallen lsst:
[I]ch will statt alles weitern langweiligen Sermons nur mit wenigen schlichten Worten sagen, was fr ein schmhliches Ende der arme Teufel der hier starr und tut vor uns liegt, nehmen mute und was es fr ein wackrer, tchtiger Kerl im Leben war! Doch o Himmel! ich falle aus dem Ton der Beredsamkeit, unerachtet ich derselben beflissen und, will es das Schicksal, Professor poeseos et eloquentiae zu werden hoffe! (Ebd. 352.)
Die ironische Brechung wird dadurch verstrkt, dass der Redner nach kurzer Sammlung mit erhh-tem Tone weiterspricht (ebd.), des weiteren dadurch, dass die Zuhrer als naiv genug geschildert werden, die vom Redner beabsichtigte Wirkung uneingeschrnkt zu zeigen8 und das offensichtliche rhetorische Manver nicht zu durchschauen9 oder erst allmhlich zu durchschauen10. Allerdings kann die Knstlichkeit auch unverblmt thematisiert werden: [E]ndlich brach sein Jammer, nach der Vorschrift seines rhetorischen Lehrers bearbeitet, in folgenden Worten aus: [...] (Arnim 1812, 689); Der Erzherzog verlangte [...] von dem Herren von Cornelius Nepos, da er seine Klage vortrage. Dieser hatte nicht umsonst Stunden in der Rhetorik genommen, das wollte er allen zeigen und bewhren; sehr pathetisch ergriff er die [...] Mitgefhle der Versammelten [...]. (Ebd. 725.) Nicht einmal durch das Prisma rhetorischen Handwerks lsst derjenige seine angeblichen Empfin-dungen erblicken, der bei ihrem Ausdruck dramatische Figuren nachahmt: Er verschwur [...] nach-einander in zehn Karaktern aus den neuesten Dramen und Tragdien seine Seele, wenn er jemals
8 Ich, wir alle konnten uns bei diesen letzten Worten Hinzmanns nicht lassen vor grimmen [sic] Schmerz,
sondern brachen all in solch ein klgliches Geheul und Jammergeschrei aus, da ein Felsen htte erweicht werden knnen (Hoffmann 1820/22, 353).
9 Der Teufel hat aus dem kleinen Kerl gesprochen, sagte Chievres leise, mich rhrt doch sonst so leicht nichts, aber er macht einem seine Not so plausibel (Arnim 1812, 725).
10 Mir kam es [...] vor, da Hinzmann gesprochen, mehr, um ein glnzendes Rednertalent zu zeigen, als den ar-men Muzius noch zu ehren nach seinem betrbten Hinscheiden. [...] berdem war auch das Lob, das Hinz-mann gespendet, von zweideutiger Art, so da mir eigentlich die Rede hinterher mifiel, und ich whrend des Vortrags blo durch die Anmut des Redners und durch seine in der Tat ausdrucksvolle Deklamation bestochen worden. (Hoffmann 1820/22 356 f.)
-
18
treulos; zulezt redete er gar noch in der Manier des Don Juan, dem er diesen Abend beigewohnt hatte, und schlo mit den bedeutenden Worten: dieser Stein soll als furchtbarer Gast erscheinen bei unserm nchtlichen Mahle, meine ichs nicht redlich. (Klingemann 1805, 30.) 4.5 Damit ist ein Komplex angesprochen, der fr eine besondere Ausformung der romantischen Rhe-torik-Reflexion steht: die Dramentheorie. Den Zusammenhang zwischen Redekunst und Tragdie stellt bereits Quintilian her, und ausdrcklich auf ihn beruft sich A. W. Schlegel: Er berichtet, dass Euripides seine Poesie den Athenern durch die Aehnlichkeit mit ihrem tglichen Lieblingsgeschft, dem Processe-Fhren, Entscheiden, oder wenigstens Anhren, unterhaltend zu machen [suchte]. Deswe-gen empfiehlt ihn Quintilian vorzglich dem jungen Redner, der aus seinem Studium mehr als aus den ltern Tragikern lernen knne [...]. (A. W. Schlegel 1809/11a, 143.) Die kritische Wendung bleibt nicht aus:
[M]an sieht, da eine solche Empfehlung nicht sonderlich empfiehlt: denn Beredsamkeit kann zwar ihre Stelle im Drama finden, wenn sie der Faung und dem Zweck der redenden Personen gem ist; tritt aber Rhetorik an die Stelle des unmittelbaren Ausdrucks der Gemthsbewegungen, so ist die nicht eben poe-tisch. (Ebd., 143 f.)
Fr die dramatische Rede gilt ebenso wie fr die real vorgetragene: Der wahre begeisterte Redner wird sich ber seinem Gegenstande vergeen. Rhetorik nennen wir es, wenn er, mehr als an die Sache, an sich und seine selbstgefllige Kunst denkt. (A. W. Schlegel 1809/11b, 53.) Insbesondere in der franzsi-schen Tragdie des 17. Jahrhunderts, namentlich bei Corneille, herrscht Schlegel zufolge Rhetorik, und zwar Rhetorik in Hoftracht, statt der Eingebungen edler, aber einfacher unverknstelter Natur (ebd.). Dies luft dem Charakter des Trauerspiels und auch seinen Aufgaben zuwider, denn [w]enn der tragische Held sein Unglck schon in Antithesen und sinnreichen Gedankenspielen zurechtgelegt hat, so knnen wir unser Mitleiden sparen (ebd.). Vom Schauspiel wird nicht anders als vom rednerischen Auftritt Naturwahrheit gefordert; sobald diese sich vorgefaten Theorien beugen und anbequemen muss, besteht die Gefahr, dass die dramatischen Figuren zu abstracten, ganz unsinnlichen Begriffsgestalten werden und anstatt des unmittelbaren Naturlauts eine prchtige Rhetorik hervorbringen (Eichendorff 1857, 261). Zudem liegt die gttliche Kraft des Dramas die uns so wie kein anderes Kunstwerk unwiderstehlich er-greift, in der Unmittelbarkeit der Darstellung, darin, da wir, mit einem Zauberschlage der All-tglichkeit entrckt, die wunderbaren Ereignisse eines fantastischen Lebens vor unseren Augen ge-schehen sehen (Hoffmann 1819, 463). Daher ist es recht dem innigsten Wesen des Dramas entgegen, [...] wenn uns die Tat, die wir mit eignen Augen zu schauen gedachten, nur erzhlt wird (ebd.). Diese Charakterisierung gilt fr die mehresten unserer neuern groen Haupt- und Staats-aktionen (ebd., 463 f.); an Tat und Handlung bettelarm (ebd., 464) berschtten sie den Zuschauer mit schnen Worten und Redensarten [...], die kein lebendiges Bild in unsrer Seele zurcklassen (ebd., 463). Manches dieser Trauerspiele enthlt eigentlich nichts weiter, als die wohlgeordnete in schnen Worten und absonderlichen Redensarten verfate Relation eines fatalen Kriminalverbrechens die mehreren Personen verschiedenen Alters und Standes in den Mund gelegt ist, worauf dann die Vollziehung des gesprochenen Urteils an dem schuldigen Missetter erfolgt (ebd., 465). Sie sind daher nur rhetorische Kunstbungen zu nennen, in denen einer nach dem andern auftritt und, sei er Knig, Held, Diener etc. etc., in zierlicher geschmckter Rede sich ausbreitet (ebd., 464). Der Vorwurf der rhetorischen Idealitt (Eichendorff 1857, 268) trifft nicht nur das imitatorum pecus (Hoffmann 1819, 464), sondern auch, seiner Herrlichkeit und Gre unerachtet (ebd.), das Vorbild Schiller: Eine gewisse Prgnanz, mittelst der Verse Verse gebren, ist ihm ganz eigentmlich. (Ebd.) Von dem wahrhaft Dramatischen ab zu dem Rhetorischen hin sich gewendet (ebd., 465) und den tuono academico des Theaters (ebd., 475) angestimmt haben aber nicht nur die Dramendichter, sondern auch die Schauspieler, die ihrer Seits [...] dem rhetorischen Teil ihrer Kunst zu viel Wert geben (ebd., 465). Zwar ist richtige Deklamation, also das Beherrschen der Regeln, die Basis worauf alles beruht (ebd.), aber sie allein gengt im Sinne der auch fr den Schauspieler geltenden Genielehre keineswegs: Der echte Schauspieler muss geboren werden: Erlernen lt sich da nichts, es ist immer nur von der Ausbildung der innern natrlichen Kraft die Rede (ebd., 473). Man
-
19
kann daher eine Rolle sehr richtig deklamieren und doch Alles auf das erbrmlichste verhunzen (ebd., 465). Alles kommt hier auf Natrlichkeit und Echtheit der Empfindung an:
Ein mittelmiges Talent, das nur von der Handlung ergriffen ist und sich wirklich rhrt und bewegt wie ein lebendiger ttiger Mensch, kann hier den im Grunde bessern Schauspieler bertreffen, der in dem bestndigen Mhen durch die Rede zu ergreifen alles brige um sich her vergit. (Ebd., 466.)
Wer sich als Schauspieler in die Rolle, die er zu spielen hat, nicht finden, wer sie nicht lebendig ausfllen kann, luft Gefahr, sich lcherlich zu machen, denn
statt den Heros vor Augen zu sehen erblickt der Zuschauer nur einen, der von dem Heros hbsch erzhlt und sich dabei mht zu tun, als sei er der Heros selbst, aber das glaubt ihm der Zuschauer nun und nimmermehr. Verlangt nun gar die Rolle irgend einen Ausbruch der physischen Kraft die dem Schauspieler mangelt und behilft der sich mit irgend einem, in der Regel schlecht gewhlten Surrogat, so luft er Gefahr lcherlich zu werden und das Ganze auf heillose Weise zu verstren. (Ebd.)
Dabei wird viel an vorfallender Theaterrhetorik, die der Dichter und ihm folgend (ebd., 465) der Schauspieler produziert, dem Publikum und seinen Erwartungen angelastet:
[A]uf dem Theater wirkt mehr das Rhetorische als das Poetische, und die Vorwrfe, die bey dem Fiasko eines Stckes dem Dichter gemacht werden, trfen mit grerem Rechte die Masse des Publikums, welches fr naive Naturlaute, tiefsinnige Gestaltungen, und psychologische Feinheiten minder empfnglich ist, als fr pompse Phrase, plumpes Gewieher der Leidenschaft und Coulissenreierey. (Heine 1837, 258.)
Wie und warum einer dieser rhetorischen Dichter (Hoffmann 1819, 475) die Gunst des Publikums gewinnt, beschreibt Hoffmann in der Prinzessin Brambilla:
Der Abbate Chiari [...] hatte von Jugend auf mit nicht geringer Mhe Geist und Finger dazu abgerichtet, Trauerspiele zu verfertigen, die, was die Erfindung, enorm, was die Ausfhrung betrifft, aber hchst angenehm und lieblich waren. Er vermied sorglich irgendeine entsetzliche Begebenheit anders, als unter mild vermittelnden Umstnden vor den Augen der Zuschauer sich wirklich zutragen zu lassen, und alle Schauer irgendeiner grlichen Tat wickelte er in den zhen Kleister so vieler schnen Worte und Redensarten ein, da die Zuhrer ohne Schauer die se Pappe zu sich nahmen und den bittern Kern nicht heraus schmeckten. Selbst die Flammen der Hlle wute er ntzlich anzuwenden zum freundlichen Transparent, indem er den lgetrnkten Ofenschirm seiner Rhetorik davorstellte [...]. So was gefllt Vielen, und kein Wunder daher, da der Abbate Antonio Chiari ein beliebter Dichter zu nennen war. [...] Reden voll hochtnender Worte, die weder der Zuhrer, noch der Schauspieler versteht, und die der Dichter selbst nicht verstanden hat, werden am mehrsten beklatscht. (Hoffmann 1821, 832 f.)
Selbst bei anderen Gattungen als dem Drama greift diese Kritik: berall dort nmlich, wo von der literarischen Darstellung nicht Schilderung von Bildern oder Zustnden, sondern von Handlungen erwartet wird; den Errterungen in Lessings Laokoon (1766) zufolge also auch im Epos. Der Vorwurf einer auffallende[n] Armuth an Handlung und lebendiger Anschauung (Eichendorff 1857, 105) trifft beispielsweise Klopstocks Messias (174873): Gott und Menschen und Engel und Teufel machen eben nichts, als lange rhetorische Debatten ber das, was und warum sie es thun wollen. (Eichendorff 1857, 105.) Bei Klopstock sei nichts objectiv, sondern alles ideal: ein abstracter Himmel und die bloe Rhetorik gestaltloser Engel und Dmonen, aus protestantischer Unkenntnis oder Abneigung aller altkirchlichen Tradition entkleidet, womit uns z. B. Dante so gewaltig durch Himmel und Hlle fhrt. Daher bei Dante und im Parcival lauter Handlung und in der Messiade lauter Empfindung und endlose Reden ber diese Empfindung, mithin das Elegische vorwaltend. (Ebd., 213.) 5 Philologie 5.1 Die Beschftigung mit deutscher und europischer Literaturgeschichte, die den zuletzt zitierten rhetorikkritischen Wendungen zugrunde liegt, fhrt zum letzten im gegenwrtigen Zusammenhang zu behandelnden Punkt: der romantischen Philologie. Damit ist allerdings nicht allein historische Litera-turwissenschaft, sondern auch und in nicht geringerem Mae historische Sprachwissenschaft gemeint; auf letztere wird hier das Hauptaugenmerk zu richten sein.
-
20
Der Ausgangspunkt der romantischen Beschftigung mit der eigenen Sprach- und Literaturge-schichte ist in den wenigsten Fllen eine unvoreingenommene Begeisterung, weit mehr ein sthetisch-kritisches (Vor)urteil. In der gegen Ende des 18. Jahrhunderts neu aufgekommenen Querelle des Anciens et des Modernes vertraten die Frhromantiker, insbesondere Friedrich Schlegel, ursprng-lich entschieden die Partei der Anciens. Der erste Frhromantiker, der sich mit der Geschichte der deutschen Sprache und Literatur befass-te, ist Wilhelm Heinrich Wackenroder. Angeregt durch seinen Lehrer Erduin Julius Koch entdeckte er, da dieses Studium, mit einigem Geist betrieben, sehr viel anziehendes hat (Brief an L. Tieck, in: Vietta/Littlejohns 1991, Bd. 2, 97), und begeisterte sich fr die altdeutsche11 Poesie bereits zu einer Zeit, da Autoren wie Tieck und F. Schlegel noch vorrangig die klassisch-antike Literatur, allenfalls Shakespeare zu schtzen wussten. Eine allgemeinere Aufwertung erfuhr die ltere deutsche Literatur bei den Frhromantikern erst, als sie neben der antiken auch die moderne oder (wie sie sie etwas spter bevorzugt nannten) romantische Poesie fr sich entdeckten12 und, um die Originalquellen lesen zu knnen, sich mit deren Sprache vertraut zu machen strebten. Philologische Quellenstudien trieben v. a. A. W. Schlegel, F. Schlegel und Tieck. Letzterer gab 1803 nach mehrjhrigen Vorarbeiten die Minnelieder aus dem Schwbischen Zeitalter heraus, jene Bearbeitung der Bodmerschen Samm-lung von Minnesingern aus dem schwbischen Zeitpuncte (1758/59), von der der entscheidende Impuls zur Rezeption des Minnesangs (Rother 1988, 400) ausgeht. Zwar stie Tiecks Ausgabe keineswegs auf die von ihm erhoffte groe Publikumsresonanz (vgl. Brinker-Gabler 1980, 145), aber ihre Wirkung in Romantikerkreisen war beachtlich. Beispiele sind Clemens Brentano und Stefan August Winkelmann, die sich als bersetzer mit mittelhochdeutscher Minnelyrik befassten (vgl. Rother 1988, 402), und Jacob Grimm, der 1811 eine Abhandlung Ueber den altdeutschen Meister-gesang publizierte. Tieck selbst widmete sich neben dem Minnesang unter anderem der Edda und dem Nibelungenlied, das er zusammen mit F. Schlegel in einer kritischen Edition herauszubringen erwog. Dieses Projekt blieb freilich unausgefhrt; die Frhromantiker sind, wie auf vielen anderen Gebieten, so auch im Bereich der deutschen Philologie mehr als Anreger denn als tatschliche Pioniere hervorgetreten. 5.2 Ihre Konzeption dieser Wissenschaft hngt eng mit der frhromantischen Mittelalterauffassung zusammen, wie sie Novalis in seinem Vortrag Die Chr