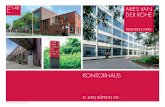gewollt, daß“ - Bauwelt · Bendzko gekauft worden war und die 530 Wohnungen in Ei-gentum...
Transcript of gewollt, daß“ - Bauwelt · Bendzko gekauft worden war und die 530 Wohnungen in Ei-gentum...

Bauwelt 19 | 2007 17
Herbst 1958: die ersten Mie-ter im Corbusierhaus. Bauherr war die „Heilsberger Drei -eck“ Grundstücks-AG, Frithjof W. Müller-Reppen, Berlin; (Bauleitung: André Rogensky, Paris; Kontaktarchitekt: Felix Hinssen, Berlin).
1 „Spiegel“ vom 18. Septem-ber 1957
Wenn in dieser Woche das Berliner Hansaviertel sich der vor 50 Jahren eröffneten Interbau erinnert, soll ein Gebäude nicht vergessen werden, das zwar sieben Kilometer weiter westlich steht, aber Teil der Bauausstellung ist und in seiner radikalen Konzeption alles im doch recht behaglichen Tiergarten in den Schatten stellt, nicht nur durch seine Dimensionen: das Cor-busierhaus, oder wie es 1957 sein Architekt offiziell genannt hat: Wohneinheit angemessener Größe, Typ Berlin. Einige Da-ten zum Bau: 141,20 m lang, 22,96 m breit, 52,94 m hoch, exakt in Nord-Süd-Richtung, 17 Wohngeschosse über einem 7,20 m hohen, teilweise offenen Erdgeschoss, 530 Wohneinheiten verschiedener Größe, 18 Monate Bauzeit, Grundsteinlegung Frühjahr 1957, Bezug Herbst 1958.
Le Corbusier und seine „Strahlende Stadt“, nach Marseille (1952) und Nantes-Rezé (1957) die dritte (von letztlich sechs) Unité d’habitation, wurden schon während der Bauzeit hef-tigst befeindet. Bereits dem Prototyp in Marseille attestierte der „Conseil supérieur d’Hygiène de France“, dass er Geistes-krankheiten aller Art fördern würde. Den Architekten nannte der Kollege Alexander von Senger „einen in die Irre geratenen Theologen mit den Gesichtszügen eines Inquisitors“. Zu den erklärten Gegnern des Berliner Projekts zählten – als Nachbar – das Nationale Olympische Komitee, der Bund Deutscher Ar-chitekten (allerdings nur wegen der Lage), der Landesverband Deutscher Baumeister und Bauingenieure, das Bundesbaumi-nisterium, der Berliner Gesundheitssenator und – last but not least – die Bauwelt: „Die Verantwortlichen für den Bauent-schluß werden bald oder später noch oft an die Verantwortung erinnert werden, die sie durch die Zustimmung zum Bau die-ses seltsamen Gebäudes auf sich nehmen“ (Rudolf Weilbier, Chefredakteur 1956). Von einem ebenso geharnischten Protest Le Corbusiers, wenn auch aus anderen Gründen, soll gleich noch die Rede sein.
Zunächst ein Augenzeuge, dessen frühe Berufserfahrung mit dem Corbusierhaus auf dem Heilsberger Dreieck verbunden bleibt. Jürgen Sawade hat fast von Anfang an am Bau mitgear-beitet und später eine kleine Einheit im Haus bewohnt, miet-frei gegen Führungen durchs Objekt, für – wie er sich erinnert – Julius Posener, Sepp Ruf, Egon Eiermann und viele Kollegen und Interessierte. Sawade war an das Praktikum gelangt, weil er zufällig im selben Haus mit dem Bauherrn Müller-Reppen wohnte. Der vermittelte ihn der Firma „Beton- und Monier-bau“, anfangs für eine Mark die Stunde, ins Baubüro – das heute noch steht –, später mit Akkordlohn zu den „gestandenen Zim-merleuten“ der Turmkolonne, die immer ein paar Stockwerke voraus den Treppen- und Fahrstuhlkern betonierte. Als einer von 200 Arbeitern, die in 2 mal 12 Stundenschichten an 7 Ta-gen die Woche arbeiteten, 18 Monate lang. Der Bau war fast halb hoch, als Le Corbusier sich ansagte. Ein dreimaliger Hup-ton des Poliers kündigte allen den nahenden schwarzen Mer-cedes an. Ihm entstiegen Bausenator Rolf Schwedler und LC in schwarzer Kleidung, schwarzem Hut und schwarzer runder
„Der Himmel hat es nicht gewollt, daß ...“Text: Peter Rumpf Foto: Landesarchiv Berlin, Gert Schütz
Vor fünfzig Jahren wurde in Berlin die Interbau eröffnet. Le Corbusier hat gegen die Umplanungen seiner Unité „Typ Berlin“ protestiert. Vergebens. Er hat das Haus nie mehr besucht und aus dem Œuvre gestrichen. Heute kümmert sich ein Förderverein um die Instandsetzung und Pflege.
Brille. Alle 200 Bauarbeiter standen auf dem Gerüst und häm-merten zur Begrüßung mit ihren Werkzeugen auf das Rohrge-stänge. Doch die Harmonie zwischen Berlin und Paris täuschte. Le Corbusier hatte nach eigenem Dafürhalten „eines der wich-tigsten soziologischen und architektonischen Ereignisse“ ent-worfen. Aber selbst dem Praktikanten Sawade fielen im ört-lichen Baubüro die Unterschiede zwischen den Plänen aus der Rue de Sèvres und denen auf, nach denen betoniert wurde. Le Corbusier beharrte auf seinem „Modulor“-Maßsystem: Raum-höhe 2,26 m inklusive zweigeschossigem Wohnraum vor den Fenstern, Ladenstraße im 7. OG, freies EG nur für die „Pilotis“ und eine verglaste Eingangshalle. „Andernfalls werde er beim Bundespräsidenten Heuss, beim franzö sischen Außenministe-rium und in der internationalen Presse formellen Protest ein-legen gegen den Mißbrauch seines Namens und gegen die Mißachtung Frankreichs als Teilnehmerland der Interbau“≥.
Genutzt hat die Drohung nichts. Die Normen für die Vergabe von Fördermitteln im Sozialen Wohnungsbau schrieben ei -ne Raumhöhe von 2,50 m vor. Zudem fürchtete der Bauherr um die Vermietbarkeit und änderte den Wohnungsschlüssel zugunsten von mehr 1- und 2-Raumwohnungen; die großen durchgesteckten Originale aus Marseille gibt es nur an der 8. und 9. „inneren Straße“. Um die Gesamtwohnfläche zu er-höhen, wurden alle Decken bis zur Fassade geschlossen; der zweigeschossige Teil entfiel. Die Einkaufsstraße auf halber Höhe wurde zum Laden im Erdgeschoss. Und an dem Gemein-schaftsangebot auf dem Dach war der Bauherr sowieso nicht interessiert. Mit „Der Himmel hat es nicht gewollt, daß...“ gab Le Corbusier seiner Verbitterung in einem Brief aus Paris vom 21. Mai 1958 Ausdruck. Seinen Typ Berlin hat er nie mehr be-sucht – und aus dem Œuvre gestrichen.
Wie steht das Haus heute da, 50 Jahre nach der Grundsteinle-gung? Nachdem es 1979 vom Berliner Immobiliengroßmogul Bendzko gekauft worden war und die 530 Wohnungen in Ei-gentum umgewandelt bzw. als solche den Mietern angeboten wurden, änderte sich folglich auch die Bewohnerstruktur. Dennoch gibt es heute noch etwa 40 Erstbezieher. Ursprüng-lich für 1600 Menschen geplant, zogen damals 1200 ein; heute wohnen dort etwa 1000. Die meisten der spartanisch engen Bäder sind vergrößert worden, die zum Wohnraum hin offe-nen Küchen sind inzwischen modernisiert. Die Gemeinschafts-waschküche an der 10. Straße ist verschwunden, ebenso der Supermarkt im Erdgeschoss. Die eigene Heiz-Kraft-Zentrale wurde durch den Anschluss ans öffentliche Netz überflüssig. Seit den 90er Jahren steht das Gebäude als Ensemble unter Denkmalschutz. Ein Förderverein aus Bewohnern und Freun-den kümmert sich seit 2004 verdienstvoll um Instandsetzung und Pflege, ein Denkmalpflegeplan ist gerade vom Landes-denkmalamt herausgegeben worden, und im nächsten Jahr, zum 50. Jubiläum des Einzugs, wird mächtig gefeiert. Ob es dann auch wieder das berühmte Nikolausfest in der 8. Straße gibt, von dem gern erzählt wird?
betrifft Das Corbusierhaus