Dadaismus (1)
-
Upload
mica-brljotina -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
description
Transcript of Dadaismus (1)

Dadaismus oder Dada war eine künstlerische und literarische Bewegung, die 1916 von Hugo Ball, Emmy Hennings, Tristan Tzara, Richard
Huelsenbeck, Marcel Janco und Hans Arp in Zürich gegründet wurde und sich durch Ablehnung „konventioneller“ Kunst bzw. Kunstformen
– die oft parodiert wurden – und bürgerlicher Ideale auszeichnete. Vom Dada gingen erhebliche Impulse auf die Kunst der Moderne bis hin
zur heutigen Zeitgenössischen Kunst aus. Über die Herkunft des Begriffs zirkulieren verschiedene, sich gegenseitig ausschließende
Theorien. Der Dadaismus stellte die gesamte bisherige Kunst in Frage, indem er ihre Abstraktion und Schönheit durch
z. B. satirischeÜberspitzung zu reinen Unsinnsansammlungen machte, z. B. in sinnfreien Lautgedichten. Hugo Ball war der Erfinder des
Lautgedichtes. Dabei wird das Zusammenspiel von Wortlaut und Bedeutung aufgebrochen und werden die Wörter in einzelne phonetische
Silben zerlegt. Die Sprache wird ihres Sinnes entleert und die Laute werden zu rhythmischen Klangbildern zusammengefügt. Dahinter steht
die Absicht, auf eine Sprache zu verzichten, die nach Ansicht der Dadaisten in der Gegenwart missbraucht und pervertiert ist. Mit den
sogenannten Simultangedichten (Lautgedichte werden gleichzeitig von verschiedenen Menschen durcheinander gesprochen) wollten die
Dadaisten auf die ohrenbetäubende Geräuschkulisse der modernen Welt (in den Schützengräben, in der Großstadt…) und auf die
Verstrickung des Menschen in mechanische Prozesse aufmerksam machen. Tatsächlich ist es oft schwierig und auch müßig, die „echten“
Kunstwerke der damaligen Zeit von den gewollt mehr oder weniger sinnlosen „Antikunstwerken“ des Dadaismus zu unterscheiden. Grenzen
zwischen traditioneller Kunst und Trivialkultur wurden überschritten. Hintergrund der Entstehung des Dadaismus ist die Situation der
Schweiz im Ersten Weltkrieg. In allen am Krieg teilnehmenden Staaten waren junge Künstler einerseits durch Schließung der Grenzen vom
Austausch mit ihren ausländischen Kollegen und Freunden ausgeschlossen und andererseits wurden sie zum Militärdienst eingezogen.
Kriegsgegner aus verschiedenen Staaten sammelten sich in der neutralen Schweiz, die zum einzigen Ort des internationalen Austauschs
wurde.
Am 5. Februar 1916 gründete Hugo Ball mit seiner Freundin Emmy Hennings inZürich in der Spiegelgasse 1, unweit
von Lenins Exilwohnung, das Cabaret Voltaire. Zuerst führte er mit ihr simple, aber auch exzentrische Programme auf. Sie
sang Chansons und er begleitete sie auf dem Klavier. Nach ein paar Wochen lernte er den rumänischen Dichter Tristan Tzara kennen, der
ebenfalls in Zürich lebte. Tristan Tzara gab 1916 die Zeitschrift Dada heraus. Im Kreis der Dadaisten war man froh, dass ein Dichter seines
Ranges diese Aufgabe übernahm. Mit der Zeitschrift versuchte Tzara, mit Dichtern aus anderen Ländern Kontakt aufzunehmen.
Bedeutende dadaisten: Hans Arp , Hugo Ball (1886–1927), Schweiz
Otto Dix , Kurt Schwitters, Tristan Tzara













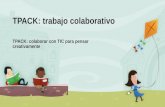
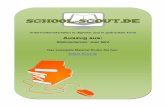
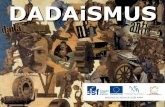
![1 ¢ Ù 1 £¢ 1 £ £¢ 1 - Narodowy Bank Polski · 1 à 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 ¢ 1 1 £ 1 £ £¢ 1 ¢ 1 ¢ Ù 1 à 1 1 1 ¢ à 1 1 £ ï 1 1. £¿ï° 1 ¢ 1 £ 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 ¢](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5fc6757af26c7e63a70a621e/1-1-1-1-narodowy-bank-polski-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg)


