APuZ_2015-13_online(2).pdf
Transcript of APuZ_2015-13_online(2).pdf
-
APuZAus Politik und Zeitgeschichte
65. Jahrgang 13/2015 23. Mrz 2015
BismarckAndrea Hopp
Warum Bismarck?
Andreas WirschingBismarck und das Problem eines deutschen Sonderwegs
Volker UllrichDer Mythos Bismarck und die Deutschen
Sandrine KottBismarck-Bilder in Frankreich und Europa
Tilman Mayer Was bleibt von Bismarck?
Jrgen Zimmerer Bismarck und der Kolonialismus
-
EditorialOtto von Bismarck zhlt zu den umstrittensten Figuren der deutschen Geschichte. An seinem Wirken als preuischer Mi-nisterprsident, Reichseiniger und erster deutscher Kanzler schieden sich schon die Geister seiner Zeitgenossen: Whrend ihn die einen als Architekten des deutschen Nationalstaates und geschickten Diplomaten verehrten, sahen die anderen in ihm ei-nen machiavellistischen Machtpolitiker und Reaktionr. Auch im Urteil der Nachwelt gilt er ebenso als Pionier des modernen Wohlfahrtsstaates wie als Inkarnation des preuischen Konser-vatismus und Militarismus und manchen gar als Wegbereiter der Katastrophen des 20. Jahrhunderts.
Der bereits zu Bismarcks Lebzeiten entstandene Kult um sei-ne Person wurde nach seinem Tod von nationalistischen und an-tidemokratischen Krften instrumentalisiert: Als martialischer Recke inszeniert, bot der Eiserne Kanzler eine ideale Projek-tionsflche fr imperialistische Ambitionen und, nach dem Ers-ten Weltkrieg, fr die Sehnsucht nach vergangener Gre, die schlielich die Nationalsozialisten fr ihre Symbolpolitik zu nutzen wussten. Inwiefern die Schreckensherrschaft des Natio-nalsozialismus aus der Entwicklungslogik des von Bismarck ge-schaffenen deutschen Nationalstaates resultierte, wurde in der Geschichtswissenschaft lange heftig diskutiert.
Am 1. April 2015 jhrt sich Bismarcks Geburtstag zum zwei-hundertsten Mal. ber ein Jahrhundert nach seinem Tod ist der erste deutsche Kanzler nach wie vor im Alltag prsent: In Deutschland erinnern Denkmler und Trme an ihn, berall auf der Welt sind Straen, Pltze oder Apotheken nach ihm be-nannt sogar eine Heringsspezialitt trgt seinen Namen. Den-noch sind Bismarck und sein Wirken heute im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte. Denn jenseits von Glorifizierung und Verdammnis hat sich in der historischen Forschung der vergan-genen Jahrzehnte eine differenzierte Betrachtung von Person und Werk im Kontext ihrer Zeit durchgesetzt.
Anne-Sophie Friedel
-
APuZ 13/2015 3
Andrea Hopp
Warum Bismarck?
Andrea Hopp Dr. phil., geb. 1963; Leiterin
der Otto-von-Bismarck-Stiftung Schnhausen, Kirchberg 45,
39524 Schnhausen (Elbe). [email protected]
Von dem US-amerikanischen Soziologen George Herbert Mead stammt die Aussa-ge, dass jede Generation ihre Geschichte neu
schreibt. Hinzuzuf-gen wre, dass dies vor dem Hintergrund je-weils unterschiedli-cher Erfahrungsru-me und Erwartungs-horizonte geschieht. 1 Letztere sind dafr
verantwortlich, dass von Generation zu Ge-neration die Vergangenheit neu auf dem Prf-stand steht und mit ihr das, was fr die Gegen-wart als erinnernswert und erinnerungsrele-vant betrachtet wird mithin auch jene Ereig-nisse und Personen, die als solches gelten und auf diese Weise zu Erinnerungsorten 2 wer-den. Als Fixpunkte aus der Vergangenheit sind sie infolgedessen keine statischen Gren: Er-innerungsorte wandeln den ihnen beigelegten Sinn mit den Kontexten und Bezgen, in denen sie stehen. Bedeutungszuschreibungen n-dern sich im Laufe der Zeit, genauso wie Ak-teure und Zielpublikum, Akzeptanz und Kon-flikttrchtigkeit variieren. 3 Dies trifft auch auf den ersten deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck (18151898) zu: verehrt und um-stritten, immer wieder politisch vereinnahmt, zusehends touristisch vermarktet, kontinuier-lich erforscht. Wie jngst der Historiker Eber-hard Kolb herausstellte, bleibe dabei auch in der historischen Einordnung () sein Bild durch scharf kontrastierende Bewertungen gekenn-zeichnet aufgrund der unterschiedlichen Be-urteilung seines Erbes einerseits und des Bis-marck-Mythos andererseits. 4
Jahrestage allein sind also noch kein zwin-gender Grund fr die Beschftigung mit ei-ner historischen Person. Die Aktivitten rund um Bismarcks zweihundertsten Geburtstag am 1. April 2015 zeigen jedoch einmal mehr das fortbestehende Interesse an ihm. Sie rei-chen von wissenschaftlichen Konferenzen und Publikationen ber wissenschaftlich begleite-te Ausstellungen bis hin zur Sonderbriefmarke und zum Tourismusangebot. In der Presse war zum Jahreswechsel 2014/15 mit Blick auf Ers-teres sffisant von Historiker-Festspielen die
Rede, fand sich die berschrift Ein Mann des Jahres? oder wurde gar lakonisch konstatiert: Worauf auch immer wir in der deutschen Ge-schichte stolz sein knnen, er war dagegen. 5 Diese unbersehbare Ironie zeugt von unauf-geregter Distanz zum Gegenstand, nimmt aber doch auch Bezug darauf, dass mit einer Vielzahl von Akteuren gerechnet wird, die ebenso wenig wie deren Angebote ein einheitliches Bild abge-ben. Insofern knnen Jahrestage auch Anlsse fr einen prfenden Rckblick sein. Angesichts der Wechselwirkung von ffentlicher Meinung und Expertenwissen ist es daher nicht nur legi-tim, sondern sogar unerlsslich zu fragen, wel-che Bedeutung Otto von Bismarck 2015 aus wissenschaftlicher Sicht beigemessen wird, und, eng damit verknpft, welche Rolle ihm dement-sprechend im Bereich der historisch-politischen Bildung zukommt.
Schlsselfigur des 19. Jahrhunderts
Betrachtet man Bismarcks biografisches Grundgerst, so liegt die Aufmerksamkeit, die er gegenwrtig geniet, nicht unbedingt auf der Hand. Er war ein preuischer Adliger, dessen aus der Stadt Stendal stammende Vor-fahren seit 1562 als Gutsherren im altmrki-schen Schnhausen lebten. 1846 bernahm er dort als Deichhauptmann ein fr den Landadel gngiges erstes ffentliches Amt und trat 1847 im preuischen Vereinigten Landtag als hoch-konservativer Nachwuchspolitiker in Erschei-nung, ehe er vier Jahre spter preuischer Di-plomat wurde und 1862 Ministerprsident von Preuen. Seit 1847 war er verheiratet mit Jo-
1 Vgl. George H. Mead, Das Wesen der Vergangenheit, in: ders., Gesammelte Aufstze, Bd. 2, hrsg. von Hans Joas, Frank furt/M. 1987 (1929), S. 337346, hier: S. 344; zu Erfahrungsraum und Erwartungshorizont als Rezeptions- und Deutungskategorien vgl. Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik ge-schichtlicher Zeiten, Frank furt/M. 19922, S. 349375.2 Vgl. Pierre Nora (Hrsg.), Les lieux de mmoire, Pa-ris 19841992.3 So im Kontext von Gedenktagen Harald Schmid, Erinnern an den Tag der Schuld. Das November-pogrom von 1938 in der deutschen Geschichtspolitik, Hamburg 2001, S. 47.4 Eberhard Kolb, Otto von Bismarck. Eine Biogra-phie, Mnchen 2014, S. 175.5 In der genannten Reihenfolge: Georg Meck, Die Kpfe des Jahres 2015, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) vom 28. 12. 2014, S. 30; Albert Funk, Ein Mann des Jahres?, in: Tagesspiegel vom 4. 1. 2015, S. 3; Nils Minkmar, Urahn der Putinfreun-de, in: FAS vom 4. 1. 2015, S. 34.
-
APuZ 13/20154
hanna von Puttkamer, wurde Vater dreier Kin-der und schlielich Besitzer dreier Landgter. Auf einem davon, Friedrichsruh, starb er am 30. Juli 1898 und wurde dort auch beigesetzt. 6
Dass Bismarcks Leben und Werk auch im 21. Jahrhundert noch als bedeutsam und da-her erinnerungsrelevant eingestuft werden, re-sultiert aus seinem letzten Karriere schritt vom preuischen Ministerprsidenten zum deut-schen Reichskanzler. Eng verbunden mit die-ser Phase seines Wirkens ist die Grndung des Kaiserreiches von 1871, die nach wie vor als ein klassischer Markstein der deutschen Geschich-te und Geschichtsschreibung gilt. Denn mit ihr waren fraglos grundlegende Weichenstellungen verbunden, leitete die Reichsgrndung doch zugleich einen langfristigeren Transformati-onsprozess ein. Eine politische Schlsselfigur der zweiten Hlfte des 19. Jahrhunderts war Bismarck darum gewiss, nicht nur fr Deutsch-land, sondern auch fr Europa. Auenpolitisch bezieht sich dies auf die Neuordnung der eu-ropischen Krfteverhltnisse. Innenpolitisch trieb er den Auf- und Ausbau des neugegrn-deten Staates voran und stellte mit Justiz- und Wirtschaftsreformen sowie in Verwaltungs-struktur und Sozialverfassung die Weichen fr den Durchbruch der Moderne. Diese Schlssel-rolle in der deutschen wie in der europischen Politik ist ohne Zweifel ein Grund, sich anlss-lich seines zweihundertsten Geburtstages mit dem Wirken des Staatsmannes Otto von Bis-marck auseinanderzusetzen.
Neue Perspektiven
Dabei gilt die Aufmerksamkeit zugleich dem 19. Jahrhundert und damit einer Zeit, die in praktisch allen Lebensbereichen eine des Um-bruchs und des bergangs war. Diese kombi-nierte Betrachtung von Person und Zeit hat sich unterdessen in der geschichtswissenschaftli-chen Forschung durchgesetzt. Bismarck und sein politisches Werk werden in ihren histori-schen Zusammenhngen verortet, wodurch er jenseits kultischer Erhhung eine normal-menschliche Dimension annimmt. 7 Um die-
6 Zur Familiengeschichte Bismarcks vgl. Ernst En-gelberg, Bismarck. Urpreue und Reichsgrnder. Berlin 19883, S. 184. 7 Formulierung beispielsweise bei Beate Altham-mer, Das Bismarckreich 18711890, Paderborn u. a. 2009, S. 266.
se Einordnung Bismarcks in sein Jahrhundert kommt keine Biografie mehr umhin. 8
Eine Historisierung von Person und Werk wird nicht nur durch die seit Bismarcks Le-ben verflossene Zeitspanne begnstigt, son-dern auch durch den zu Beginn des 21. Jahr-hunderts gewandelten Blick auf Deutschland, Europa und die Welt. Whrend im 19. Jahr-hundert noch Nationalstaaten die gr-ten vorstellbaren politischen Ordnungs-einheiten menschlichen Zusammenlebens waren und abgesehen davon um 1900 auch die einzigen, die weltweit ins Gewicht fie-len, 9 sind heute weit umfassendere Zusam-menschlsse unterschiedlichsten Zuschnitts denkbar beziehungsweise bereits realisiert. Entsprechend hat sich auch der geschichts-wissenschaftliche Horizont von einer sinn-stiftenden nationalstaatlich fokussierten Er-folgsgeschichte des eben Erreichten hin zur Frage nach der Rolle Deutschlands im Eu-ropa des 19. Jahrhunderts verlagert. In sig-nifikanter Weise kam dieses heutige Selbst-verstndnis bereits 1990 zum Ausdruck, als die erste groe Ausstellung des Deutschen Historischen Museums in Berlin Bismarck: Preuen, Deutschland und Europa themati-sierte und Bismarck mithin im europischen Kontext verortete. 10
berdies haben sich sowohl die Frage-stellungen als auch die methodischen Her-angehensweisen der Geschichtsschreibung enorm verndert und aufgefchert. Verbun-den mit der transnationalen beziehungs-weise vergleichenden Perspektive die auch die Zusammenarbeit von Historikerinnen und Historikern aus verschiedenen Ln-dern einschliet leistet dies einen weiteren Beitrag zu einer nchterneren Betrachtung
8 Fr die sptere Forschung wegweisend Lothar Gall, Bismarck. Der weie Revolutionr, Neuausga-be, Berlin 1997, S. 1725; eine detaillierte Einbettung in den historischen Kontext auch bei Otto Pflanze, Bismarck, Bd. 1: Der Reichsgrnder, sowie Bd. 2: Der Reichskanzler, Mnchen 1998; jngst E. Kolb (Anm. 4), S. 7 ff.; mit dem Anspruch der Einbettung in die europische Geschichte Christoph Nonn, Bis-marck. Ein Preue und sein Jahrhundert, Mnchen 2015.9 Jrgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, Mnchen 2009, S. 565.10 Vgl. Bismarck Preuen, Deutschland und Eu-ropa, Ausstellung des Deutschen Historischen Mu-seums, Berlin 1990.
-
APuZ 13/2015 5
Bismarcks. 11 Eines der Resultate der gre-ren Bandbreite untersuchter Aspekte ist ein vielfltigeres und weniger auf eindeutige Ent-wicklungen festgelegt erscheinendes Bild von Bismarcks Zeit.
Aus dem beschriebenen Perspektivwandel und den damit zusammenhngenden neuen Interessengebieten und Fragestellungen resul-tiert auch eine neu ausgerichtete, intensivier-te Grundlagenforschung. 12 Dabei wird durch die Bercksichtigung eines breiten Spektrums von Quellenbestnden das Panorama des poli-tischen Tagesgeschfts Bismarcks in ein kla-reres Licht gerckt. Besser erkennbar wird auf diese Weise, welche Position er tatschlich in-nerhalb des monarchischen Herrschaftsgef-ges einnahm. Denn so fraglos Bismarck das politische System und die politische Kultur prgte, war er doch dem Kaiser gegenber ver-antwortlich, musste er vor ihm Rechenschaft ablegen und ihn von seiner Politik berzeu-gen. 13 Daher endete die ra Bismarck schlie-lich nicht allein, weil das System Bismarck nicht mehr funktionierte und es etlichen Zeit-genossen berholt erschien, sondern weil allen voran Kaiser Wilhelm II. dieser Ansicht war. Nach mehreren schweren Konflikten, unter anderem um ein unbefristetes Sozialistenge-setz, entlie er Bismarck am 20. Mrz 1890.
Unfreiwillig fortschrittlich
Gleichwohl besteht kein Zweifel daran, dass Probleme wie Lsungen in Deutschland und Europa in diesem Zeitalter des bergangs mit
11 Vgl. etwa Klaus Hildebrand/Eberhard Kolb (Hrsg.), Bismarck im Spiegel Europas, Paderborn u. a. 2006, mit Beitrgen von Historikerinnen und Historikern aus ganz Europa; innovativ hinsichtlich der Auswer-tung sonst weithin bergangener Quellenbestnde bei-spielsweise Guido Thiemeyer, Internationalismus als Vorlufer wirtschaftlicher Integration? Otto von Bis-marck, das Phnomen der Supranationalitt und die In-ternationalisierung der Wirtschaft im 19. Jahrhundert, in: Ulrich Lappenkper/Guido Thiemeyer (Hrsg.), Eu-ropische Einigung im 19. und 20. Jahrhundert. Akteu-re und Antriebskrfte, Paderborn u. a. 2013, S. 7193.12 Vgl. etwa, seit 2004 erscheinend, Otto von Bis-marck, Gesammelte Werke, Neue Friedrichsruher Ausgabe, Paderborn u. a.13 Zum Forschungsdesiderat einer systematischen Untersuchung der Herrschaftspraxis im frhen Kai-serreich vgl. Hans-Peter Ullmann, Politik im deut-schen Kaiserreich 18711918, Enzyklopdie deutscher Geschichte, Bd. 52, Mnchen 1999, S. 68.
der Person Bismarcks aufs Engste verknpft waren. Als historische Leistung bleibt festzu-halten, dass Bismarck in dieser Umbruchphase die Umsicht besa, auf Kernprobleme mit Ini-tiativen zu reagieren, die weit ber seine Zeit hinaus fr Politik und Gesellschaft nicht an Bedeutung verloren. Eine List der Geschich-te ist es indessen, dass er mit eben diesen Ma-nahmen konsequent das Ziel verfolgte, das hergebrachte Gesellschaftsideal einer vergan-genen Epoche zu bewahren, stattdessen aber einem Zauberlehrling gleich unbeabsich-tigt in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft der Moderne zum Durchbruch verhalf. 14
Dieses Paradox gilt vor allem fr zwei der wichtigsten zukunftsweisenden innenpoliti-schen Errungenschaften. Zum einen war etwa die Verfassung von 1867/71 sein Werk und sah ein Parlament vor, das auf einem allgemeinen und gleichen (Mnner-)Wahlrecht basierte. Vergeblich versprach sich Bismarck davon je-doch nicht zuletzt die Mobilisierung der kon-servativen, knigstreuen Whlerschichten ge-gen das liberale Brgertum. Zum anderen sollte die Sozialgesetzgebung mit ihren Facet-ten einer Kranken-, Unfall-, Invaliditts- und Altersversicherung freilich der Daseinsvor-sorge dienen und zwar, was neu war, als Aufgabe des gerade erst geschaffenen brokra-tischen Interventionsstaates. Seine Bemhun-gen, den offensichtlichen Herausforderungen des Zeitalters der Industrialisierung und der Urbanisierung zu begegnen, verband Bismarck jedoch mit dem Ziel, der Sozialdemokratie durch Staatsbindung das Wasser abzugraben. Die dahintersteckenden Polarisierungsabsich-ten sowie jene, die auch den Kulturkampf ge-gen den politischen Katholizismus oder das Gesetz gegen die gemeingefhrlichen Bestre-bungen der Sozialdemokratie begleiteten, blieben nicht ohne langfristige Nachwirkun-gen. Noch 1988 betonte der Historiker Lothar Gall, dass all jene, auf denen der politische Grundkonsens der Bundesrepublik beruhe er meinte damals Christdemokraten, Liberale und Sozialdemokraten , bei aller gelassenen Distanz nicht vergessen, dass ihre politischen Vorvter Bismarcks Reichsfeinde waren. 15
14 Die berschrift Der Zauberlehrling trgt das dritte Kapitel bei L. Gall (Anm. 8), S. 529845; zum Ge-burtshelfer der Moderne wider Willen ebd., S. 844 f.15 Ders., Die Deutschen und Bismarck, in: Ralph Melville et al. (Hrsg.), Deutschland und Europa in der Neuzeit, Stuttgart 1988, S. 525536, hier: S. 536.
-
APuZ 13/20156
Die auenpolitische Bilanz fllt aus heuti-ger Sicht besser aus, wenn auch nicht in Be-zug auf die Reichsgrndung durch Eisen und Blut infolge dreier Kriege (gegen D-nemark 1864, sterreich 1866 und Frank-reich 1870/71), sondern auf die nachfolgen-de Politik des Mahaltens und den damit verbundenen Appell an die Solidaritt der Mchte fr Frieden und Sicherheit in Eu-ropa. Dem Historiker Jrgen Osterham-mel zufolge sind in allen Zivilisationen die Stifter und Bewahrer des Friedens im Ur-teil der Nachwelt stets Eroberern vorge-zogen worden. Doch wem beides gelang, dem war das hchste Ansehen gewiss: ein Reich erobert und ihm dann Frieden ge-bracht zu haben. 16 Otto von Bismarck wird wenn auch nicht als Eroberer, so doch als Reichsgrnder Anspruch auf beides attestiert.
Die nationalstaatliche Einheit erreichte er in einem begrenzten Rahmen, der fr das europische Umfeld gerade noch vertrg-lich war. 17 Danach erhob er, von Sicherheits-interessen geleitet, das Prinzip der Satu-riertheit des kleindeutschen Nationalstaates zum Gebot. Dass er zum selben Zweck auch ein Bndnissystem auf den Weg brachte, fr das die Nachbarn sterreich und Russland zentral waren, lag am gestrten Verhltnis zu Frankreich. Sein Ziel war es, einen Zweifron-tenkrieg gegen den Nachbarn im Westen und Russland unbedingt zu vermeiden. 18 Dieses Bndnis war indessen, so Lothar Gall, we-niger Krnung souverner Staatskunst als ein System von Aushilfen, das dazu die-nen sollte, den cauchemar des coalitions zu bannen den Albtraum der Koalitionen, der Bismarck nie loslie. 19 Die Notwendigkeit, sich auf diese Weise Bndnispartnerschaf-ten zu sichern, resultierte aus der halbhege-monialen Stellung (Ludwig Dehio) des neu-gegrndeten Nationalstaates im damaligen
16 J. Osterhammel (Anm. 9), S. 566.17 Klaus Hildebrand, Das vergangene Reich. Deut-sche Auenpolitik von Bismarck bis Hitler, Durch-gesehene Ausgabe, Berlin 1999, S. 20.18 Vgl. Otto von Bismarck, Gesammelte Werke, Neue Friedrichsruher Ausgabe, Abt. III: Schriften 18711898, Bd. 8: 18881890, Paderborn u. a. 2014, beispielsweise die Dokumente Nr. 92 und 160.19 L. Gall (Anm. 8), S. 689. Zur Auenpolitik der ra Bismarck vgl. Konrad Canis, Bismarcks Auenpoli-tik 1870 bis 1890. Aufstieg und Gefhrdung, Pader-born u. a. 2004.
Europa. 20 Weit entfernt von heutigen Vorstel-lungen europischer Zusammenarbeit und Gemeinschaft war er Gefhrdungen, auch durch Kriege, ausgesetzt, wie man sie unter-dessen eigentlich berwunden glaubte.
Mythos und Dmon
Was bei seiner Entlassung niemand vermu-tet htte: Lnger noch als Bismarcks Amtszeit dauerte sein Nachleben als Mythos. 21 Die-ses nahm seinen Anfang, als die Absicht des jungen Kaisers Wilhelm II. fehlschlug, sein eigener Kanzler zu sein und innen- wie au-enpolitisch einen neuen Kurs einzuschla-gen. Bismarcks Stellenwert als nationale traditions- und legitimationsstiftende Pro-jektionsflche fr ganz unterschiedliche In-teressen hat sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein behauptet: whrend des Ersten Welt-krieges hundert Jahre nach seiner Geburt, auf Kriegsbroschren als Eiserner Kanzler in Krassier uniform und Held der Einigungs-kriege; in der Weimarer Republik sowohl als moderater, umsichtiger Friedensbewahrer als auch als Galionsfigur der Republikgegner; und im Nationalsozialismus aufgrund dieser un-gebrochenen Anziehungskraft als Lockvogel fr die politische Rechte und fr das nationale Brgertum. 22 Diese politische Vereinnah-mung trug ihren Teil zu einer Distanzierung von Bismarck nach 1945 bei. In der Bundes-republik berwog Zurckhaltung, 23 in der DDR war die Trendwende radikal. Die Aus-wirkungen lassen sich im geteilten Deutsch-land an zwei zentralen mit Bismarck verbun-
20 Vgl. Hildebrand (Anm. 17), S. 1333.21 Siehe auch Volker Ullrichs Beitrag in dieser Aus-gabe (Anm. d. Red.).22 L. Gall (Anm. 15), S. 532; vgl. auch Christoph Studt, Das Bismarckbild der deutschen ffentlichkeit (18981998), Friedrichsruh 1999; Robert Gerwarth, The Bis-marck Myth. Weimar Germany and the Legacy of the Iron Chancellor, Oxford 2005; Richard E. Frankel, Bismarcks Shadow. The Cult of Leadership and the Transformation of the German Right, 18981945, Ox-ford 2005; Christoph Nbel, Der Bismarck-Mythos in den Reden und Schriften Hitlers. Vergangenheitsbil-der und Zukunftsversprechen in der Auseinanderset-zung von NSDAP und DNVP bis 1933, in: Historische Zeitschrift, 298 (2014), S. 349380.23 Vgl. den auch mit einem Hinweis auf die (west-)deutsche ffentlichkeit versehenen Sammelband zum Stand der Nachkriegshistoriografie von Lo-thar Gall (Hrsg.), Das Bismarck-Problem in der Ge-schichtsschreibung nach 1945, KlnBerlin 1971.
-
APuZ 13/2015 7
denen Erinnerungsorten aufzeigen: an seinem Geburtsort Schnhausen im Osten und sei-nem Sterbeort Friedrichsruh im Westen.
Friedrichsruh war schon zu Bismarcks Leb-zeiten Schauplatz des Kultes um seine Person gewesen und nach dem Untergang der Mo-narchie vermehrt ein Ort antirepublikani-scher Bekenntnisse. 24 Anlsslich Bismarcks 150. Todestag im Jahr 1965 war es indessen ruhig geworden im Sachsenwald. Die Welt vom 4. April 1965 vermerkte unter der ber-schrift Der Eiserne Kanzler rostfrei eine Bismarck-Feier in Friedrichsruh als ein ge-radezu rhrendes Schauspiel. Dies korres-pondierte mit vergleichsweise wenig Aufsehen auf der Bundesebene. 25 Whrenddessen wur-den nicht nur in Bismarcks Geburtsort Schn-hausen, sondern berall in der DDR smtliche Bismarck-Straen umbenannt. Die ihm zu Eh-ren errichteten Denkmler, Sulen und Trme verfielen oder wurden neu genutzt. Nach lan-gen Debatten wurde berdies 1958 in Schn-hausen Bismarcks Geburtshaus gesprengt, als Konsequenz des Erlasses Walter Ulbrichts aus dem Jahr 1948, die Spuren adliger Existenz auf dem Land zu beseitigen. 26
Mittlerweile sind Friedrichsruh (seit 1997) und Schnhausen (seit 2007) Standorte der Otto-von-Bismarck-Stiftung, eine der fnf Politikergedenkstiftungen des Bundes, die am historischen Ort unter dem Motto Biogra-fien erzhlen Geschichte entdecken einen Bildungsauftrag erfllen und sich gleichzeitig der wissenschaftlichen Forschung widmen.
24 Vgl. Andrea Hopp, Otto von Bismarck in Fried-richsruh Ort und Politik der Erinnerung, in: Ge-schichte, Politik und ihre Didaktik, 32 (2004) 34, S. 231242; zu Weimarer Republik und National-sozialismus Sandrine Kott, Bismarck, Paris 2003, S. 130 f., S. 135. 25 Ch. Studt (Anm. 22), S. 21. Zwar gab 1965 die Deutsche Bundespost eine Sonderbriefmarke heraus und die Bundesregierung veranstaltete eine Gedenk-feier. Bundeskanzler Ludwig Erhard bte sich jedoch in seiner kurzen Ansprache in expliziter Distanz, als er hervorhob, die Bundesrepublik sei fern davon, ihren Willen zur Wiedervereinigung mit der Idee des Reiches Bismarckscher Prgung zu verknpfen; vgl. Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 59 vom 2. 4. 1965. 26 Zu Schnhausen vgl. Andrea Hopp/Katja Gos-dek, Schnhausen: Geschichte erleben an Bismarcks Geburtsort, in: Ulrich Lappenkper/Andreas von Seggern (Hrsg.), Bismarck-Erinnerungsorte. Ein Be-gleiter durch die Museen in Friedrichsruh und Schn-hausen, Friedrichsruh 2010, S. 109117, hier: S. 112.
Allesamt informieren sie vor dem histori-schen Hintergrund der jeweiligen geschicht-lichen Epoche ber Lebenswege, politisches Denken und Wirken sowie das jeweilige his-torische Erbe der einzelnen Staatsmnner. 27 Da es mittlerweile zu den Forderungen der Geschichtsdidaktik zhlt, neben dem Lern-ort Schule auch andere didaktische Situatio-nen fr das historische Lernen einzubezie-hen, steigt die Bedeutung derartiger Lernorte, die zudem die Mglichkeit bieten, am histori-schen Ort vorhandene Quellen aufzugreifen.
Bismarck in der historisch- politischen Bildung
Was als Wissenschaftsstandard oben be-schrieben wurde, wird als Kompetenzori-entierung zum Paradigma des 21. Jahrhun-derts im Schulunterricht. Dort wie in der historisch-politischen Bildung insgesamt hat sich mittlerweile der nchterne historisier-te Blick auf Bismarck durchgesetzt. 28 Dazu zhlen auch das Hinterfragen gngiger Bis-marck-Bilder sowie die Auseinandersetzung mit Erinnerungsorten. Die Prsenz Bis-marcks im kollektiven Geschichtsbewusst-sein als eine zentrale Kategorie der Ge-schichtsdidaktik macht ihn im Hinblick auf die didaktische Zielsetzung, die Metaebene der Geschichte hinter der Geschichte an-zusprechen, sogar besonders interessant. 29
Ein Beispiel fr eine im Schulunterricht reali-sierte transnationale Perspektiverweiterung bie-tet das in Deutschland und Frankreich parallel erscheinende deutsch-franzsische Geschichts-buch. Der zweite Band vergleicht die politische
27 Zu den fnf Politikergedenkstiftungen des Bun-des fr Konrad Adenauer in Rhndorf, Friedrich Ebert in Heidelberg, Theodor Heuss in Stuttgart, Willy Brandt in Berlin und Lbeck sowie Otto von Bismarck in Friedrichsruh und Schnhausen vgl. www.politikergedenkstiftungen.de. 28 Vgl. Waltraud Schreiber, Kompetenzorientierter Geschichtsunterricht am Beispiel Otto von Bismarck, in: Markus Raasch (Hrsg.), Die deutsche Gesellschaft und der konservative Heroe. Der Bismarckmythos im Wandel der Zeit, Aachen 2010, S. 315344, hier: S. 324.29 Dies war Gegenstand eines Schulprojekts mit der Otto-von-Bismarck-Stiftung; vgl. Martin Liepach, Schule und Erinnerungsort, Friedrichsruh 2007, S. 13; ders., Bismarck Dekonstruktion eines My-thos, in: Geschichte, Politik und ihre Didaktik, 32 (2004) 34, S. 242248.
-
APuZ 13/20158
Entwicklung Frankreichs und Deutschlands zwischen 1870 und 1914 und integriert darin die Betrachtung Bismarcks. Gefragt wird bei-spielsweise einerseits, wie sich die republikani-sche Ordnung in Frankreich in der Praxis be-whrte, sowie andererseits, welche Grenzen der politischen Partizipation im Kaiserreich gesetzt waren. Dossiers setzen sich mit den Herausfor-derungen des 19. Jahrhunderts auseinander, wie etwa die Einfhrung einer Verfassung, die so-ziale Frage, das Verhltnis von Staat und Reli-gion oder Nation und Nationalismus. 30 Dieser im Schulunterricht vollzogene Perspektivwan-del verdeutlicht, wie historisch-politische Bil-dungsarbeit zu Bismarck gelingen kann. Im Unterschied zu den vier anderen, ihrerseits de-mokratischen Leitfiguren des 20. Jahrhunderts gewidmeten Politikergedenkstiftungen liegt eine reflektierte Rckbesinnung auf die deut-sche Geschichte mit dem Ziel, das Bewusstsein fr heutige demokratische Grundwerte zu fes-tigen, im Fall Bismarcks nmlich nicht auf der Hand. Voraussetzung hierfr ist vielmehr eine Betrachtung jenseits von Glorifizierung, Trivi-alisierung oder Dmonisierung, auf dem neu-esten Stand der Forschung, eingebettet in den historischen Kontext des Kaiserreiches. Am historischen Ort mit seiner vorgeblichen Au-thentizitt ist diese Herangehensweise von besonderem Gewicht. 31 Realisiert wird sie in Ausstellungen, Vortrgen und museumspda-gogischen Programmen, die beispielsweise Par-lamentarisierungs- und Demokratisierungs-prozesse im 19. Jahrhundert erlutern und sie mit Bismarcks politischem Denken und Han-deln in Beziehung setzen.
Nichtsdestotrotz bleibt zu konstatieren, dass Bismarcks innen- wie auenpolitisches Agie-ren als Reprsentant des deutschen Macht-staats vor der Demokratie 32 ihn weiterhin fr obrigkeitsstaatlich orientierte beziehungswei-
30 Vgl. Daniel Henri/Guillaume Le Quintrec/Peter Geiss (Hrsg.), Histoire/Geschichte. Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945. Deutsch-fran-zsisches Geschichtsbuch, StuttgartLeipzig 2008, S. 3, S. 3063. 31 Zu dieser Erwartung an die Aussagekraft der Orte, die gleichwohl gesellschaftlich vermittelt ist, vgl. Justus H. Ulbricht, Schwierige Orte als Erbe der Provinz, in: ders. (Hrsg.), Schwierige Orte. Regi-onale Erinnerung, Gedenksttten, Museen, Halle/S. 2013, S. 17 f.32 Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 18661918, Bd. 2: Machtstaat vor der Demokratie, Mn-chen 19923.
se antidemokratische Instrumentalisierungen attraktiv macht. Auch damit muss sich die his-torisch-politische Bildung auseinandersetzen. Schnhausen als einziger Standort einer Poli-tikergedenkstiftung in Ostdeutschland, noch dazu in einer der strukturschwchsten lnd-lichen Regionen Deutschlands, stellt in die-ser Hinsicht eine mehrfache Herausforderung dar. Denn nicht zuletzt die geschichtspoliti-schen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts ha-ben dort fr eine spezifische Zusammenset-zung konkurrierender Geschichtsbilder rund um Bismarck gesorgt. 33
Bedarf an einer Entmystifizierung Bismarcks besteht also nach wie vor. Ein prfendes Erin-nern an Werk und Person an ihrem runden Jah-restag kann dabei hilfreich sein. Im Sinne des eingangs zitierten George Herbert Mead wird Bismarcks Geschichte 2015 neu geschrieben, wenn der Blick in die Vergangenheit in Form einer differenzierten Auseinandersetzung mit Leistungen und Defiziten erfolgt und Zwnge ebenso wie Handlungsspielrume einer Ein-zelperson in ihrer Zeit zur Kenntnis genom-men werden. So gewendet vermag das Wissen um die Geschichte dazu beizutragen, knftig an gefhrlichen Irrwegen wie etwa dem Auf-bau von Feindbildern im Innern vorbeizusteu-ern und auenpolitisch die Verbindung von Augenhhe und Augenma beizubehalten nicht zuletzt angesichts der Umbrche und Krisen, mit denen Deutschland, Europa und die Welt derzeit konfrontiert sind. Warum also Bismarck? Weil insofern die Akte Bismarck noch lange nicht geschlossen werden kann. 34
33 In dieser Hinsicht ist Schnhausen ein schwieri-ger Ort als Erbe der Provinz im Spannungsverhlt-nis von Heimatgefhl, lokalen Geschichtsaneignungen und vergangenen Ereignissen. Bezogen auf Gedenk-sttten zur Geschichte des Nationalsozialismus und der DDR vgl. J. H. Ulbricht (Anm. 31), S. 20; zum Projekt Kunst fr Demokratie gegen die rechtsextremistische Vereinnahmung des Ortes, das 2012 im Rahmen des Programms Zusammenhalt durch Teilhabe des Bun-desministeriums des Innern gefrdert und 2013/14 un-ter dem Motto Ideen finden Stadt Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen wurde, vgl. www.zusammen-halt-durch-teilhabe.de/akteure/ 142071/elbe-havel-land sowie www.land-der-ideen.de/ausgezeichnete-orte/preistraeger/kunst-f-r-demokratie (20. 2. 2015).34 Die Aktenschlieung fr ausgemacht hielt Lo-thar Machtan, Bismarck, in: Etienne Franois/Hagen Schulze (Hrsg.), Deutsche Erinnerungsorte, Bd. 2, Mnchen 2001, S. 86104, hier: S. 86.
-
APuZ 13/2015 9
Andreas Wirsching
Bismarck und das Problem
eines deutschen Sonderwegs
Andreas Wirsching Dr. phil., geb. 1959; Profes-sor fr Neuere und Neueste Geschichte an der Ludwig-
Maximilians-Universitt Mnchen; Direktor des Instituts
fr Zeitgeschichte, Leonrod-strae 46b, 80636 Mnchen. [email protected]
Als Otto von Bismarck Anfang Mrz 1871 von Versailles nach Deutschland zurck-kehrte, befand er sich im Zenit seiner Populari-
tt. In der Vergangen-heit viel kritisiert, bis-weilen verspottet und von nicht wenigen ge-hasst, wurde er nun nach dem siegreichen Feldzug gegen Frank-reich und der Prokla-mation des Deutschen Kaiserreiches mit Ehrungen berhuft.
Bismarck galt als grter Staatsmann seiner Zeit, und es gab nur wenige, die fortfuhren, ihn ffentlich zu kritisieren.
Zu ihnen gehrte Georg Gottfried Gervi-nus, Veteran der Paulskirche, der das Schei-tern von 1848 nie verwunden hatte und seine Hoffnungen auf eine demokratische Bewe-gung setzte. Whrend die meisten Liberalen jubelten, unterzog Gervinus die Ereignisse von 1866 bis 1871 schneidender Kritik. Bismarck verkrperte fr ihn mehr denn je Deutsch-lands bsen Genius, und von der sich ab-zeichnenden Reichsgrndung erwartete er das Schlimmste: Wir werden in Bahnen gerissen, die uns nicht, die der ganzen Zeit nicht anste-hen. Was sollen wir in diesem Jahrhundert mit einer hchst berspannten Erneuerung der Militrstaaten des 17.18. Jh.? Das war nicht die Mission dieses Jahrhunderts, u. am wenigs-ten dieses Deutschlands. 1 Fr die fernere Zu-kunft sah er eine groe europische Katastro-phe voraus, in deren Verlauf der Boden der Geschichte () zu einer neuen Bestellung auf-gefurcht werde. 2 Mit der Grndung des neuen Deutschen Reiches, die er nur wenige Wochen berlebte, sah Gervinus die fderalen und de-mokratischen Prinzipien seiner Geschichtsauf-
fassung zerstrt, dem Militarismus ein fatales bergewicht zugestanden und zugleich groe Gefahren auf Deutschland zukommen. 3
Gervinus Kritik am Reichsgrndungsge-schehen verband sich also mit einem vernichten-den Urteil ber die Person Bismarcks. Unabhn-gig davon, ob dies einem eher vordergrndigen Gesinnungsidealismus entsprang oder ob er eine tatschliche Abweichung der deutschen vom Hauptstrom der westeuropischen Ge-schichte analytisch erfasste: Mit seiner Haltung wurde Gervinus zum ersten Vertreter der Son-derwegsthese. Fr die Mehrheit der deutschen Historiker stand hingegen die positive Wer-tung des Bismarck-Reiches auer Frage. Des-sen historische Mission schien es zu sein, eine neue Synthese aus Kultur und Macht, aus Au-toritt und Freiheit, aus Tradition und Moder-ne zu schmieden, der die Zukunft gehren wr-de. Die ideologische Klammer dieser Synthese bildete die Nation: Ihre Einheit galt es in einem starken Staat zu sichern, um kommende He-rausforderungen zu meistern und am Ende den Deutschen auch ihren wohlverdienten Platz an der Sonne zu sichern. berdies hegten groe Teile der deutschen Eliten ein tiefes Misstrau-en gegen den Interessenpluralismus der moder-nen industriellen Massengesellschaft. Nur eine Minderheit hielt die Methoden der westlichen Demokratie fr geeignet, um die Probleme der modernen Gesellschaft in Deutschland politisch zu steuern, sie sozial und kulturell zu bewlti-gen. Die Mehrheit hielt dagegen die westliche Zivilisation fr dekadent, materialistisch und malos. Seine schrfste Zuspitzung erhielt die-ses Denken in den Ideen von 1914. Sie bildeten die affirmative Form einer Sonderwegsideolo-gie, welche die deutsche Kultur und Machtent-faltung in einen dezidierten und positiv gewen-deten Gegensatz zur westlichen Entwicklung seit der Franzsischen Revolution setzte. 4
1 Gervinus an J. F. Minnsen, 6. 5. 1867, in: Jonathan F. Wagner, Gervinus ber die Einigung Deutsch-lands. Briefe aus den Jahren 186670, in: Zeitschrift fr die Geschichte des Oberrheins, 121 (1973), S. 371392, hier: S. 382.2 Gervinus an Ewald, 28. 4. 1867, in: ebd., S. 380.3 Siehe vor allem Georg Gottfried Gervinus, Denk-schrift zum Frieden. An das Preuische Knigshaus, in: ders., Hinterlassene Schriften, hrsg. von Victorie Gervinus, Wien 1872, S. 332.4 Vgl. Bernd Faulenbach, Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der Historiogra-phie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, Mnchen 1980.
-
APuZ 13/201510
Sonderweg zum Jahr 1933?Auch nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg blieb die groe Mehrheit der deutschen His-toriker dem Ideal des Bismarck-Reiches ver-pflichtet und sah in ihm trotz Niederlage und Revolution den Hhepunkt der nationalen Geschichte und den Fixpunkt der politischen Identitt der Deutschen. Fr die Geschichts-wissenschaft ergaben sich daraus als nchst-liegende und dringendste Tagesaufgaben die Kriegsschuld- und die Bismarckforschung. 5 Nicht zufllig entfalteten sich in der Weimarer Republik Bismarck-Mythos und Bismarck-Kult zu voller Blte. 6 Der Rekurs auf den gro-en Staatsmann diente als rckwrtsgewand-te Idealisierung einer Gre, die das Deutsche Reich verloren hatte und nach der sich die meisten Angehrigen des Brgertums und der Aristokratie zurcksehnten. Das Unglck des Weltkrieges konnte dagegen Wilhelm II. zugerechnet werden. Wenn gegenber dem schwchlichen Epigonen die Lichtgestalt Bis-marcks umso heller strahlte, war auch die Di-gnitt des Kaiser reiches trotz Niederlage, Zu-sammenbruch und Revolution bewahrt. So lie sich die gescheiterte Reichsgrndung des Eisernen Kanzlers auf Kosten des letzten deutschen Kaisers rehabilitieren.
Nur eine kleine Minderheit der deutschen Historiker blickte tiefer und legte strukturel-le Widersprche der Bismarckschen Schp-fung selbst offen. Insbesondere Arthur Ro-senberg betrachtete es als historischen Fehler von ungeheurem Ausma, dass Bis-marck die Verfassung geradezu auf seine Per-son zugeschnitten hatte. 7 Von hier aus kons-truierte er eine Art Geburtsfehlerthese: Die konstitutionellen Defizite der Bismarckschen Reichsgrndung und die mangelhafte Inte-gration der auseinanderstrebenden sozialen Krfte, nicht aber persnliche Schuld bilde-ten demzufolge die Ursache fr das Versagen Wilhelms II. und den Zusammenbruch im
5 So rckblickend Gerhard Ritter, Gegenwrtige Lage und Zukunftsaufgaben deutscher Geschichts-wissenschaft, in: Historische Zeitschrift, 170 (1950), S. 122, hier: S. 17.6 Vgl. Robert Gerwarth, Der Bismarck-Mythos. Die Deutschen und der Eiserne Kanzler, Mnchen 2007. Siehe auch Volker Ullrichs Beitrag in dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).7 Arthur Rosenberg, Entstehung und Geschich-te der Weimarer Republik, hrsg. von Kurt Kersten, Frank furt/M. (zahlreiche Nachdrucke), S. 13.
Ersten Weltkrieg. Fr Rosenberg kennzeich-nete daher von Beginn an eine nur mhsam berdeckte Dauerkrise die Geschichte des Kaiserreiches, die sich im Weltkrieg definitiv und unumkehrbar offenbarte: Das Bismarck-sche Reich war von Anfang an todkrank. 8
Was Rosenberg verfassungsgeschichtlich diagnostizierte, suchte Eckart Kehr struk-turgeschichtlich zu erhrten. Die Flotten-rstung, die Auenpolitik und den wilhel-minischen Imperialismus begriff er ebenso kritisch wie systematisch von ihren inneren sozialen, konomischen und kulturellen Vo-raussetzungen her. 9 Er betrachtete den Du-alismus zwischen Militr und ziviler Politik als entscheidende Strukturschwche der Bis-marckschen Schpfung. In den 1960er und 1970er Jahren knpften dann Hans-Ulrich Wehler und die sogenannte Bielefelder Schule an Autoren wie Rosenberg und Kehr an und stellten das Bismarck-Reich in eine dezidiert kritische Perspektive. Dabei ging es weni-ger um Bismarck als historische Persnlich-keit als um die Frage, inwieweit der Reichs-grnder die strukturellen Widersprche der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts und den damit verbundenen Rckstau poli-tischer Modernisierung reprsentierte. 10
Damit war die Frage nach einem deutschen Sonderweg in neuer Form auf die Tages-ordnung gesetzt worden. Ihren eigentlichen Stachel erhielt sie durch den Blick auf die Jah-re 1933 bis 1945. Bis in die 1960er Jahre hinein bestand ja durchaus die Versuchung, den Na-tionalsozialismus durch eine berbetonung des Dmonischen bei Hitler, durch allge-meine europische Krfte der Vermassung und Skularisierung oder auch durch die Vorstellung eines Betriebsunfalls der deut-schen Geschichte zu erklren. Ergaben sich Hitler und der Nationalsozialismus indes aus der Entwicklungslogik des 1871 gegrndeten preuisch-deutschen Nationalstaates, wie die Anhnger der Sonderwegsthese berwiegend argumentierten, dann wandelte sich das Bild fundamental.
8 Ebd., S. 12.9 Vgl. Eckart Kehr, Schlachtflottenbau und Partei-politik 1894 bis 1901. Versuch eines Querschnitts durch die innenpolitischen, sozialen und ideologi-schen Voraussetzungen des deutschen Imperialis-mus, Berlin 1930. 10 Hans-Ulrich Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 18711918, Gttingen 19804, S. 230.
-
APuZ 13/2015 11
Diese Diskussion beschftigte die west-deutsche Geschichtswissenschaft whrend der spten 1970er und der 1980er Jahre in-tensiv. Argumente pro und contra hielten sich dabei in etwa die Waage: Vertreter der Sonderwegsthese beharrten darauf, dass die Geschichte des Bismarck-Reiches und der durch sie geformten verspteten Nation (Helmuth Plessner) durch eine strukturelle Gleichzeitigkeit von industriewirtschaftli-cher Moderne, sozialer Hierarchisierung und verfassungspolitischer Rckstndigkeit ge-kennzeichnet war. Zusammen mit dem anti-westlichen Sonderbewusstsein der deutschen Eliten sei das damit gegebene Modernisie-rungsdefizit eine wichtige strukturelle Ursa-che fr den Aufstieg des Nationalsozialismus gewesen. 11 Die Gegner der Sonderwegsthe-se warnten indes vor der Entkoppelung der deutschen von der europischen Geschich-te ebenso wie vor einer verkrzten oder gar negativ teleologischen Sichtweise auf das Jahr 1933. berdies wirkte die dem Sonderweg stets implizite Konstruktion eines westlichen Normalweges problematisch und zu nor-mativ an einer idealen Modernisierungsent-wicklung ausgerichtet. 12
Solche Gegenstze waren auch methodisch begrndet. Dezidiert strukturgeschichtlich (und auch normativ) argumentierende Wis-senschaftler wie Hans-Ulrich Wehler, Jrgen Kocka oder Hans-Jrgen Puhle 13 unterschie-den sich in ihren erkenntnistheoretischen Prmissen grundlegend von jenen Histo-rikern, die wie Thomas Nipperdey auf das Verstehens- und Objektivittspostulat der Geschichtswissenschaft und deren indivi-dualisierende und differenzierende Prinzi-pien pochten. 14 Zugleich wurde der interna-tionale Vergleich als notwendige empirische Basis fr die These vom Sonderweg einge-fordert. Eine eher berraschende Kritik kam
11 Prgnant hierzu: Jrgen Kocka, Ursachen des Na-tionalsozialismus, in: APuZ, (1980) 25, S. 315.12 Vgl. Deutscher Sonderweg Mythos oder Re-alitt?, Kolloquien des Instituts fr Zeitgeschich-te, Mnchen 1982; vgl. insgesamt zum Thema Hel-ga Grebing, Der deutsche Sonderweg in Europa 18061945. Eine Kritik, Stuttgart u. a. 1986.13 Vgl. Hans-Jrgen Puhle, Agrarische Interessen-politik und preuischer Konservatismus im wilhel-minischen Reich, Bonn 19752.14 Vgl. beispielsweise Thomas Nipperdey, 1933 und die Kontinuitt der deutschen Geschichte, in: Histo-rische Zeitschrift, 227 (1978), S. 86111.
berdies von den beiden britischen Histori-kern David Blackbourn und Geoff Eley. Sie attackierten die Sonderwegsthese von dezi-diert (neo-)marxistischer Seite und verwie-sen insbesondere die Vorstellung von einer in Deutschland gescheiterten brgerlichen Revolution in den Bereich der historiogra-fischen Mythen. Statt deutsche Besonderhei-ten zu betonen, gelte es, die Krisenanfllig-keit moderner kapitalistischer Gesellschaften hervorzuheben. 15
Von Bismarck selbst und seiner Persn-lichkeit war im Kontext dieser eher genera-lisierend-interpretatorischen Debatten kaum mehr die Rede. Es blieb daher der groen, ei-gentlich ersten modernen Bismarck-Biogra-fie von Lothar Gall vorbehalten, den preui-schen Staatsmann wieder ins Rampenlicht zu rcken. Seine Biografie zeichnete sich durch ein souvernes, stets balanciertes Urteil aus. Gall verdeutlichte, wie stark Bismarck den tief in seiner Zeit wurzelnden geschichtli-chen Widersprchen verhaftet blieb, und wie es ihm immer schwerer fiel, sie in einer ge-staltenden Politik aufzuheben. Am Ende er-scheint Bismarck denn auch keineswegs mehr als der groe, vorausschauende Staats-mann, sondern schlicht als der Zauberlehr-ling, dem die gewaltigen nationalstaatlichen Krfte, die er gerufen hatte, ber den Kopf wuchsen. 16
Mithin gelang Gall eine methodisch be-deutsame Synthese von biografisch-indivi-dualisierender und strukturgeschichtlich in-formierter Betrachtungsweise. Sie nahm im Grunde auch der Sonderwegsdiskussion viel von ihrer Schrfe. Und seit dem Ende der 1980er Jahre ist diese Diskussion verstummt. Seinen Grund hatte das zum einen in der seit 1989/90 historisch vernderten Situation der Deutschen. Leicht lie sich nun davon ausge-hen, die Deutschen htten mit der Wiederver-einigung und der Restitution des deutschen Nationalstaates ihren Sonderweg beendet und seien nunmehr im Westen angekom-
15 Vgl. David Blackbourn/Geoff Eley, Mythen deut-scher Geschichtsschreibung. Die gescheiterte brger-liche Revolution von 1848, Frank furt/M. 1980.16 Vgl. Lothar Gall, Bismarck. Der weie Revolutio-nr, Frank furt/M. 1980; unter den zahlreichen weite-ren seitdem erschienenen Biografien sind zu nennen: Ernst Engelberg, Bismarck. Urpreue und Reichs-grnder, Berlin 1985; Otto Pflanze, Bismarck, 2 Bde., Mnchen 1997/98.
-
APuZ 13/201512
men. 17 Zum anderen gilt die Sonderwegsthe-se heute aber auch methodisch als berholt, dominieren doch in der Geschichtswissen-schaft kultur- und globalhistorische, verglei-chende und transnationale Fragestellungen.
Macht vor Recht
Zwei Aspekte seien allerdings hervorgeho-ben, die nach wie vor aktuell und auch aus heutiger Sicht bedenkenswert sind, wenn man ber die Person Bismarcks und mgli-che deutsche Sonderentwicklungen bis 1914 und darber hinaus diskutiert. So ist zum einen schon hufig beobachtet worden, dass Bismarcks Politik dazu tendierte, zumindest dann der Macht vor dem Recht den Vorzug zu geben, wenn sich damit der Nutzen Preu-ens, Deutschlands und nicht zuletzt des Hauses Hohenzollern steigern lie. 18 Zwar wird man einwenden, dass Bismarck damit in der zweiten Hlfte des 19. Jahrhunderts kei-neswegs allein stand: Man denke nur an die Versuche Napoleons III., in die kaiserlichen Fustapfen seines Onkels zu treten, oder an die imperialistische Gewaltpolitik, die Gro-britannien oder Leopold II. von Belgien in Indien und Afrika betrieben.
Aber in Deutschland bekam die Paro-le Macht vor Recht doch eine grundstz-lichere, gleichsam systematische Schrfe. Sie hatte entscheidend damit zu tun, wie im Li-beralismus das als traumatisch empfunde-ne Scheitern der Revolution von 1848 gedeu-tet wurde. Vor diesem Hintergrund stellten August Ludwig von Rochaus Grundstze der Realpolitik aus dem Jahre 1853 fr vie-le nicht weniger als eine Offenbarung dar. In dem, was der Publizist Rochau als das dy-namische Grundgesetz des Staatswesens be-zeichnete, verhielt sich das Recht zur Macht wie die Idee zur Tatsache. Anders ge-sagt: Rechtsbezogene Idealpolitik hatte im Zweifelsfall der machtbezogenen Realpoli-tik zu weichen. Es entbehrt nicht der Ironie, dass sich Rochau im Hinblick auf Bismarck fundamental irrte, wenn er 1862 ber ihn ur-
17 Vgl. Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen, Mnchen 2000. 18 Klassisch hierzu Bismarcks Rede vor dem preu-ischen Abgeordnetenhaus am 27. 1. 1863, in: Lothar Gall (Hrsg.), Bismarck. Die groen Reden, Berlin 1981, S. 6576.
teilte, mit ihm sei der schrfste und letzte Bolzen der Reaktion von Gottes Gnaden ver-schossen. 19 Denn im Prinzip war Bismarck doch der Mann, der ber weite Strecken hin-weg Rochaus realpolitische Maximen gera-dezu verkrperte.
Nicht bestreitbar sind insbesondere die ma-nipulativen Elemente, die Bismarck in seiner inneren Politik anwandte. Er zgerte nicht, mit der Macht der staatlichen Exekutive die liberalen Krfte in Deutschland zuerst zu in-strumentalisieren, um sich sodann, seit 1873, dezidiert gegen sie zu wenden. Ebenso wenig zgerte er, die Rechte oppositioneller Grup-pen und Milieus zu beschneiden: zunchst der Katholiken, sodann der Sozialisten stets mit der Begrndung, sie seien Reichsfein-de, die es aus der hegemonialen politischen Kultur des Kaiserreiches auszugrenzen gel-te. In der Forschung sind diese manipulativen Formen, die Bismarck anwandte, um politi-sche Mehrheiten zu gewinnen, als plebiszitr gestrkte, bonapartistische Herrschafts-weise bezeichnet worden. 20
Auch in der Auenpolitik verschmhte der Reichskanzler realpolitische Lsungen keineswegs. Schon whrend seiner Amts-zeit als preuischer Ministerprsident setz-te sich Bismarck ber Erwgungen der mo-narchischen Legitimitt souvern hinweg, so insbesondere 1866/67 bei der preuischen Annexion des Knigreiches Hannover und Schleswig-Holsteins. Zwar gilt Bismarcks Auenpolitik nach 1871 landlufig als auf den Erhalt des Friedens hin orientiert: So be-trachtete er das Kaiserreich als saturiert und suchte dessen Position dadurch zu scht-zen, dass er die europischen Interessen und Konflikte mglichst vom Zentrum an die Pe-ripherie lenkte, das heit auf den Balkan und in die Kolonien. 21 Auf dem Hhepunkt die-ser Politik, whrend des Berliner Kongres-ses von 1878, konnte sich Bismarck daher als ehrlicher Makler feiern lassen. Allerdings besa auch diese Politik eher instrumentellen Charakter. Von der Annexion Elsass-Loth-
19 Zit. nach: Ludwig August von Rochau, Grund-stze der Realpolitik. Angewendet auf die staatli-chen Zustnde Deutschlands, hrsg. von Hans-Ulrich Wehler, Frank furt/M. 1972, S. 9.20 H. Grebing (Anm. 12), S. 106.21 Vgl. hierzu nach wie vor Andreas Hillgruber, Bis-marcks Auenpolitik, Freiburg/Br. 1972, S. 136146.
-
APuZ 13/2015 13
ringens 1871 bis zur Krieg-in-Sicht-Krise 1875 hielt sich Bismarck die Option der pr-ventiven Gewalt stets offen. Erst als er 1875 bemerkte, dass er damit die Gefahr einer franzsisch-britisch-russischen Triple-Ko-alition (seinen cauchemar des coalitions) he-raufbeschwor, schwenkte er um. Allerdings lie sich die von ihm knftig verfolgte Poli-tik der Migung in den letzten Jahren sei-ner Regierung kaum mehr durchhalten. 1885 stimmte Bismarck schlielich zu, die Schleu-sen des Imperialismus zu ffnen; 22 und gegen Ende der 1880er Jahre hatte er alle Mhe, sich noch einmal gegen die Militrpartei durch-zusetzen, als der Preuische Generalstab un-ter seinem Chef, General von Waldersee, ei-nen Prventivkrieg forderte: zunchst gegen Frankreich, im Winter 1887/88 auch gegen Russland. 23
Bismarcks Auenpolitik der Migung entsprang also in erster Linie politischen Op-portunittserwgungen. An den Wnschen groer Teile der deutschen Eliten und nicht zuletzt auch an der in der preuischen Mili-trelite stark verwurzelten friderizianischen Tradition des Alles oder nichts ging die-se Migung indes vorbei. Die Auenpolitik unter Wilhelm II. entwickelte sich denn auch sprunghaft, aggressiv und unverkennbar vom Wunsch nach imperialistischer Expansion geleitet. Das Kalkl der Migung galt dem-gegenber als nicht mehr zeitgem.
Dualismus zwischen Militr und Zivilgewalt
In dieser Situation offenbarte sich, dass Bis-marcks Schpfung von 1866/71 an einer fol-genreichen Schwche litt, nmlich an der un-zureichenden Integration des Militrischen in das System ziviler Politik. Auch die Dis-kussion um einen deutschen Sonderweg kreiste lange Zeit um den Begriff des Mili-tarismus. Entsprechende Analysen und Kri-tik am Militarismus des Kaiserreiches setzten zwar bereits frh ein, blieben aber zunchst den Auenseitern der Geschichtswissen-
22 Vgl. Hans-Ulrich Wehler, Bismarck und der Im-perialismus, Kln 1969. Siehe auch Jrgen Zimmerers Beitrag in dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).23 Vgl. Michael Schmid, Der Eiserne Kanzler und die Generle: Deutsche Rstungspolitik in der ra Bismarck (18711890), Paderborn 2003, S. 273 ff.
schaft vorbehalten. So lieferte Eckart Kehr in seinem berhmten Aufsatz von 1928 ber die Genesis des Kniglich Preuischen Re-serveoffiziers eine gewissermaen klassi-sche Definition des Militarismus. Militaris-mus bestehe erstens dort, wo Offiziere sich nicht als Techniker und Funktionre eines bergeordneten politischen Willens fhlen, das heit, den Primat des Zivilen nicht aner-kennen wollen, und zweitens dort, wo diese Einschtzung des Militrs freiwillig von ei-nem wesentlichen Teil des Brgertums bejaht wird und eine Unterordnung unter diesen Militrstand willig vollzogen wird. 24
Es ist nicht bestreitbar, dass wesentliche Elemente einer solchen Definition in der po-litischen Kultur des Kaiserreiches anzutref-fen waren. Sie sind von der kritischen Litera-tur zum Teil sehr eingehend herausgearbeitet worden. In der Stellung wie im Denken des preuischen Generalstabs sowie der anderen mageblichen Militrs in Preuen war ein solcher Primat des Militrischen langfristig anzutreffen. Die Logik und die militrischen Sachzwnge eines kommenden Krieges spiel-ten in den engeren und engsten Fhrungs-zirkeln des Kaiserreiches stets eine beson-dere, zunehmend sogar herausragende Rolle. Politische Erwgungen, ziviles Denken, die Orientierung an Rechtsprinzipien und auch schlichte auenpolitische Rationalitt muss-ten demgegenber immer wieder zurck-treten. 25 Ebenso wenig lsst sich bestreiten, dass das Militrische in der deutschen Ge-sellschaft eine erhebliche Rolle spielte. Dem Militr galt die Bewunderung weiter brger-licher Schichten; Kriegervereine und Reser-vistenverbnde kultivierten das Militrische auch im Alltagsleben. Hieraus ist die These entwickelt worden, militrische Wertvorstel-lungen seien in der Breite auf die Gesellschaft bertragen worden, der Habitus des Militri-schen sei in die Zivilgesellschaft eingedrun-gen und habe die Mentalitten langfristig geformt.
24 Eckart Kehr, Zur Genesis des Kniglich Preui-schen Reserveoffiziers (1928), in: ders., Der Primat der Innenpolitik. Gesammelte Aufstze zur preu-isch-deutschen Sozialgeschichte im 19. und 20. Jahr-hundert, hrsg. von Hans-Ulrich Wehler, Frank-furt/M. u. a. 19702, S. 5363, hier: S. 54.25 Vgl. hierzu aus der neueren Literatur M. Schmid (Anm. 23); Isabel V. Hull, Absolute Destruction. Mi-litary Culture and the Practices of War in Imperial Germany, Ithaca 2005.
-
APuZ 13/201514
In jngerer Zeit ist diese These indes deut-lich relativiert und im Kern zurckgewie-sen worden. Vergleichende Studien etwa zu Frankreich und Grobritannien haben her-ausgearbeitet, wie stark das Militr auch in anderen Lndern im Zentrum der nationalen Identittsbildung stand. Militrfeiern, Fol-klore- und Gesinnungsmilitarismus seien Bestandteile der politischen Kultur und der Gesellschaft der europischen Staaten im Allgemeinen gewesen. Jedenfalls seien die Gemeinsamkeiten erkennbar strker sichtbar als die deutschen Besonderheiten. 26 Darber hinaus wurde der Begriff des Militarismus selbst differenzierter beurteilt. Als Quellen-begriff diente er seit den 1860er Jahren vor al-lem in Sddeutschland als antipreuische Pa-role und zugleich als diskursive Waffe fr die staatliche Eigenstndigkeit. Allzu vorschnell, so lautet die Kritik, habe die Geschichtswis-senschaft aus der antipreuischen Parole ei-nen wissenschaftlich-analytischen Begriff gemacht. Begriff und Phnomen des Milita-rismus mssten daher zunchst von der anti-preuischen Rhetorik gelst werden. 27
Damit ist die These vom deutschen Son-derweg auch in ihrer Militarismus-Kom-ponente zurckgewiesen worden und spielt heute keine signifikante Rolle mehr. Aller-dings sollte man darber eine Grundproble-matik der preuisch-deutschen Verfassungs-geschichte nicht auer Acht lassen, die zwar in der Forschung gut bekannt ist, in ihren Wirkungen aber heute unterschtzt wird, wenn es um die Interpretation der deutschen Geschichte seit dem spten 19. Jahrhundert geht. Es handelt sich um den nach 1871 nie-mals wirklich aufgehobenen Dualismus zwi-schen Militr- und Zivilgewalt, der dem deut-schen Verfassungsleben eingeschrieben blieb. Preuen und seine Armee mssen geradezu als der harte Kern im Verfassungswerk von 1867/71 angesehen werden. 28 Im Kaiserreich blieben Fragen des Militrs weitgehend der
26 Vgl. vor allem Jakob Vogel, Nationen im Gleich-schritt. Der Kult der Nation in Waffen in Deutsch-land und Frankreich, 18711914, Gttingen 1997.27 Vgl. Benjamin Ziemann, Sozialmilitarismus und militrische Sozialisation im deutschen Kaiserreich 18701914. Desiderate und Perspektiven in der Re-vision eines Geschichtsbildes, in: Geschichte in Wis-senschaft und Unterricht, 53 (2002), S. 148164.28 Manfred Messerschmidt, Militr und Politik in der Bismarckzeit und im wilhelminischen Deutsch-land, Darmstadt 1975, S. 32.
Exekutive vorbehalten, das heit dem Preu-ischen Kriegsministerium sowie dem Kaiser selbst beziehungsweise seinem engeren Um-feld wie dem Militrkabinett und nicht zu-letzt dem Preuischen Generalstab. All die-se militrischen Macht- und Einflusszentren waren der zivilen Gewalt und dem Reichstag weitgehend entzogen. Solche Abschottung des Militrischen fand im Namen der Kom-mandogewalt statt, die in Preuen tradi-tionell von Militrverwaltungssachen un-terschieden wurde. In der Praxis waren die Grenzen dieser Befehlsgewalt nicht eindeutig definiert, sodass sich mit ihr die kaiserliche Prrogative insgesamt ausdehnen lie. Denn die Kommandogewalt lag allein beim Preu-ischen Knig und Deutschen Kaiser. Akte der Kommandogewalt unterlagen nicht wie andere Regierungsmanahmen der Notwen-digkeit, durch einen Minister gegengezeich-net zu werden und lieen sich verfassungsm-ig durch Parlament oder Regierung nicht wirksam kontrollieren. 29
Mithin waren militrische und Zivilgewalt in der Verfassung des Kaiserreiches zwei ge-trennte Sulen. Ihre Integration war letzt-lich nur durch den Kaiser zu leisten. In der Praxis verfgten die Spitzen beider Sulen, der Reichskanzler einerseits und der Chef des Preuischen Generalstabs andererseits, ber eine Immediatstellung: Beide besaen das Recht, dem Kaiser unmittelbar vorzu-tragen. Bismarck gelang es aufgrund seiner berragenden Stellung 1870/71 gegenber General stabs chef Helmuth von Moltke der bekanntlich einen Exterminationsfrieden gegenber Frankreich forderte und 1887/88 noch einmal gegenber dessen Nachfolger Alfred von Waldersee in der Prventivkriegs-frage, die Militrgewalt in Schach zu halten.
Mit dem Abgang Bismarcks 1890 wurde jedoch der eingebaute Dualismus zwischen Militr- und Zivilgewalt immer deutlicher erkennbar. Ohne einen Kanzler von der Sta-tur Bismarcks war Wilhelm II. berfordert, die Vermittlung zwischen beiden Sulen zu vollziehen. Mehr und mehr setzte sich die militrische Eigenlogik durch, in das Kalkl
29 Vgl. Andreas Dietz, Das Primat der Politik in kai-serlicher Armee, Reichswehr, Wehrmacht und Bun-deswehr: Rechtliche Sicherungen der Entscheidungs-gewalt ber Krieg und Frieden zwischen Politik und Militr, Tbingen 2011, S. 65 f.
-
APuZ 13/2015 15
der Politik drangen die vorgeblichen milit-rischen Sachzwnge eines knftigen Krieges immer nachdrcklicher ein. In der Julikrise 1914 schlielich erhielt die militrische end-gltig die Oberhand ber die politische Fh-rung. Der wichtigste Sachzwang nmlich, den die Militrfhrung ins Feld fhrte, war die sichere Annahme, Deutschland werde einen nchsten groen Krieg als Zweifron-tenkrieg fhren mssen. Das Ergebnis war der Schlieffenplan, dem 1914 die Politik der Reichsleitung unter Kanzler Theobald von Bethmann Hollweg alternativlos folgte. Po-litisch-diplomatische Lsungsmglichkeiten blieben demgegenber auer Acht. Somit mutierte die militrstrategische Fixierung auf die sicher erwartete Zweifrontenausei-nandersetzung zu einer sich selbst erfllen-den Prophezeiung. Es bleibt daher eine Tat-sache: Das deutsche Heer war im Kaiserreich weitaus mehr ein Knigsheer als ein par-lamentarisches Heer und beruhte auf abso-lutistischen Restbestnden im Verfassungs-gefge des Kaiserreiches.
Fazit
Mithin bleibt es bis heute eine wichtige Fra-ge, inwieweit Bismarck die problematische Tendenz in der deutschen Geschichte ver-strkte, die Macht ber das Recht, das Mi-litrische ber das Zivile und die staatliche Exekutive ber die parlamentarisch-demo-kratische Willensbildung des Volkes zu stel-len. Zwar wre es nach fast fnf Jahrzehnten intensiver Forschung inadquat, aus dieser Tendenz einen einlinigen deutschen Son-derweg zu konstruieren oder aus ihr gar eindimensional das Jahr 1933 zu deduzieren. Insofern gibt es keinen direkten Weg von Bismarck zu Hitler. Aber der Stachel, den Nationalsozialismus tatschlich zu erklren und seine tiefer in der deutschen Geschichte liegenden Ursachen zu erkunden, bleibt fr die Geschichtswissenschaft eine unabweis-bare Herausforderung.
Volker Ullrich
Der Mythos Bismarck und die Deutschen
Volker Ullrich Dr. phil., geb. 1943; Historiker und Publizist; Herausgeber von ZEIT Geschichte. [email protected]
Von der Parteien Gunst und Ha ver-wirrt/Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Auf kaum einen anderen deutschen Staatsmann treffen diese Verse aus dem Prolog zu Schil-lers Wallensteins La-ger so zu wie auf Otto von Bismarck. 1 Whrend der langen Periode seines politischen Wirkens war er stets umstritten, war das Bild, das man sich von ihm machte, heftigen Schwankungen ausgesetzt. Auch nach seiner Entlassung als Reichskanzler im Mrz 1890 bewegten sich die Urteile ber ihn zwischen kultischer Ver-ehrung und vehementer Ablehnung.
Vom Konfliktminister zum Reichsgrnder
Am Anfang war Bismarck geradezu verhasst. Als Wilhelm I. ihn im September 1862 zum preuischen Ministerprsidenten ernannte, interpretierte die liberale Mehrheit im Abge-ordnetenhaus dies als offene Kampfansage. Denn seit seinen ersten Auftritten im Verei-nigten Landtag 1847 und noch mehr seit sei-nen gegenrevolutionren Aktivitten 1848/49 haftete dem Junker aus Schnhausen der Ruf eines reaktionren Scharfmachers an. Dass er whrend seiner diplomatischen Lehrjah-re als preuischer Gesandter im Bundestag in Frankfurt am Main und danach an den Bot-schaften von St. Petersburg und Paris gereift war und sich von den Anschauungen seiner ultrakonservativen Mentoren, der Brder Ludwig und Leopold von Gerlach, abge-wandt hatte das war der ffentlichkeit ver-borgen geblieben. Bismarcks Berufung be-
1 Friedrich Schiller, Smtliche Werke, hrsg. von Pe-ter-Andr Alt, Bd. 2, Mnchen 2004, S. 273.
-
APuZ 13/201516
deute Sbelregiment im Innern und Krieg nach auen, prophezeite einer der Wortfh-rer der Liberalen, Max von Forckenbeck. 2
In den ersten Jahren seiner Regierung schien es, als wrde Bismarck seinem Image als skrupellosem Gewaltpolitiker entspre-chen. Nicht durch Reden und Majorittsbe-schlsse werden die groen Fragen der Zeit entschieden das ist der groe Fehler von 1848 und 1849 gewesen , sondern durch Ei-sen und Blut, 3 bemerkte er am 30. Septem-ber 1862 in der Budgetkommission des Abge-ordnetenhauses und warf damit der liberalen Opposition den Fehdehandschuh hin. Hre ich aber einen so flachen Junker, wie diesen Bismarck, von dem Eisen und Blut prahlen, womit er Deutschland unterjochen will, so scheint mir die Gemeinheit nur noch durch die Lcherlichkeit berboten, emprte sich der junge Leipziger Privatdozent fr Ge-schichte Heinrich von Treitschke, spter als einflussreicher Professor in Berlin einer der glhendsten Bewunderer Bismarcks. 4
Seit Herbst 1862 regierte der Konflikt-minister verfassungswidrig, also ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Haushalt. Op-positionelle Beamte wurden gemaregelt, li-berale Zeitungen einer strengen Zensur un-terworfen. Das gegenwrtige Ministerium sei in einer Weise miliebig, wie selten eines in Preuen war, stellte Gerson Bleichrder, Bismarcks Bankier, im Februar 1863 fest. 5 Im Frhjahr 1866 war Bismarcks Ansehen auf ei-nem Tiefpunkt angelangt. Immer deutlicher zeichnete sich ab, dass der preuische Mi-nisterprsident es darauf anlegte, den Kon-flikt mit sterreich um die Vorherrschaft in Deutschland mit Gewalt zu lsen. Noch nie sei ein Krieg mit einer solchen Scham-losigkeit, einer solchen grauenvollen Frivoli-tt angezettelt worden, klagte der Gttinger Rechtsgelehrte Rudolf von Ihering. 6 Selbst
2 Zit. nach: Otto Nirrnheim, Das erste Jahr des Mi-nisteriums Bismarck und die ffentliche Meinung, Heidelberg 1908, S. 70.3 Horst Kohl (Hrsg.), Die politischen Reden des Frsten Bismarck 18471897, Bd. 2, Stuttgart 1893, S. 30.4 Max Cornelicius (Hrsg.), Heinrich von Treitschkes Briefe, Leipzig 1918, S. 238 (29. 9. 1862). 5 Zit. nach: Fritz Stern, Gold und Eisen. Bismarck und sein Bankier Bleichrder, Reinbek 1998, S. 60.6 Rudolf von Ihering in Briefen an seine Freunde, Leipzig 1913, S. 196 (1. 5. 1866).
Bismarcks hochkonservative Freunde dis-tanzierten sich von ihm, als er Anfang April 1866, um sterreich zu provozieren, einen Antrag auf die Einberufung eines National-parlaments in den Frankfurter Bundestag einbringen lie. In einem Leitartikel in der Kreuzzeitung vom 8. Mai brach Ludwig von Gerlach den Stab ber die zum Kriege treibende Politik. Zugleich verurteilte er den Bundesreformantrag als einen grundrevolu-tionren Versuch, () der das Herz Deutsch-lands und zugleich das Herz Preuens und sterreichs tief verwundet. 7
Der Sieg Preuens in der Schlacht von K-niggrtz am 3. Juli nderte alles: Bismarcks riskantes Spiel war aufgegangen, mit einem Schlage war er der Held des Tages. 8 Selbst die prinzipienfestesten Liberalen lie der Tri-umph nicht unbeeindruckt. Der Berliner Alt-historiker Theodor Mommsen empfand ein wunderbares Gefhl, dabei zu sein, wenn die Weltgeschichte um die Ecke biegt. 9 Die gemigten Anhnger der liberalen Fort-schrittspartei, die sich zur Nationalliberalen Partei zusammenschlossen, beeilten sich, ih-ren Frieden mit Bismarck zu machen. Und der kam ihnen seinerseits entgegen, indem er im Landtag um Indemnitt bat, also um die nachtrgliche Billigung seines budgetlosen Regiments. Einen vorlufigen Hhepunkt erreichte die ffentliche Wertschtzung Bis-marcks nach dem Sieg ber Frankreich und der Grndung des Kaiserreiches 1870/71. Die Nationalliberalen sahen sich, was die deut-sche Einheit betraf, am Ziel ihrer Wnsche. Wodurch hat man die Gnade Gottes ver-dient, so groe und so mchtige Dinge erle-ben zu drfen?, schwrmte der Bonner His-toriker Heinrich Sybel wenige Tage nach der Kaiserproklamation am 18. Januar 1871 in Versailles. Was zwanzig Jahre der Inhalt alles Wnschens und Strebens gewesen, das ist nun in so unendlich herrlicher Weise erfllt! 10
7 Zit. nach: Hans-Christof Kraus, Ernst Ludwig von Gerlach. Politisches Denken und Handeln eines preui-schen Altkonservativen, Bd. 1, Gttingen 1994, S. 805.8 Hajo Holborn (Hrsg.), Aufzeichnungen und Er-innerungen aus dem Leben des Botschafters Joseph Maria von Radowitz, Bd. 2, BerlinLeipzig 1925, S. 120 (20. 9. 1866).9 Zit. nach: Stefan Rebenich, Theodor Mommsen. Eine Biographie, Mnchen 2002, S. 167.10 Zit. nach: Julius Heyderhoff/Paul Wentzke (Hrsg.), Deutscher Liberalismus im Zeitalter Bismarcks. Eine politische Briefsammlung, Bd. 1, Bonn 1925, S. 494.
-
APuZ 13/2015 17
Idolisierter PensionrSchon bald kehrte jedoch Ernchterung ein. Der Brsenkrach vom Herbst 1873 been-dete die Hochkonjunkturphase der Reichs-grndungsra; es folgte eine lang anhalten-de Wirtschaftsflaute. Die von Bismarck vom Zaun gebrochene Verfolgung von Katholi-ken und Sozialdemokraten verschrfte die gesellschaftlichen Spannungen. Nach der in-nenpolitischen Wende von 1878/79, durch die der Reichskanzler die Zusammenarbeit mit den Nationalliberalen beendete, schwand die Hoffnung auf eine Weiterentwicklung der Reichsverfassung in Richtung eines parla-mentarischen Systems. Vor allem in linkslibe-ralen Kreisen wuchs nun wieder die Kritik an Bismarcks autoritrem Regierungsstil. Damit einher ging seit den frhen 1880er Jahren ein Gefhl lhmender Stagnation in der Innen- wie in der Auenpolitik. Unter den Zeitge-nossen verstrkte sich der Eindruck, dass die Rezepte des alternden Kanzlers, der schon so lange die politischen Geschfte fhrte, sich verbraucht htten und ein frischer Wind von-nten sei, um die Zukunft des Reiches zu si-chern. So verwundert es nicht, dass Bismarcks Entlassung durch Wilhelm II. im Mrz 1890 in weiten Kreisen der ffentlichkeit mit Er-leichterung aufgenommen wurde. Gott sei Dank, dass er fort ist, gab der linksliberale Eugen Richter, neben dem Zentrumspolitiker Ludwig Windthorst der bedeutendste parla-mentarische Gegenspieler Bismarcks, einer verbreiteten Stimmung Ausdruck. 11
Bald jedoch setzte ein abermaliger Um-schwung in der ffentlichen Meinung ein. Friedrichsruh, Bismarcks Alterssitz vor den Toren Hamburgs, wurde zum Ziel einer wachsenden Schar von Verehrern. Dass der grollende Exkanzler kaum eine Gelegenheit auslie, seinen Nachfolger Leo von Capri-vi als unfhig hinzustellen, schadete seinem Nimbus nicht. Im Gegenteil: In dem Mae, wie seine Gegner nun ihrerseits begannen, ihn zu attackieren, stieg seine Popularitt. Die wachsende Idolisierung des Reichsgrn-ders war ein Politikum, das der kaiserlichen Entourage zunehmend Sorge bereitete. Denn unberhrbar schwang darin ja auch Unmut ber den Monarchen mit, der sich durch sei-
11 Zit. nach: Hans-Joachim Schoeps (Hrsg.), Bis-marck ber Zeitgenossen Zeitgenossen ber Bis-marck, Frank furt/M.BerlinWien 1981, S. 218.
ne selbstherrlichen Allren und seine rheto-rischen Entgleisungen bereits um viel An-sehen gebracht hatte. Schlielich lie sich Wilhelm II. von seinen Ratgebern zu einem Treffen mit Bismarck im Januar 1894 berre-den, das als groes Vershnungsfest inszeniert wurde und in der ffentlichkeit begeister-ten Widerhall fand. An Bismarcks abscht-zigem Urteil ber den jungen Kaiser nder-te das Spektakel freilich nicht das Geringste: Noch auf seinem Sterbebett sollte er ihn einen dummen Jungen nennen. 12
Bismarcks achtzigster Geburtstag am 1. April 1895 wurde zu einem gigantischen Event. Aus allen Regionen des Reiches reisten Delegatio-nen an, um dem Alten im Sachsenwald zu huldigen. Hunderte von Stdten verliehen ihm die Ehrenbrgerschaft, Tausende Telegram-me und Briefe berschwemmten das kleine Friedrichsruher Postamt. 13 Im Reichstag je-doch lehnte eine Mehrheit aus Linksliberalen, katholischem Zentrum und Sozialdemokra-ten eine Glckwunschadresse an den Reichs-grnder ab ein Zeichen, dass die Wunden, die Bismarcks innenpolitischer Konfliktkurs geschlagen hatte, noch keineswegs verheilt wa-ren. Im nationalliberalen Brgertum emprte man sich ber den Beschluss des Parlaments, doch unter Sozialdemokraten erntete er viel Zustimmung. Ob denn die Welt verrckt geworden sei, fragte man sich in Hamburger Arbeiterkneipen, so viel Aufhebens um ei-nen Mann zu machen, der genug Unglck he-raufbeschworen hat. 14 Die Erinnerung an das 1890 ausgelaufene Sozialistengesetz war in die-sem Milieu noch hchst lebendig.
Stilisierung zur nationalen Heldenfigur
Nach Bismarcks Tod 1898 nahm der Kult um seine Person ungeahnte Dimensionen an. Nicht geringen Anteil daran hatten die pos-tum verffentlichten Memoiren des Frsten, Gedanken und Erinnerungen, die das Bild, das sich viele national gesinnte Deutsche vom Reichsgrnder machten, nachhaltig prg-
12 Lothar Machtan, Bismarcks Tod und Deutsch-lands Trnen. Reportage einer Tragdie, Mnchen 1998, S. 66.13 Vgl. Manfred Hank, Kanzler ohne Amt. Frst Bismarck nach seiner Entlassung 18901898, S. 413 f.14 Richard J. Evans, Kneipengesprche im Kaiser-reich. Die Stimmungsberichte der Hamburger Poli-tischen Polizei 18921914, Reinbek 1989, S. 337.
-
APuZ 13/201518
ten. Die im November 1898 erschienenen ers-ten beiden Bnde fanden reienden Absatz. In den Buchhandlungen, notierte Baronin Spitzemberg, prgelt man sich um Bismarcks Erinnerungen. 15 Der Bestseller avancierte zu einem der Lieblingsbcher der Deutschen. Ludwig Bamberger war einer der wenigen, der bedauerte, dass ein Buch, in dem die Worte Humanitt und Zivilisation nie anders er-whnt wrden als im Sinne der unbeding-ten Verspottung und der hohlen Phraseologie gerade bei der Jugend so viel Anklang fand. Dadurch wrde das fragwrdige Ideal der soldatischen Schneidigkeit mit allen seinen Auswchsen zum hchsten Ausdruck des Na-tionalcharakters ausgebildet. 16 In den Denk-mlern, die nach 1898 wie Pilze aus dem Bo-den schossen, fand dieses fragwrdige Ideal seinen markantesten Ausdruck. Sie zeigten den Reichsgrnder in Krassieruniform mit Pickelhaube, Stulpenstiefeln und Schwert als martialischen Recken, der grimmigen Ge-sichts seinen Blick in unbestimmte Ferne schweifen lsst. Wie kein zweites symbolisiert das Hamburger Bismarck-Denkmal Hugo Le-derers von 1906 in seiner kolossalen Gre den auftrumpfenden wilhelminischen Zeitgeist. 17
Der Bismarck-Mythos lste sich zunehmend von der realen historischen Gestalt ab. Hinter dem Monumentalbild des Eisernen Kanzlers verschwand, was seine Auenpolitik seit Mitte der 1870er Jahre ausgezeichnet hatte: der Sinn fr Ma und Migung, der Einsicht abge-rungen, dass die Existenz des Deutschen Rei-ches nur gesichert werden knne, wenn es sich selbst als saturiert definierte. Stattdessen wurde Bismarck nach seinem Tod zur Leitfi-gur eines berhitzten Nationalismus, in wel-che die wilhelminische Generation ihre im-perialistischen Sehnschte hineinprojizierte. Besonders der kleine, aber einflussreiche All-deutsche Verband begann Bismarcks Namen fr die eigenen vlkisch-expansionistischen Ziele in Anspruch zu nehmen. Jedes Jahr nach
15 Rudolf Vierhaus (Hrsg.), Das Tagebuch der Baro-nin Spitzemberg, Gttingen 19835, S. 381 (20. 12. 1898); vgl. Otto von Bismarck, Gesammelte Werke, Neue Friedrichsruher Ausgabe, Abteilung IV: Gedanken und Erinnerungen, Paderborn u. a. 2012, S. VIII.16 Gustav Seeber, Bismarcks Gedanken und Erin-nerungen von 1898, in: Jost Dlffer/Hans Hbner (Hrsg.), Otto von Bismarck. PersonPolitikMythos, Berlin 1993, S. 237246, hier: S. 242. 17 Vgl. Susanne Wiborg, Der grte Bismarck der Welt, in: Die Zeit vom 1. 6. 2006, S. 68.
Friedrichsruh zu pilgern und Bismarck durch Kranzniederlegungen zu ehren, galt den All-deutschen als heilige Pflicht. 18
Gegen die Stilisierung Bismarcks zur nati-onalen Heldenfigur erhob sich unter profes-sionellen Historikern kaum Widerspruch. Im Gegenteil: Die meisten beteiligten sich eifrig daran, den Mythos mit wissenschaft-lichen Argumenten zu untermauern. Ob die Vertreter der borussisch-kleindeutschen Schule, Heinrich von Sybel und Heinrich von Treitschke, oder die sie um die Jahrhundert-wende ablsenden Neo-Rankeaner um Max Lenz, Erich Marcks oder Hermann Oncken sie alle zollten dem Schpfer des Reiches freudig Tribut und waren geneigt, die Ex-zesse des Bismarck-Kults als unschuldigen berschwang hinzunehmen, als das etwas unangenehm drhnende Echo einer an sich trefflichen Melodie. 19 So trugen sie zu einem gesellschaftlichen Klima bei, das sich schlie-lich in der begeisterten Zustimmung des na-tionalen Brgertums zum Krieg im August 1914 ein Ventil schuf.
Zur geistigen Mobilmachung dieser Tage gehrte auch die Beschwrung des Eisernen Kanzlers. Vom Bismarck in Feldgrau war die Rede, dessen Werk nun vollendet werden ms-se. 20 Einen Hhepunkt erreichte die militan-te Bismarck-Verklrung anlsslich seines hun-dertsten Geburtstages am 1. April 1915. Wir sehen ihn vor unseren Augen bermenschlich gro, als Roland und Siegfried zugleich, ver-kndete der nationalliberale Politiker Gustav Stresemann, damals noch ein glhender Anne-xionist, und der Historiker Max Lenz sekun-dierte: Bismarcks gewaltiger Schatten zieht mit in unseren Heeren. Sein Schwert ist es, dessen Schlge drauen so furchtbar widerhal-len. 21 Nicht nur in offiziellen Veranstaltun-gen, sondern auch im privaten Kreis wurde des Reichskanzlers gedacht. Im Tagebuch des Hei-
18 Rainer Hering, Konstruierte Nation. Der Alldeut-sche Verband 1890 bis 1939, Hamburg 2003, S. 229 f.19 Hans-Gnter Zmarzlik, Das Bismarck-Bild der Deutschen gestern und heute, Freiburg 1967, S. 16 f.20 Theobald Ziegler, Bismarck und die akademische Jugend, in: Max Lenz/Erich Marcks (Hrsg.), Das Bis-marck-Jahr, Hamburg 1915, S. 252295, hier: S. 257.21 Zit. nach: Egmont Zechlin, Das Bismarck-Bild 1915. Eine Mischung aus Sage und Mythos, in: ders., Krieg und Kriegsrisiko. Zur deutschen Politik im Ersten Weltkrieg, Dsseldorf 1979, S. 227233, hier: S. 227 f.
-
APuZ 13/2015 19
delberger Medivisten Karl Hampe ist unter dem Datum des 1. April 1915 zu lesen: Nach-mittags hatten wir im Hause eine kleine Bis-marckfeier. Lotte (Hampes Frau Anm. V. U.) hat in der Wohnstube eine geliehene Bismarck-statue aufgestellt. Sie und die Kinder sagten Gedichte (). Ich hatte das Ganze mit einer kleinen Rede eingeleitet. 22
Wie schon in den 1890er Jahren schloss die Berufung auf Bismarcks Titanengestalt im Weltkrieg immer auch eine Kritik an den fr unfhig gehaltenen Nachfolgern ein, in die-sem Falle an Theobald von Bethmann Holl-weg, der den Annexionisten als Flaumacher galt und auf dessen Sturz sie im Juli 1917 ziel-bewusst hinarbeiteten. Nicht zufllig soll-te die Deutsche Vaterlandspartei, in der sich damals die Anhnger eines Siegfriedens sammelten, ursprnglich den Namen Bis-marckbund tragen. 23 Nach den allzu lange gehegten Illusionen ber Deutschlands Sie-ges aus sichten wurden die Niederlage von 1918 und das ruhmlose Ende der Hohenzollern-monarchie in nationalkonservativen Kreisen doppelt schmerzhaft empfunden. Wir haben zusammen geweint, notierte Karl Hampe am 10. November. Zur Strkung las ich Lotte spt aus Bismarcks Gedanken und Erinne-rungen den Abschnitt ber 1848 vor. 24
Vorbild eines wegweisenden Fhrers
Zurck zu Bismarck wurde zum Schlacht-ruf der politischen Rechten in der Weimarer Republik, das heit all jener, die der gelieb-ten Ordnung des Kaiserreiches hinterher-trauerten, die Deutschlands Gromachtstel-lung wieder herstellen wollten und eine starke Regierung ber den Parteien herbeisehnten. Wer mnnlich fhlt und denkt, wer von Bis-marcks Geist einen Hauch versprt hat, harret aus in Lehre und Beispiel, um die Rckkehr zu ihm zu erreichen, erklrte der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes, Heinrich Cla, im Mrz 1920. 25
22 Karl Hampe, Kriegstagebuch 19141918, hrsg. von Folker Reichert und Eike Wolgast, Mnchen 2004, S. 217.23 Vgl. Heinz Hagenlcke, Deutsche Vaterlandspar-tei. Die nationale Rechte am Ende des Kaiserreichs, Dsseldorf 1997, S. 149151.24 K. Hampe (Anm. 22), S. 776 (10. 11. 1918).25 Zit. nach: Lothar Machtan (Hrsg.), Bismarck und der deutsche Nationalmythos, Bremen 1994, S. 35.
Der Bismarck-Mythos erhielt somit eine neue Funktion: Hatte er vor 1918 dazu ge-dient, das politische und gesellschaftliche Sys-tem des Kaiserreiches zu legitimieren, so soll-te er nun dazu beitragen, die demokratische Ordnung von Weimar zu destabilisieren. 26 Deutlich wurde dies zum Beispiel whrend der Veranstaltungen zum fnfzigsten Jahres-tag der Reichsgrndung am 18. Januar 1921. Der Romanist Victor Klemperer etwa no-tierte im Telegrammstil, was der Rektor der Technischen Universitt Dresden in einer Fei-erstunde zum Besten gab: Das Reich ist in Trmmern, schuld die Frevler an Bismarck, Regierende wie den Frevel duldendes Volk Kraft mu wiederkommen etc. Klemperers Kommentar: Teils Phrase, teils Reaction. 27
Die Dolchstolegende, also die Behaup-tung, Juden und Sozialisten seien fr die Nie-derlage verantwortlich, verband sich mit dem Bismarck-Mythos zu einem trben Gemisch, das die politische Kultur Weimars nachhal-tig vergiftete. Dieser Propaganda hatte die demokratische Linke wenig entgegenzuset-zen. Der den Sozialdemokraten nahestehen-de Freiburger Jurist Hermann Kantorowicz forderte 1921 dazu auf, endlich aus Bismarcks Schatten herauszutreten, denn solange jener ber den jungen Baum der deutschen Demo-kratie falle, knne dieser nicht gedeihen. 28 Auch der Erfolgsautor Emil Ludwig bemh-te sich mit seiner populren Bismarck-Bio-grafie von 1926 um einen Brckenschlag, in-dem er den Mythos aus der Verfgungsmacht der Republikgegner zu befreien suchte. Ru-dolf Olden dankte ihm in einer Rezension im Berliner Tageblatt: Bismarck, das ist un-sere, des Deutschen Reiches Geschichte. Wer so erzhlt, da Millionen Deutsche sie richtig lesen, der sichert den Weg, den es allein jetzt gehen kann, den Weg der Republik. 29 Doch dies blieben Stimmen von Auenseitern. Das Gros der deutschnational orientierten Fach-
26 Vgl. Robert Gerwarth, Der Bismarck-Mythos. Die Deutschen und der Eiserne Kanzler, Mnchen 2007, S. 42 ff.27 Victor Klemperer, Leben sammeln, nicht fragen wozu und warum: Tagebcher 19181924, hrsg. von Walter Nowojski, Berlin 1996, S. 408 (19. 1. 1921).28 Hermann Kantorowicz, Bismarcks Schatten, Frei burg/Br. 1921, S. 5.29 Sebastian Ullrich, Im Dienste der Republik von Weimar. Emil Ludwig als Historiker und Publi-zist, in: Zeitschrift fr Geschichtswissenschaft, 49 (2001) 2, S. 130 f.
-
APuZ 13/201520
historiker verharrte in feindseliger Distanz zur Weimarer Republik. Trotz mancher Fort-schritte der Geschichtsforschung war die Fas-zinationskraft des Bismarck-Mythos unge-brochen. Die Herausgabe der Gesammelten Werke Bismarcks seit 1924, so verdienstvoll sie auch war, diente denn auch einem politi-schen Zweck, den einer der Bearbeiter, Fried-rich Thimme, unverblmt benannte: unserer heranwachsenden Jugend und der kommenden Fhrerschicht unseres Volkes () ein leuch-tendes Vorbild zu geben, in welcher Weise sie das Ziel, Deutschlands Macht und Gre wiederherzustellen, erreichen knnen. 30
Der Ruf nach einem zweiten Bismarck ar-tikulierte sich in den letzten Jahren der Weima-rer Republik immer vernehmlicher. Sein Bild vor allem schwebt uns vor, rief der Mnch-ner Historiker Karl Alexander von Ml-ler auf dem Dritten Bismarck-Tag 1929 aus, wenn wir hoffen, da die politische Schp-ferkraft unseres Volkes noch nicht erloschen ist und sich eines Tages wieder, wie ein Blitz im Gewlke, verdichtet zu einem wegweisen-den Fhrer. 31 Nicht wenige sahen bereits vor 1933 in dem Fhrer der NSDAP, Adolf Hit-ler, diese neue charismatische Heilsfigur. Je-denfalls konnten sich die Nationalsozialisten die weitverbreitete Sehnsucht nach einem po-litischen Messias zunutze machen. Geschickt bedienten sie sich in den ersten Monaten nach der Machtergreifung Bismarcks Namen, in-dem sie sich als junge Kraft prsentierten, die das Werk des groen Vorgngers fortset-zen wolle. Am 1. April 1933 pries Propagan-daminister Joseph Goebbels im Rundfunk die Wiedergeburt der Nation als historisches Wunder: Bismarck war der groe staatspoli-tische Revolutionr des 19. Jahrhunderts, Hit-ler ist der groe staatspolitische Revolutionr des 20. Jahrhunderts. 32 Je mehr sich aber Hit-lers Diktatur konsolidierte und der Fhrer-kult ppige Blten trieb, desto weniger waren die Nationalsozialisten auf den Bismarck-My-thos als Legitimationsmittel angewiesen. Der
30 Annelise Thimme (Hrsg.), Friedrich Thimme 18681938. Ein politischer Historiker, Publizist und Schriftsteller in seinen Briefen, Boppard am Rhein 1994, S. 311 (7. 8. 1931).31 Zit. nach: L. Machtan (Anm. 25), S. 46; vgl. Mat-thias Berg, Karl Alexander von Mller. Historiker fr den Nationalsozialismus, Gttingen 2014, S. 155 ff.32 Zit. nach: Lothar Machtan, Bismarck, in: Etienne Franois/Hagen Schulze (Hrsg.), Deutsche Erinne-rungsorte, Bd. 2, Mnchen 2001, S. 86104, hier: S. 101.
Reichsgrnder wurde zum Vorlufer degra-diert; 33 seine Bedeutung in der Symbolpolitik des Dritten Reiches nahm kontinuierlich ab.
Deutungsversuche zwischen Glorifizierung und Verdammnis
Im konservativen Widerstand gegen Hitler begann man sich freilich in dem Mae auf Bismarck zurckzubesinnen, wie deutlich wurde, dass der Diktator mit seiner verbre-cherischen Eroberungs- und Vernichtungs-politik alle zivilisatorischen Normen auer Kraft und dabei die Existenz des Reiches selbst aufs Spiel setzte. Kaum zu ertragen, ich war dauernd nahe an Trnen beim Ge-danken an das zerstrte Werk, notierte der Diplomat Ulrich von Hassell nach einem Be-such in Friedrichsruh Anfang Juli 1944. Ich habe mich in den letzten Jahren viel mit Bis-marck beschftigt, und er wchst als Auen-politiker dauernd bei mir. Es ist bedauerlich, welch falsches Bild wir selbst in der Welt von ihm erzeugt haben, als dem Gewaltpolitiker mit Krassierstiefeln, in der kindlichen Freu-de darber, da jemand Deutschland endlich wieder zur Geltung brachte. 34
Mit diesem Eingestndnis war eine Revisi-on der nationalkonservativen Bismarck-Deu-tung eingeleitet, die sich nach dem Ende des Dritten Reiches fortsetzen und zu einem grundlegenden Wandel der Betrachtungs-weise fhren sollte. Den Anfang machte der damals bereits ber achtzigjhrige Friedrich Meinecke mit seinem Essay Die deutsche Katastrophe von 1946: In der unmittelbaren Leistung Bismarcks selbst war etwas, das auf der Grenze zwischen Heilvollem und Unheil-vollem lag und in seiner weiteren Entwicklung immer mehr zum Unheilvollen hinberwach-sen sollte, schrieb der Nestor der deutschen Geschichtswissenschaft. Der erschtternde Verlauf des ersten und noch mehr des zweiten Weltkriegs lt die Frage nicht mehr verstum-men, ob nicht Keime des spteren Unheils in ihm von vornherein wesenhaft steckten. 35
33 Theodor Heuss, Das Bismarck-Bild im Wandel. Ein Versuch, Berlin 1951, S. 3.34 Ulrich von Hassell, Vom andern Deutschland. Aus den nachgelassenen Tagebchern 19381944, Frank furt/M. 1964, S. 319 (10. 7. 1944).35 Friedrich Meinecke, Die deutsche Katastrophe. Be-trachtungen und Erinnerungen, Wiesbaden 1946, S. 26.
-
APuZ 13/2015 21
Damit war die Kernfrage aufgeworfen, wel-che die deutsche Geschichtswissenschaft in den nchsten Jahren und Jahrzehnten inten-siv beschftigen sollte: die nach der Konti-nuitt der deutschen Politik zwischen 1871 und 1933, zwischen Kaiserreich und Drit-tem Reich. 36 In diesem Kontext wurde die Auseinandersetzung mit Person und Werk Otto von Bismarcks zur Nagelprobe fr die Bereitschaft der Historiker, die berkomme-nen Deutungsmuster einer kritischen ber-prfung zu unterziehen. 37
Auf die dreibndige, vor 1945 im englischen Exil geschriebene Bismarck-Biografie von Erich Eyck, die an die Kritik der linksliberalen Zeitgenossen des Reichsgrnders anknpf-te, reagierte die Zunft noch mit verstockter Abwehr. Fr den Freiburger Historiker Ger-hard Ritter bedeutete das Werk des Auen-seiters eine versptete Revanche der durch Bismarck vergewaltigten und korrumpierten deutschen Liberalen von 186266; anstelle der alten werde nun eine neue Bismarcklegende, mit umgekehrten Vorzeichen, etabliert. 38 Der Mnchner Historikertag von 1949, der erste nach dem Zweiten Weltkrieg, stand denn auch ganz im Zeichen des Versuchs, jeden Zusam-menhang zwischen der Politik Bismarcks und der Hitlers zurckzuweisen. Als Hauptred-ner hatte man sich schon frh um Hans Roth-fels bemht, den die Nazis wegen seiner j-dischen Herkunft von seinem Knigsberger Lehrstuhl vertrieben und in die Emigration gezwungen hatten. Er wre der vom Him-mel gesandte Mann fr das Bismarck-Thema, schrieb Hermann Aubin im November 1948 an Gerhard Ritter. 39 Und Rothfels enttusch-te die in ihn gesetzten Erwartungen nicht. Sein mit viel Applaus bedachter Vortrag mn-dete in die Feststellung einer Grundtatsa-che: dass das Zweite Reich im Entscheiden-den und in prinzipieller Grenzsetzung genau
36 Siehe auch Andreas Wirschings Beitrag in dieser Ausgabe (Anm. d. Red.).37 Vgl. Winfried Schulze, Deutsche Geschichtswis-senschaft nach 1945, Mnchen 1989, S. 224.38 Gerhard Ritter, Das Bismarck-Problem (1950), in: Lothar Gall (Hrsg.), Das Bismarck-Problem in der Geschichtsschreibung nach 1945, KlnBerlin 1971, S. 121, S. 134; vgl. Christoph Cornelien, Ger-hard Ritter. Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert, Dsseldorf 2001, S. 507 ff.39 Zit. nach: Nicolas Berg, Der Holocaust und die westdeutschen Historiker. Erforschung und Erinne-rung, Gttingen 2003, S. 179.
gegen all das stand, was das Dritte Reich pro-pagierte oder tat. 40 Diese scharfe Grenzzie-hung lie sich jedoch auf Dauer nicht halten. In den folgenden beiden Jahrzehnten wurde sie durch die historische Forschung zuneh-mend durchbrochen. Neben den Diskontinu-itten rckten nun auch die Kontinuitten ins Blickfeld. Daran hatte vor allem das 1961 er-schienene Werk des Hamburger Historikers Fritz Fischer ber die deutsche Kriegsziel-politik im Ersten Weltkrieg, Griff nach der Weltmacht, entscheidenden Anteil. Paral-lel dazu differenzierte sich auch das Bild Bis-marcks und der Bismarck-Zeit aus, traten die Schattenseiten seiner Herrschaft, vor allem in der Innenpolitik, schrfer hervor.
Die Revision des Bismarck-Bildes trug auch in Politik und ffentlichkeit allmh-lich Frchte. Hatte Bundeskanzler Ludwig Erhard Bismarck zum 150. Geburtstag am 1. April 1965 noch als Sinnbild des Stre-bens nach nationaler Einheit gefeiert, so er-klrte Bundesprsident Gustav Heinemann anlsslich des hundertsten Jahrestages der Kaiserproklamation von Versailles, dass 1871 nur eine uere Einheit ohne volle innere Freiheit der Brger erreicht worden sei. Der Reichsgrnder gehre folglich nicht in die schwarz-rot-goldene Ahnengalerie. 41 Ge-wissermaen die Quintessenz unter die jahr-zehntelange Debatte zog Lothar Gall 1980 mit seiner groen, bis heute mastabset-zenden Bismarck-Biografie. Ihm gelang das Kunststck, sich von einseitiger Glorifizie-rung und Verdammnis gleich weit entfernt zu halten und den weien Revolutionr be-merkenswert kritisch unter den Bedingungen seiner Zeit zu portrtieren. 42 Fnf Jahre sp-ter verffentlichte der Altmeister der DDR-Geschichtsschreibung, Ernst Engelberg, den ersten Band einer zeitgleich in Ost und West verffentlichten Biografie, in der er sich dem vordem als stockreaktionr verschrienen Jun-ker auf berraschend verstndnisvolle Weise annherte. 43 Als der zweite Band 1990 er-
40 Hans Rothfels, Bismarck und das 19. Jahrhun-dert, in: L. Gall (Anm. 38), S. 95; vgl. Jan Eckel, Hans Rothfels. Eine intellektuelle Biographie im 20. Jahr-hundert, Gttingen 2005, S. 230.41 Zit. nach: R. Gerwarth (Anm. 26), S. 184, 189.42 Lothar Gall, Bismarck. Der weie Revolutionr, Berlin 1980.43 Vgl. Ernst Engelberg, Bismarck, Bd. 1: Urpreu-e und Reichsgrnder, Berlin 1995; ders., Bismarck, Bd. 2: Das Reich in der Mitte Europas, Berlin 1990.
-
APuZ 13/201522
schien, war die DDR bereits untergegangen, hatten sich die beiden Teilstaaten, die aus der Trmmermasse des ersten deutschen Natio-nalstaates hervorgegangen waren, vereinigt.
Endlich Geschichte?
Hat Bismarck seitdem wieder eine neue, fast bedrngende Bedeutung gewonnen? 44 Kei-neswegs, denn die Unterschiede zwischen 1871 und 1990 sind nicht zu bersehen: Der zweite deutsche Nationalstaat ist nicht durch Blut und Eisen entstanden, sondern unter demokratischem Vorzeichen im Zuge ein-vernehmlicher Verhandlungen mit den Sie-germchten des Zweiten Weltkrieges. Er ist keine Schpfung von oben, sondern der Ansto ging von unten aus, von den












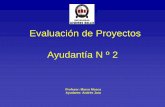


![Pdf pdf projet_educatif-2[1]](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5499da0bac7959092e8b5a10/pdf-pdf-projeteducatif-21.jpg)



