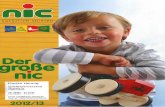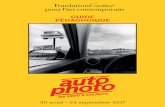1 l Art Pour l Art
-
Upload
mica-brljotina -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
description
Transcript of 1 l Art Pour l Art

Die eigentliche Abkehr vom Naturalismus vollzog sich im Symbolismus, der seine geistigen Grundlagen in Bergsons Philosophie hatte. Der philosophische Symbolismus sagte der mechanischen Weltbetrachtung ab und suchte wieder die spontanen, schöpferischen Kräfte. Die Geschichte des Menschen sei nicht nur ein ständiges Zerstören und Neuschaffen, sondern sei eine positive schöpferische Entwicklung.
Noch weiter entfernten sich der Ästhetizismus vom Realismus und Naturalismus. Beim Ästhetizismus handelte es sich um eine Lebenseinstellung, die das Schöne als höchsten Wert und als sich selbst genügend betrachtete. Die Kunst sei nur um des Kunstens Willen da.
Der Philosoph Victor Cousin ist der Urheber dieses Begriffs. Wie die Religion für die Religion, die Moral für die Moral, so auch die Kunst nur für die Kunst da sei. Aus dieser Ansicht entwickelte sich eine Kunsttheorie, nach der die Kunst nur Selbstzweck sei, abgelöst von allen ihr fremden Zielen.
Im 19. Jh. erreichte absolute Dichtung im französischen Symbolismus einen Höhepunkt. Die absolute Poesie hat ihre Wurzeln ebenfalls im französischen L'art pour l'art und im Symbolismus. Besonders Mallarmé repräsentiert in seiner Lyrik ein Dichtungskonzept, das von der Autonomie der poetischen Sprache ausgeht. Diese Sprache hat die Aufgabe, die arbiträre Konvention des Sprachgebrauchs aufzuheben und beim Leser völlig subjektive Wirkungen hervorzurufen. Die Dichtung selbst soll losgelöst von zweckgebundenen und didaktischen Intentionen sein (Poésie pure).
Die schon in der Romantik formulierte Auffassung vom Eigenwert der Kunst wird ausgebaut: Die Kunst hat nur ihre eigenen Gesetzen und ist nur ihnen verpflichtet, sie hat ihren Zweck in sich selbst. Der Wert eines Kunstwerks kann nur ästhetischbestimmt werden, alle fremden Elemente, gesellschaftliche, politische oder religiöse, sind dafür untauglich. Die Darstellung des nutzlosen Schönen ist das Ziel des Künstlers.
In den 30er des 18. Jh. formulierte am deutlichsten Théophile Gautier dieses Konzept, wenngleich er den Begriff sparsam verwendete. Alles Nützliche sei hässlich, schön könne nur sein, was zu nichts diene. Gautier war ein Bewunderer Hugos und trug aktiv zur Durchsetzung der romantischen Ästhetik bei. Gautiers Gedicht »Die Kunst« zeigt den Anspruch des Künstlers, in der vergänglichen Welt ewige Kunstwerke zu schaffen, um die Zeiten zu überdauern. Damit wandte sich Gautier vom Subjektivismus und der Romantik ab. Seine Gedichte zeugen von formaler Perfektion, plastischer Beschreibungskraft und Distanz des Künstlers. Gautier führte vor allem spanische und orientalische Motive in seine Lyrik ein, wirkte auf Baudelaire, die Symbolisten und die Lyriker des »Parnasse«. Gedichtsammlung Der zeitgenössische Parnass waren die bekannten Dichter der Zeit vertreten: Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Stéphane Mallarmé, Leconte de Lisle, Catulle Mendès, Léon Dierx... Es waren unterschiedliche Dichterpersönlichkeiten, die die Nähe zu Gautiers Ästhetik des L'art pour l'art verband. Ihr Engagement galt hauptsächlich der Kunst: der Suche nach dem Schönen in der von den Wissenschaften beherrschten Welt. Sie sahen den Dichter als Kunsthandwerker, der Werke hervorbringt, die ihn unsterblich machen. Die Nähe zur Bildhauerei wird deutlich, die plastisch und farbig beschriebenen Objekte in den Gedichten tendieren zur Versteinerung, die Poesie zur Statue. Die Sprache sollte gereinigt werden, bis jene göttliche Schönheit erreicht ist, die an den Skulpturen der griechischen Antike fasziniert. Diese unpolitische Haltung kann man »klassizistisch« oder »neoromantisch« nennen; die Gefahr einer verfälschenden Etikettierung ist bei den Dichtern des Parnasse jedenfalls groß. Angemessener ist die Würdigung der einzelnen Persönlichkeit.
![L art gothique[1]](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5478b4fab479599a098b456a/l-art-gothique1.jpg)