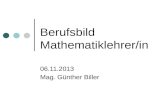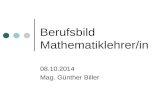03/05€¦ · dungskonzepte zum neuen Berufsbild des Chirurgie-Assistenten vorgestellt. Wie...
Transcript of 03/05€¦ · dungskonzepte zum neuen Berufsbild des Chirurgie-Assistenten vorgestellt. Wie...

03/05KUNDEN-MAGAZIN DER BBD AESCULAP GMBH UND DER AESCULAP AG & CO. KG - INFORMATION FÜR CHIRURGEN, OP-TEAM, VERWALTUNG & EINKAUF
ABSCHIED VOMMEDIZINISCHENFORTSCHRITT?Ablehnung innovativer Therapien durch den Ge-meinsamen Bundesausschuss

� n a h d r a nKunden-Magazin der BBD Aesculap GmbH und der Aesculap AG & Co. KG Information für Chirurgen, OP-Team, Verwaltung & Einkauf
� e r sche inungswe i se3 x p.a., Auflage 21.000 Exemplare, 18.000 Exemplare Direktversand
� herausgeberBBD Aesculap GmbH &Aesculap AG & Co. KGAm Aesculap-PlatzD-78532 Tuttlingenwww.bbraun.de
� r edakt ionBarbara Wiehn (Chefredaktion), BBD Aesculap GmbHAnja Jasper, BusinessWerbung GmbHWeißenburgstr. 10, 34117 KasselTel.: 00 49 (0)5 61-9 58 98-11Fax: 00 49 (0)5 61-9 58 98-58E-Mail: [email protected]
� fo togra f i e(soweit nicht ausgezeichnet)Archiv, Photodesign Gocke, BötzingenPorträtfotos (privat):Abdruck mit freundlicherGenehmigung der Autoren
� l ayoutBusinessWerbung, Kassel
� produkt ionStrube OHG, Felsberg
� se rv i ceBBD Aesculap GmbHRedaktion nahdranPostfach 31D-78501 TuttlingenTelefax: (08 00) 222 37 82aus Deutschland kostenfreiaus dem Ausland:0049 - 74 61 - 9115-692E-Mail: [email protected]
� l e se rb r i e fe & anze igenAnja Jasper, s. Redaktion
� h inwe i sDie in dieser Ausgabe veröffentlichtenBeiträge sind urheberrechtlich ge-schützt und liegen jeweils in der Ver-antwortung des betreffenden Autors.Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teildieser Ausgabe darf ohne schriftlicheGenehmigung des Herausgebers inirgendeiner Form reproduziert werden.Nachdruck – auch auszugsweise – nurmit Genehmigung des Herausgebersgestattet. Alle Angaben erfolgen nachbestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.Eine Haftung wird nicht übernommen.
i m p r e s s u m
2 nahdran 03/05
TOPTHEMEN
21 Medizinischer Fortschritt brauchtInnovationen – keine BürokratieDie neue Verfahrensordnung des GBA Ein Interview mit Dr. Nicole Schlottmann
Sind wir auf dem besten Wege, uns vom medizinischen Fortschritt in Deutsch-land zu verabschieden? Vielleicht eine etwas pessimistische Prognose, aber seitim Oktober 2005 die neue Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesaus-schusses (GBA) in Kraft getreten ist, gewinnen die Diskussionen zum ThemaInnovationsförderung merkbar an Schärfe. Wir klären in unserem Beitrag, wassich eigentlich genau hinter der Arbeit des GBA verbirgt und wollten wissen,welche Konsequenzen die neue Regelung für den Einsatz innovativer Therapienvor allem in den Krankenhäusern haben wird.
10 Wer schneidet, der haftet!Haftungsrechtliche Aspekte der Chirurgie-AssistenzEin Beitrag von Rechtsanwalt Tim Müller
In der vergangenen Ausgabe der nahdran haben wir aktuelle Aus- und Weiterbil-dungskonzepte zum neuen Berufsbild des Chirurgie-Assistenten vorgestellt. Wieangekündigt, greifen wir das Thema in dieser Ausgabe noch einmal auf. Dennvon besonderer Brisanz sind die haftungsrechtlichen Aspekte, die unser AutorTim Müller in seinem Beitrag ausführlich erläutert. Nur soviel vorab: alle Betei-ligten sind vor dem Vertragsabschluss gut beraten, sich eingehend mit der Haf-tung zu befassen und Vereinbarungen in jedem Fall schriftlich zu fixieren.
INHALT

nahdran 03/05 3
CHIRURGIE IMFOKUS
18 BBD „On Tour“Regionale Naht-Workshops: un-verzichtbar für die chirurgischeAus- und Weiterbildung
Die Redaktion im Gespräch mitProf. Dr. med. Axel Richter
30 Minimal invasive ChirurgieAktuelle Trends in der Kinder-chirurgie
Ein Beitrag von Prof. Dr. med. Felix Schier
33 Rekonstruktive HNO-ChirurgieLappenplastiken mit dem Challenger Ti®
Ein Anwenderbericht von Dr. med. Emil Zenev
MEDIZINAKTUELL
6 Über den Dächern vonBerlinNeuer Standort der AesculapAkademie im Langenbeck-Virchow-Haus
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. MichaelUngethüm und Felicitas Janßen
14 Qualitätsberichte – Dergroße Wurf?Ein Beitrag von Bernd Krämer
26 ConceptHospital – Schöne neue KlinikweltVisionen zum Krankenhaus derZukunft
Ein Interview mit Dr. med. Dirk Richter, Pascal Scher und Dr. med. Markus Müschenich
36 PalliativchirurgieWie viel Würde wollen wir unsleisten?
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Peter Polterauer
RUBRIKEN
2 Impressum
4 Aesculap Akademie
5 Editorial
9 Kurz notiert
39 Termine
40 Leserforum

i
i
i
i
Kontakt
Tanja BauerTel. 07461-95 [email protected]
Kerstin Berger Aesculap Akademie GmbHLangenbeck-Virchow-HausLuisenstraße 58-59, 10117 Berlin Tel. 030-516512-0 [email protected]
Heike RudolphTel. 07461-95 [email protected]
Manuela SauterTel. 07461-95 [email protected]
Christoph StorzTel. 07461-95 [email protected]
Alle Ansprechpartner sind über Fax unter 07461-95 2050 zu erreichen.
www.aesculap-akademie.de
Mit Kompetenz die Zukunft erobern
Unsere Veranstaltungen tragen das Qualitätssiegel von Fachverbänden undinternational anerkannten Institutionen.Fordern Sie noch heute unsere aktuellenProgramme an.
4 nahdran 03/05
Mediziner
16. - 20.01.06 Endoscope-assisted Keyhole Microneuro-Surgery T. Bauer
06. - 09.02.06 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie Chr. Storz
10. - 11.02.06 Arthroskopie-Basiskurs Kniegelenk M. Sauter
20. - 23.02.06 Basiskurs Laparoskopische Urologie Chr. Storz
01. - 03.03.06 Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie Chr. Storz
17. - 18.03.06 Basiskurs: Hüftendoprothetik für Ärzte M. Sauter
25.03.06 Arthroskopie Basiskurs Schultergelenk M. Sauter
31.03. - 01.04.06 Arthroskopie-Knorpelworkshop M. Sauter
03. - 07.04.06 Endoscope-assisted Keyhole Microneurosurgery T. Bauer
24. - 26.04.06 Aufbaukurs Laparoskopische colo-rectale Chirurgie Chr. Storz
27. - 28.04.06 Basiskurs: Verriegelungsnagelung für Ärzte M. Sauter
Pflege/OP/ZSVA
26. - 27.01.06 Grundlagen Osteosynthese für OP-Personal M. Sauter
30.01. - 11.02.06 Fachkundelehrgang I T. Bauer
01. - 03.02.06 Technik bei laparoskopischen Operationen M. Sauter
02. - 03.03.06 Knieendoprothetik für OP-Personal M. Sauter
06. - 17.03.06 Fachkundelehrgang II T. Bauer
22.03.06 Modernes Hygienemanagement T. Bauer
27.03. - 07.04.06 Fachkundelehrgang III, Teil I T. Bauer
30. - 31.03.06 Hüftendoprothesen-Seminar für OP-Personal in Celle M. Sauter
Einkauf
20. - 21.03.06 Basiswissen Einkauf und Materialwirtschaft im KHS T. Bauer
15.05.06 Strategischer und operativer Einkauf T. Bauer
19. - 20.06.06 5. Forum Beschaffungsmanagement für Krankenhäuser T. Bauer
Interdisziplinär
26. - 27.01.06 Durch Personalentwicklung zur besseren Personalorientierung T. Bauer
05.05.06 Interkulturelle Kommunikation für Führungskräfte T. Bauer
11. - 12.05.06 Situativ-kommunikative Personalführung T. Bauer
26. - 27.06.06 Personalführung und Motivation T. Bauer

nahdran 03/05 5
Barbara Wiehn, Group-Marketing-Manager Nahtmaterial
e d i t o r i a l
Es ist schon paradox: medizini-scher Fortschritt und Innovatio-nen werden als zentrale Trieb-kräfte für die Entwicklung un-seres Gesundheitssystems ei-nerseits fraglos anerkannt. Aufder anderen Seite beherrschenBürokratismus und Diskussio-nen um die Finanzierbarkeit desFortschritts das Bild. Die vorder-gründigen „Argumente“ gegendas Neue dürften hinlänglichbekannt sein. Äußerungen wie„Damit haben wir doch garkeine Erfahrung“ über „Wer solldas bezahlen“ bis hin zu „Dafürfehlt uns das Personal“ bremsenselbst viel versprechende Neu-ansätze immer wieder aus. Da-bei steigt der Druck zur Verän-derung kontinuierlich an – nichtzuletzt aufgrund der wachsen-den globalen Konkurrenz. Um sowichtiger sollte es für uns allesein, die Chancen, die das Neueeröffnet, nicht nur zu begrüßen,sondern als Fortschrittsmotor inbestehende Strukturen zu inte-grieren.
Möglichkeiten gibt es genug.Man kann z.B. konsequent invisionären Zukunftsstrategiendenken, wie unsere Autoren von„ConceptHospital“. Ihre Thesenzur Klinik der Zukunft provo-
zieren, sorgen aber zugleich fürdurchaus anregende Diskussio-nen – und schärfen so den Blickfür potenzielle Gestaltungs-lösungen in der medizinischenLandschaft. Oder man wehrtsich mit Erfolg gegen allzu vielBürokratie. So wie Dr. NicoleSchlottmann als Vertreterin derDeutschen Krankenhausgesell-schaft, die im Interview Interes-santes über die Zusammen-hänge zwischen gesetzlich ver-ankerten Reglementierungsver-suchen und den Folgen für denmedizinischen Fortschritt inDeutschland zu erzählen hat.Dass das Neue fast immer Hür-den zu überwinden hat, zeigtauch die aktuelle Ausbildungzum Chirurgisch-TechnischenAssistenten. Alle Beteiligtenwerden hier, laut Einschätzungunseres Autors Tim Müller, ineinem hohe Maße haftungs-rechtliche Besonderheiten be-rücksichtigen müssen, wennsich die noch jungen Konzepteerfolgreich etablieren sollen.
Wie also kommt das Neue indie Medizin? Es ist die ausge-wogene Mischung aus Realis-mus und Risikofreudigkeit, ausNeugier und Kompetenz, dieein konstruktives Klima für
Wie kommt das Neue in die Medizin?
Innovationen und medizini-schen Fortschritt schafft. Inno-vationsförderung muss ge-meinsame Aufgabe von Kassen,Ärzten und Unternehmen sein.Hierzu gehören flexible Finan-zierungsmodelle, Kooperatio-nen zwischen Forschung, In-dustrie und Anwendern, mehrPatientenverantwortung undein politischer Background, derdem medizinischen Fortschrittdie Bedeutung einräumt, die erverdient. Denn nur im Zusam-menwirken verschiedener Kräf-te werden wir die notwendigenWandlungs- und Innovations-prozesse in angemessener Wei-se dauerhaft fördern können.Wäre das nicht ein exzellenterVorsatz für das Neue Jahr?
Ich danke wie immer den Auto-ren dieser Ausgabe für ihrespannenden Beiträge und wün-sche Ihnen allen geruhsameFeiertage, einen erfolgreichenStart ins Jahr 2006 – und na-türlich gute Unterhaltung mitder neuen nahdran!
Ihre Barbara Wiehn

6 nahdran 03/05
Es ist ein erfreuliches Kapitel in derbewegten Geschichte des Langen-beck-Virchow-Hauses in Berlin: im
Oktober wurde das ehrwürdige, 1913erbaute Gebäude nach aufwändigen Re-novierungsarbeiten feierlich wiedereröff-net. Das von der Berliner MedizinischenGesellschaft und der Deutschen Gesell-schaft für Chirurgie während des ErstenWeltkrieges gemeinsam errichtete Hausist ein einzigartiges medizin-historischesBauwerk. Mittelpunkt – damals wie heute– ist der historische Vortragssaal, an des-sen Decken sich Fresken mit Szenen ausder griechischen Mythologie befinden.Das Langenbeck-Virchow-Haus überstandden Zweiten Weltkrieg als eines der weni-gen Gebäude in Berlin nahezu unbeschä-digt. Und dann nahm die Geschichte ihrenLauf – russische Militärbehörden besetz-ten das Haus, später wurde es Sitz derVolkskammer der DDR, bis es die Aka-demie der Künste als Veranstaltungs-zentrum nutzte.
Nach einem langen Rechtsstreit musstedie Stadt Berlin das in den fünfziger Jahrenenteignete Haus im Jahr 2002 den altenEigentümern rückübereignen. Der histori-sche Vortragssaal des Langenbeck-Virchow-Hauses wurde in seinen ursprünglichen Zu-stand zurückversetzt und das Gebäude ne-ben umfangreichen Restaurierungsarbeitenum ein Stockwerk erweitert. Wirtschaft-liche Unterstützung kam von der B. BraunAesculap AG, die die Finanzierung des Um-baus sichergestellt hat. Das Konzept gehtauf: Die Räumlichkeiten sind an medizini-sche Fachgesellschaften und Berufsver-bände vermietet, der wunderschöne histo-rische Hörsaal ist (wieder) eine begehrteVersammlungsstätte. Und im vierten undfünften Obergeschoss erwartet den Besu-cher der zweite Standort der AesculapAkademie in Deutschland – pünktlich zumzehnjährigen Jubiläum: mit modernen Se-minar- und Workshopräumen über denDächern von Berlin. Wir haben mit Prof.Michael Ungethüm und Felicitas Janßenüber Hintergründe und Perspektiven desambitionierten Projekts gesprochen.
Herr Prof. Ungethüm, das Pro-jekt „Langenbeck-Virchow-Haus“ liegt Ihnen sehr am Her-zen; schließlich hat B. BraunAesculap maßgeblich zurWiederherstellung beigetra-gen. Was war der Anlass fürIhr Engagement?
Wir sind uns alle einig, dass eseine große Unterlassung gewe-sen wäre, das Langenbeck-Vir-chow-Haus nicht seiner ur-sprünglichen Bestimmung desmedizinischen Wissensaus-tauschs zurückzuführen. Undgenau deshalb haben wir –B. Braun Aesculap – die Wieder-herstellung des Langenbeck-Virchow-Hauses unterstützt undvorangetrieben. Bereits vormehr als zehn Jahren haben wirin Tuttlingen das Aesculapiumeröffnet, als Forum für die Kom-munikation in der Welt der Me-dizin. Schon damals haben wirZeichen gesetzt und Weichengestellt – und unser Weg führteuns dann ganz natürlich nachBerlin, mit seiner großen (ge-
Über den
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Michael Ungethüm, B. Braun Melsungen AG, und Felicitas Janßen, Aesculap Akademie GmbH

nahdran 03/05 7
sundheits-)politischen Strahl-kraft und Bedeutung, auch inund für die neuen EU-Mitglieds-staaten und Länder der früherenSowjetunion. In Osteuropa be-steht ein enormer Nachholbe-darf in der Gesundheitsversor-gung – angefangen bei den me-dizin-technischen Produktenund Prozessen bis hin zur abso-luten Notwendigkeit der Anglei-chung an westliche Standards.Hierzu wollen wir mit der Be-stimmung des Langenbeck-Vir-chow-Hauses einen wesentli-chen Beitrag leisten.
Das Langenbeck-Virchow-Haus beherbergt Fachgesell-schaften vieler chirurgischerDisziplinen unter einem Dach.Eröffnet das neue Formen derZusammenarbeit?
Selbstverständlich. Die rund 20medizinischen Gesellschaften,die unter dem Dach des Langen-beck-Virchow-Hauses vereintsind, repräsentieren immerhinfast 76.000 Ärzte und Mitglieder
– eine beeindruckende Zahl, diezugleich das ungeheure Poten-zial für den zukunftsweisendenWissensaustausch darstellt. Undda mir – als Mensch und Wis-senschaftler – der medizinischeFortschritt sehr am Herzen liegt,engagieren wir uns für einpartnerschaftliches Miteinanderzwischen Industrie, Wissen-schaft, Lehre und Politik. DieseHaltung findet ihren Ausdruckin unserem heute weltweit um-gesetzten Aesculap Akademie-Konzept einerseits und denzahlreichen Innovations-Koope-rationen andererseits. Das warund ist nur durch die erstklassi-ge Zusammenarbeit mit denFachgesellschaften und medizi-nischen Institutionen möglich,die im Langenbeck-Virchow-Haus ihren Hauptstadtsitzhaben.
Im Erdgeschoss erwartet denBesucher das so genannte „Ex-pertisium“, ein Ausstellungs-raum der B. Braun Melsungen AG, der – könnte man �
Wiedereröffnung des
Langenbeck-Virchow-Hauses
in Berlin und weiterer Standort
der Aesculap Akademie
in Deutschland
Dächern von Berlin
Feierliche Schlüsselübergabe:
(von links nach rechts: Frieder Nething, Nething Generalplaner;
Prof. Ungethüm, B. Braun Aesculap AG; Prof. Saeger, Präsident der
DGCH; Prof. Hartel und Prof. Hahn, gemeinsame Geschäftsführer
der Langenbeck-Virchow-Haus GbR und Herr Pabst, Architekt von
Nething Generalplaner)
Opulente Räumlichkeiten:
der originalgetreu wiederhergestellte Vortragssaal
Medizinische Produktinnovationen im Zeitraffer:
das Expertisium im Erdgeschoss
Alte Pracht in neuem Glanz:
das historische Treppenhaus

8 nahdran 03/05
sagen – einen gewissen Sym-bolcharakter hat. Was könnenwir uns darunter vorstellen?
Wir – und hier spreche ich alsstellvertretender Vorstandsvor-sitzender der B. Braun Melsun-gen AG – möchten den Besu-chern des Langenbeck-Virchow-Hauses in unserem interaktivenAusstellungsraum, dem Experti-sium, Eindrücke vermitteln zuden Leistungen von B. Braunentlang der Medizingeschichte.Von den Pionierleistungen, überInnovationen von heute bis hinzu Innovationen von morgenund künftigen Entwicklungen.Ganz im Sinne des Wissensaus-tauschs, den wir als zentralenBeitrag für den Fortschritt in derMedizin verstehen.
Wie wird sich nach IhrerEinschätzung die deutscheMedizinlandschaft künftigverändern?
Ich denke, das autarke so ge-nannte „Allround-Krankenhaus“z.B. wird langsam aus der Land-schaft verschwinden. Durch denimmer größer werdenden Kos-tendruck wird der Wettbewerbunter den Krankenhäusern zu-nehmen. Druck durch Mindest-mengen, die Forderung nachmehr Effizienz – im übrigen zumWohle der Patienten – unter-stützen die Spezialisierung undBildung der Leistungszentren,und das hat eine Umverteilungdes medizinischen Bedarfs zurFolge. So wird es Spezialbe-handlungen mittelfristig nurnoch in ausgewählten „Centersof Excellence“ geben. Darauf
müssen wir uns alle einstellen –die Industrie ebenso wie dieLeistungserbringer. Mit demLangenbeck-Virchow-Haus be-finden wir uns übrigens in un-mittelbarer Nachbarschaft zuEuropas größter Klinik – derCharité, mit 15.000 Mitarbei-tern und der beeindruckendenLeistungsbilanz von 125.000stationären und 900.000 am-bulanten Patienten pro Jahr.
Über Innovationen in der Me-dizin und speziell der Chirurgiewird zurzeit ausgiebig disku-tiert. Immer wieder wird derStellenwert von medizinisch-technischen und methodi-schen Neuerungen vor allemunter Kostenaspekten be-leuchtet. Wie beurteilen Siediese Diskussion?
Auch für die Hersteller vonMedizinprodukten gilt: nur weroperativ und strategisch rich-tig aufgestellt ist und Verän-derungsprozesse durch syste-matisches Innovationsmana-gement begleitet, wird auch inder Zukunft in der ersten Reihestehen. Wir müssen Produkteanbieten, die effizient im Sinneder Kosten-Nutzen-Relationsind. Das heißt konkret: kürzereVerweildauern im Kranken-haus, geringere Zeit im OP undweniger Personalaufwand. Ech-te Innovationen entstehennach meiner Überzeugung nurdurch die intensive und part-nerschaftliche Kommunikationzwischen Forschung, Technikund Produktion sowie industri-eller Wertschöpfung und Mar-keting einerseits und der Kom-
Felicitas Janßen ist seit 2002 Ge-schäftsführerin der Aesculap Akade-mie GmbH in Tuttlingen und Berlin.Sie ist verantwortlich für die quali-tätsgeprüfte Fort- und Weiterbildungvon medizinischem Fachpersonal – inDeutschland und an den Standortender Aesculap Akademie weltweit. Zuvor war sie bei der Unternehmens-beratung A. T. Kearney tätig; u.a. alsLeiterin der Abteilung ProfessionalDevelopment Europa.
Weitere Informationen:
www.ungethuem-aesculap-stiftung.dewww.aesculap-akademie.dewww.bbraun.dewww.langenbeck-virchow-haus.de
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Michael Ungethümist stellvertretender Vorstandsvorsitzen-der der B. Braun Melsungen AG und Vor-sitzender der Geschäftsleitung der Aes-culap AG & Co. KG. Der Ehrensenator derAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg undVorsitzende zahlreicher Institutionen inder Medizin rief im August 2003 dieUngethüm-Aesculap Stiftung ins Leben.Zielsetzung der gemeinnützigen Stif-tung ist insbesondere die Gewährungvon Stipendien für Hospitationen jungerchinesischer Chirurgen an der FreiburgerUniversitätsklinik. Die Stipendiaten sol-len sich mit deutschen Operationsver-fahren vertraut machen und nach ihrerRückkehr in chinesische KrankenhäuserMultiplikatorenfunktionen zur Verbrei-tung dieser Verfahren übernehmen.
Langenbeck - Virchow - Haus

nahdran 03/05 9
munikation mit den klinischenForschungsabteilungen sowieden Anwendern unserer Pro-dukte andererseits. Denn nurso wissen wir, wo der Bedarfnach Neuerungen am stärkstenist und können Produkte undLeistungen anbieten, die tat-sächlich zu messbar besserenErgebnissen in der Patienten-versorgung führen – in ökono-mischer und qualitativer Hin-sicht.
Frau Janßen, im Obergeschossdes Langenbeck-Virchow-Hauses befindet sich der neueStandort der Aesculap Akade-mie. Welche Bilanz ziehen Siezum zehnjährigen Jubiläum?
Wir blicken auf eine beeindru-ckende Entwicklung in der me-dizinischen Fort- und Weiterbil-dung zurück. Gemeinsam mitden Meinungsbildnern inDeutschland und mittlerweileauch der Welt gelingt es uns, imJahr ca. 40.000 Personen welt-weit über unser Seminar- undKursangebot in qualitätsgeprüf-ten Fort- und Weiterbildungenmit medizinischem Wissen zuversorgen. Nach den landesübli-chen Bestimmungen im Sinneder Continuing Medical Educa-tion, also gemäß den Kriterienim Rahmen der medizinischenFortbildungspflicht. Die Aescu-lap Akademie agiert hier alsPlattform für den vernetztenWissensaustausch durch un-ser dichtes Expertennetzwerkin aller Welt.
Gab es ungewöhnliche/inte-ressante Ereignisse in dieser
Zeit, an die Sie sich besondersgerne erinnern?
Natürlich. Ein wichtiger Meilen-stein in der Entwicklung derAesculap Akademie war ganz si-cher der Tag der offenen Tür, andem 13.000 (!) Menschen unserGebäude besichtigten. Oder alssich im Jahre 1998 zum erstenMal das „Who is Who“ der Ge-sundheitspolitik im Aesculapiumin Tuttlingen, dem Stammsitzder Aesculap Akademie, traf. Sowie unsere ersten internationa-len Neurochirurgie-Kurse undunser 1. ausländischer Satellit,die Aesculap Academia in Shef-field – das waren schon sehr be-sondere Momente.
Nach zehn Jahren schaut mannicht nur zurück. Was planenSie für die Zukunft?
Wir wollen den Dialog in dermedizinischen Fort- und Wei-terbildung richtungsweisendmit vorantreiben. Ganz beson-ders denke ich hier an denenormen Wissensbedarf unse-rer osteuropäischen Nachbarn,die wir aktiv mit unserer zehn-jährigen Erfahrung unterstüt-zen wollen. Ich denke, dieEröffnung der Räumlichkeitenim Langenbeck-Virchow-Haussetzt hier ein wichtiges Zei-chen – als Zentrum für denDialog in der Medizin inDeutschland mit großer Aus-strahlung vor allem auch nachOsteuropa.
Herr Prof. Ungethüm, FrauJanßen, wir danken Ihnen für das Gespräch! �
Richard von Volkmann – Künstler & Chirurg
Seine Märchen „Träumereien an französischen Kaminen“Sein Leben und ärztliches Wirken
Herausgegeben von Christian Willy, 204 Seiten, Halbleinen gebunden, mit 13 zum größten Teil farbigen AbbildungenInkl. 2 Audio-CDs mit 74 und 71 Minuten SpielzeitISBN: 3-00-014694-6Grafik-Design: Lindqvist, Blaustein (Fax: 07304-437-844)39,95 Euro
Er schrieb ein Stück Medizingeschichte: Richard v. Volkmann (1830-1889), Chirurg und Wissenschaftler, Mitbegründer der DeutschenGesellschaft für Chirurgie und ein Arzt von internationalem Ansehen.Im Buch wird nun eine für viele wohl sehr unbekannte Seite des Chirur-gen dargestellt: unter dem Pseudonym Richard Leander veröffentlichteder berühmte Chirurg auch Märchen, seine „Träumereien an französi-schen Kaminen“.
Das Hauptanliegen dieses Buches ist es, erstmals die Märchen imKontext der chirurgischen Leistungen und der wichtigsten Le-bensstationen dieses Künstlerchirurgen darzustellen. Hoch interes-sant aus heutiger Sicht ist z.B. die Darstellung seiner Gedanken zuden Fortschritten der (damaligen) modernen Chirurgie.
Die gelungene Kombination aus Märchenbuch und biographischerDarstellung macht diese Publikation einzigartig. Zu empfehlen fürMärchenliebhaber, Chirurgen und solche, die es werden wollen.
k u r z n o t i e r t

10 nahdran 03/05
Stellen Sie sich vor, Sie sind Patient. Sie werden ope-riert, nur eine Routinesache. Aber während der OPunterläuft dem Operateur ein entscheidender Fehler,der einen erneuten Eingriff erforderlich macht undIhre Gesundheit nachhaltig beeinträchtigt. Und dannerfahren Sie, dass der Fehler gar nicht dem Arzt pas-siert ist, mit dem Sie vorher alles besprochen haben,sondern dem „Chirurgie-Assistenten“. Der hat zwarunter Aufsicht „Ihres“ Arztes gestanden, aber der Feh-ler ist nun einmal ihm selbst unterlaufen. Wer haftet?Der Assistent, der Chirurg, die Klinik?
Ärztliche Assistenz und Haftungsrecht – ein immer wie-der kontrovers diskutiertes Thema. Auch beim neuenBerufsbild des Chirurgie-Assistenten sind die haftungs-rechtlichen Bedingungen lange nicht so eindeutig, wiees auf den ersten Blick scheinen mag. Zur Erinnerung: Inder letzten nahdran (Ausg. 02/05, Dossier „GenerationArztassistent“, S. 21. ff.) haben wir die aktuellen Aus-und Weiterbildungskonzepte zur chirurgischen Assis-tenz vorgestellt (eine Zusammenfassung finden Sie amEnde dieses Beitrags auf Seite 13).
Welche haftungsrechtlichen Probleme ergeben sich nunaus dieser neuen Tätigkeit? Und wie lassen sich Rechts-streitigkeiten von vornherein vermeiden? Antwortengibt im folgenden Beitrag unser Autor Tim Müller, dersich eingehend mit den Haftungsfragen zum neuenBerufsbild beschäftigt hat.
Die Delegation von ärztlichen Tätigkeiten auf nicht-ärztliches Personal bedarf wegen des Grundsatzes derpersönlichen Leistungserbringung von jeher einer sorg-
fältigen Prüfung der Haftungssituation. Sollen im Rahmen derKrankenhausorganisation generell Aufgaben, die nach über-kommenem Verständnis alleine dem Arzt obliegen, an dasPflegepersonal delegiert werden, ist dies umso mehr der Fall.Die Einführung eines Chirurgisch-Technischen Assistenten(CTA) bzw. Physician Assistant (PA) an der Schnittstelle zwischen Pflege und Operation wirft denn auch vielfältige Fra-gen auf.
Die Grenze zwischen Pflegetätigkeit und rein ärztlichen Aufga-ben war schon immer fließend. Die alte Faustregel, nach wel-cher alles, was juristisch als Körperverletzung zu werten ist,allein dem Arzt obliegt, kann nur noch grobe Anhaltspunkte lie-fern, da z.B. Injektionen unbestritten durch entsprechend qua-lifiziertes Pflegepersonal durchgeführt werden dürfen. Gleich-wohl steht der Satz, dass Verrichtungen, die wegen ihrerSchwierigkeit, ihrer Gefährlichkeit oder wegen der Unvor-hersehbarkeit etwaiger Reaktionen ärztliches Fachwissen vor-aussetzen, vom Arzt persönlich durchzuführen sind, als Leitlinieam Anfang jeder Entscheidung über die Delegation.
Der Chirurgie-Assistent …
… ist eine nicht-ärztliche Pflegeperson, die eigen-ständig hoch spezialisierte Assistenz-Aufgaben immedizinischen und operationstechnischen Bereichunter Aufsicht eines Arztes durchführt. Zu diesenAufgaben gehört u.a. der Zugang zum Operations-gebiet, die chirurgische Assistenz während desEingriffs, der Wundverschluss und die Qualitäts-kontrolle chirurgischer Maßnahmen. Der Chirurgie-Assistent ist in seiner Tätigkeit am ehesten mitdem Asisstenzarzt vergleichbar und ersetzt diesenwährend des Eingriffs in direkter Unterstützungdes Operateurs.
Wer schneidet, der haftetHaftungsrechtliche Aspekte der Chirurgie-Assistenz
Ein Beitrag von Rechtsanwalt Tim Müller, Kanzlei Reichert & Partner, München

nahdran 03/05 11
Verlagerung von genuin ärzt-lichen Aufgaben auf denPflegebereich
Bei der chirurgischen Assistenzdurch CTA/PA sollen nun auchOP-Zugang, Präparation undWundverschluss durch Nicht-ärzte erfolgen. Dies sind Tätig-keiten, die bislang dem Opera-teur, dem Assistenzarzt oder –im Rahmen der Ausbildung undunter Aufsicht – dem Medizin-studenten oblagen.
Obwohl eine scharfe Abgren-zung zwischen (zwingend)ärztlicher und pflegerischerOP-Tätigkeit nicht möglichist, wird man davon ausgehenmüssen, dass mit der Einbin-dung des CTA/PA in den Ope-rationsablauf eine Verlage-rung von genuin ärztlichenAufgaben in den Pflegebe-reich stattfindet. Die Recht-sprechung hierzu ist sehr re-striktiv und nimmt z.B. bei derÜbertragung einer Operation
auf einen noch nicht ausrei-chend qualifizierten Assis-tenzarzt einen Behandlungs-fehler an.
Erhöhtes Haftungsrisiko fürden Krankenhausträger
Daraus ergibt sich zunächstein erhöhtes Haftungsrisikovor allem für den Kranken-hausträger: er ist im Rahmenseiner Organisationsgewalt ver-antwortlich für die Auswahl,den Einsatz und die Überwa-chung der Personen, derer ersich zur Erfüllung des Be-handlungsvertrags bedient undhaftet vertraglich auch fürden „Delegationsfehler“ desOberarztes.
Maßgeblich für die Qualifi-kation, die bei jedem Eingriffgewährleistet sein muss, istder Standard des erfahrenenFacharztes. Die Krankenhaus-leitung ist deswegen gut bera-ten, sich über die tatsächlichen
Fähigkeiten eines einzustellen-den Chirurgie-Assistenten einmöglichst genaues Bild zumachen. Sinnvoll ist es, einelängere Probephase einzupla-nen, in welcher der Assistentnur unter Anleitung und Über-wachung eines erfahrenenOperateurs tätig wird. Hierbeisollten sämtliche ärztlichenTätigkeiten, die künftig demCTA/PA übertragen werdensollen, auf den Prüfstein ge-stellt und bewertet werden.
Soweit hier Lücken bei Fähig-keiten oder Kenntnissen zuTage treten, sollten diese ggf.durch hausinterne Fort-/Wei-terbildung geschlossen und diehierzu getroffenen Maßnah-men dokumentiert werden.
Entwarnung für den Ope-rateur: er haftet nur in Aus-nahmenfällen für den CTA/PA
Eine Haftung des Operateursfür Fehler des CTA/PA wirddagegen im Normalfall nichtbestehen. Beim Regelfall des„totalen Krankenhausaufnah-mevertrags“ ist ausschließlichder Krankenhausträger für Aus-wahl, Anleitung und Überwa-chung seiner „Verrichtungs-gehilfen“ verantwortlich und
muss entsprechend für derenFehler gerade stehen. Nurwenn der Operateur selbst li-quidiert oder als Belegarzthandelt und gleichzeitig denCTA/PA selbst stellt, haftet er auch für dessen Fehler. �
„Mit der Einbindung des CTA/PA in den
Operationsablauf wird eine Verlagerung
von genuin ärztlichen Aufgaben auf den
Pflegebereich stattfinden.“

12 nahdran 03/05
Wenn der Operateur allerdingseinen CTA/PA einsetzt, obwohler weiß, dass dieser für die ge-forderte Tätigkeit nicht ausrei-chend qualifiziert ist, kann ihmdies wiederum als eigenes Ver-schulden angerechnet werden,für das er persönlich haftet.
Vorsicht bei Vertragsabschlüs-sen: der CTA/PA kann füreigenes Verschulden selbstund unmittelbar haftbar ge-macht werden
Der Chirurgisch-Technische As-sistent haftet für eigenes Ver-schulden bei seiner Tätigkeitselbst und unmittelbar. Zwardürfte in vielen Fällen einePflicht des Krankenhausträ-gers als Geschäftsherren be-stehen, den CTA/PA von dieserHaftung freizustellen, eineBerufshaftpflichtversicherungwird gleichwohl unabdingbarsein. Hier sollte ein CTA/PA inVorbereitung seiner neuen Tä-tigkeit im eigenen Interesse
abklären, ob sein Arbeitgeberfür ihn eine entsprechende Ver-sicherung unterhält oder ab-zuschließen bereit ist.
Schon bei der Vertragsgestal-tung sollten die Parteien ihrAugenmerk auf die angespro-chenen Haftungsprobleme rich-ten und einen abschließendenKatalog ärztlicher Tätigkeiten,die der CTA/PA durchführendarf, als Anlage in den Vertragmit aufnehmen. Dieser Kata-log hat sich strikt an denbereits vorhandenen Fähig-keiten des Assistenten zu ori-entieren und muss in allenSituationen die Obergrenzeder OP-Tätigkeit des CTA/PAdarstellen. Tätigkeiten, für diekeine oder eine unzureichen-de Qualifikation vorliegt, darfder Chirurgie-Assistent – au-ßer im Notfall – nicht aus-führen. Ein solcher Katalogkann und sollte auch als Zu-satz zum Arbeitsvertrag ver-einbart werden, wenn ein be-
reits im Krankenhaus beschäf-tigter Fachkrankenpfleger nachentsprechender Weiterbildungseine neuen Aufgaben wahr-nehmen soll.
Aufklärung: der Patient mussmit dem CTA/PA-Einsatz ein-verstanden sein
Strafrechtlich gilt: „Werschneidet, der haftet“! Nachder zu Recht heftig umstritte-nen Rechtsprechung schondes Reichsgerichts und später
des Bundesgerichtshofs istder ärztliche Heileingriff nachwie vor als Körperverletzungzu werten, der lediglich we-gen der Einwilligung des Pa-tienten gerechtfertigt und da-
mit straflos ist. Die Einwilli-gung umfasst bei der Behand-lung im Krankenhaus in derRegel alle Ärzte, die aufgrundinterner Arbeitsteilung für diefragliche Maßnahme zustän-dig sind sowie die funktions-entsprechenden Maßnahmendes zugezogenen Hilfsperso-nals.
Eine wirksame Einwilligungsetzt aber voraus, dass derPatient weiß, worin er einwil-ligt. Dies wiederum ist nur
nach entsprechender Aufklä-rung denkbar und möglich. Daderzeit der Einbezug von CTA/PA in Operationen in Deutsch-land noch ungebräuchlich ist,wird ein Patient bei Aufnahme
„ Tätigkeiten, für die keine oder eine un-
zureichende Qualifikation vorliegt, darf der
Chirurgie-Assistent – außer im Notfall –
nicht ausführen.“

nahdran 03/05 13
in ein Krankenhaus nichtdamit rechnen, dass eine die Integrität seines Körpersverletzende Maßnahme jen-seits einer einfachen Injektionvon nichtärztlichem Personaldurchgeführt wird. Seine Ein-willigung wird also den Ein-satz eines Chirurgie-Assisten-ten in aller Regel nicht um-fassen, wenn er nicht vorherentsprechend aufgeklärt wor-den ist.
Um das Risiko möglicher Straf-verfahren gegen CTA/PA auf
der einen und die verantwort-liche Klinikleitung auf deranderen Seite zu minimieren,empfiehlt es sich dringend,den Patienten über dengeplanten Einsatz nicht-ärztlichen Personals umfas-send zu informieren und diesauch durch die Unterschriftdes Patienten zu dokumen-tieren. Die Aufklärung mussso rechtzeitig erfolgen, dassder Patient seine Entschei-dung noch ändern und ggf. ineine andere Klinik wechselnkann.
Fazit: umfassende Ausbil-dung, kontinuierliche Über-wachung und lückenloseAufklärung
Neue Verfahren, Behandlungs-methoden und Berufsbilder imBereich der Medizin benötigenerfahrungsgemäß Jahre, umsich durchzusetzen. Heute nochist es sehr fraglich, ob ein Ein-satz von nichtärztlichem Perso-nal als OP-Assistenz dem Fach-arztstandard genügen kann,schon morgen kann dies aber –gerade mit Blick auf den anglo-
amerikanischen Raum – denStand der Wissenschaft dar-stellen. Für den Moment ist je-denfalls noch Vorsicht geboten.Ausbildung, Überwachung undAufklärung müssen umfassendund erschöpfend durchgeführtund dokumentiert sein, um dasHaftungsrisiko der Beteiligtenzu minimieren. Ist nur eine die-ser Voraussetzungen nicht lü-ckenlos erfüllt, kann schon derbloße Einsatz eines CTA/PA inden Augen des Gerichts einenBehandlungsfehler und eine Straftat darstellen. �
Studiengang „Bachelor of Science Ausbildung „Chirurgisch- Weiterbildung „Chirurgie-Assistent“in Physician Assistance“ Technischer Assistent“
Aufbau Berufsbegleitend; 3 Module Nicht berufsbegleitend; 1 klinische Phase Theorie: Basismodul + fachspez. Modul + prak-
+ Bachelor-Arbeit (18 Mon.)+1 theoretische Phase (14Mon.) tische Ausbildung (nach OP-Katalog)
Dauer 3 Jahre 3 Jahre Theorie: 40 Std. ges. + praktische Ausbildung: 6 Mon.
Zielgruppen OP-Pflegepersonal, OTAs Berufseinsteiger, OTAs, Pflegekräfte (PK), OTAs
Gesundheitspfleger u.ä.
Voraussetzungen Allg./fachgebundene Hochschul- Abitur oder Fachhochschulreife in Fachexamen für den Operationsdienst für PKs
reife + 4 Jahre Berufserfahrung Verbindung mit einem erlernten Beruf (ohne Examen: 5 Jahre Berufserfahrung), 2 Jahre
fachspez. Berufserfahrung für OTAs
Kosten ca. 500 € im Monat; Monatl. Schulumlage von ca. 390 €; Max. 4.000 € Gesamtkosten
ca. 18.700 € Studium gesamt keine Ausbildungsvergütung
Ansprechpartner Prof. Dr. Marc O. Schurr, Alice Hampel, Akademie für operative Jochen Berentzen, Kath. Bildungsstätte
IHCI - Adm. Office Tübingen Aus- und Weiterbildung, Kaiserswerth für Gesundheitsberufe, Osnabrück
Kontakt E-Mail: [email protected]; E-Mail: ota-schule@kaiserswerther- E-Mail: [email protected];
[email protected]; Telefon: 07071-70 5767 diakonie.de; Telefon: 0211-409-3152 Telefon: 0541-326-4000
Rechtsanwalt Tim Müller ist Partner der 1997 ge-gründeten Kanzlei Reichert & Partner in München.Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Medizin-recht, hier insbesondere Krankenhausrecht, und Wirt-schaftsrecht.
Kontakt:Tim MüllerRechtsanwälte Reichert & Partner Seidlstraße 18a80335 München
Telefon: 089-767070-0Telefax: 089-767070-22
E-Mail: [email protected]: www.reichert-partner.de
Der Chirurgie-Assistent Aktuelle Aus- und Weiterbildungskonzepte auf einen Blick

14 nahdran 03/05
Herr Krämer, Sie befürworteneine umfassende, offensiveQualitätssicherung und diekonsequente Umsetzung vonStrategien zur Fehlerprä-vention – bis hin zu Klinik-rankings. Dennoch kritisierenSie das derzeitige Verfahrender Qualitätsberichte deut-lich. Warum?
Ein Grund dafür ist, dass dieQualitätsberichte zwar primärden Patienten und Einweiserndienen sollen, es aber faktischnicht tun. Denn sowohl der Nut-zen als auch die Praktikabilitätund der Komfort des neuenInstruments sind aus meinerSicht bisher viel zu gering. Kaumein Patient oder einweisenderArzt macht sich die Mühe, imInternet die Vielzahl von Quali-tätsberichten durchzusehen undnach den Kriterien zu suchen,
die ohnehin nicht wirklich aus-sagekräftig verglichen werdenkönnen. Die Informationen sindzudem auch sehr unterschied-lich dargestellt, also für medizi-nische Laien nur schwernachvollziehbar. Hinzu kommt,dass sich die Krankenkassen seitden ersten Veröffentlichungenüberschlagen und in Windeseilefür ihre Versicherten eigeneRankings erstellen. Da werdenunkritisch Zusammenhängezwischen Menge und Qualitätsuggeriert, fehlerhafte Datenzugrunde gelegt und damit teil-weise falsche und irreführendeErgebnisse erbracht. Völligunberücksichtigt bei diesemKraftakt von Kliniken und Kas-sen bleibt, welche Informatio-nen über ein Krankenhaus vonwirklichem Interesse sind. Be-fragungen der Zielgruppen imVorfeld der Berichte hat es be-
dauerlicherweise nicht gegeben.Deren Meinung war offenbar fürdie jetzt vorliegenden Qualitäts-berichte gar nicht gefragt.
Wie genau verfahren dieKrankenkassen mit den vor-liegenden Daten?
Einige Krankenkassen bietenspezielle Portale für ihre Versi-cherten an. Dort präsentieren sievergleichende Klinik-Rankingsund sprechen Empfehlungenaus. Ich bin sicher, dass weitereKrankenkassen mit vergleichba-ren Angeboten für ihre Mitglie-der folgen werden. Vermutlichwerden sie sich dabei auf die ex-plizit vom Gesetzgeber ge-wünschten Hinweise und Em-pfehlungen berufen. Allerdingssteht nicht darin, dass dies ein-geschränkt nur für eigene Versi-cherte geschehen und dies als
Qualitätsberichte – Der große Wurf?
Ein Gespräch mit Bernd Krämer, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig Holstein e.V. (KGSH)
Es sollte der ganz große Wurf werden: mit dem Instrument des strukturierten Qualitätsberichts wur-den in Deutschland erstmals über 2.000 Krankenhäuser zu mehr Transparenz und Wettbewerb „ver-pflichtet“. Die Berichte sollten Informationen und Entscheidungshilfen für Patienten bieten, denenein planbarer Klinikaufenthalt bevorsteht, und Orientierungshilfe für betreuende Ärzte sein, die ihrenPatienten Empfehlungen für die Klinikwahl geben möchten. Geplant war, dass sich der Patient ziel-gerichtet darüber informieren kann, welche Klinik – bundesweit oder in seiner Umgebung – für dieBehandlung seiner Krankheit am besten geeignet ist und die beste medizinische und therapeutischeVersorgung bietet. Die Möglichkeit, Kliniken miteinander zu vergleichen, sollte durch den Wettbe-werb der Kliniken untereinander langfristig das Qualitätsmanagement verbessern.
Prinzipiell durchaus anerkennenswerte Zielsetzungen. Bernd Krämer, Geschäftsführer der KHSG, istallerdings – wie viele andere Experten – der Meinung, dass die Qualitätsberichte in ihrer jetzigenForm für ein effektives Qualitätsmanagement unbrauchbar sind. Wir haben ihn gefragt, warum das soist und was er besser machen würde.

nahdran 03/05 15
Mittel der Akquisition genutztwerden soll. Einige dieser Por-tale konnten wir uns ansehen,und für mich steht – insbeson-dere aufgrund eigener langjäh-riger Erfahrung mit der Aufbe-reitung von Qualitätsberichten– außer Frage, dass auch in die-sen Rankings viel zu wenigerläutert wird, wie sie überhauptzustande gekommen sind, wel-che Fakten zugrunde gelegt undwie sie ins Verhältnis zueinandergesetzt wurden. In einigenBereichen wird recht deutlich,dass einige Kliniken durch dieseangebotenen Rankings Vorteilehaben, und es zu Wettbewerbs-verzerrungen kommt. Selbst fürmanche Einweiser wird dasnicht unbedingt deutlich, dennauch sie können höchstens mut-maßen, wie die Zahlen zustandekommen.
Warum sind die Berichte fürdie Patienten inhaltlich soschwer verständlich?
Trotz der Verpflichtung derKrankenhäuser, die Daten desstrukturierten Qualitätsberichtsso zu veröffentlichen, dass sieauch von Laien verstanden wer-den, muss der Leser über quali-fizierte medizinische Grund-kenntnisse verfügen. Für den sogenannten Systemteil wurdenzudem keine Standards festge-legt. So kommt es, dass die Qua-litätsberichte in ihrer Präsenta-tion aber auch in der Ausführ-lichkeit und Aussagekraft vonden Kliniken sehr heterogenaufbereitet wurden. Die unter-schiedlichen Formen der Dar-stellung in den Berichten ver-hindern die gewünschte Trans-parenz für den Patienten, der �

16 nahdran 03/05
Umfang der Berichte schreckteher ab. Im Schnitt umfassendie Berichte rund 50 bis 60 Sei-ten, oftmals mehr als 100 undin der Spitze häufig über 250Seiten. Bei 2.000 Krankenhäu-sern bedeutet dies insgesamtrund 100.000 bis 120.000 Sei-ten – und die wollen erst malgelesen sein. Auch lassen sichdie Berichte, die sich zurzeitauf den Internetseiten befin-den, nicht wirklich miteinandervergleichen. Zwar kann mitHilfe eines Suchmodus ermit-telt werden, welche Kliniken inwelcher Häufigkeit bestimmteOperationen durchführen. Aber
die Verdichtung auf die 30häufigsten Diagnosen einesHauses hat einen enormen In-formationsverlust zur Folge,weil medizinische Schwer-punkte nicht deutlich werden.Zudem ist die Begrenzung aufdie zehn häufigsten Opera-tionen irreführend und wenigaussagekräftig. Denn die elft-häufigste Leistung kann in ei-nem Krankenhaus ebenso häu-fig sein wie die TOP 1 in ande-ren Kliniken. Selten auftre-tende Operationen fallen indiesen Hitlisten gänzlich unter
den Tisch, selbst wenn die Kli-nik darauf spezialisiert ist.
Die Qualitätsberichte – wieeigentlich jede Form von „Kli-nikranking“ – stellen dem-nach einen Zusammenhangzwischen der Menge und derQualität erfolgter Eingriffeher. Zumindest können sieleicht so interpretiert werden.Was halten Sie davon?
Ich bin davon überzeugt, dassder Zusammenhang zwischenQuantität und Qualität nur be-dingt aussagekräftig ist, jeden-falls dann, wenn dies das einzige
oder ausschlaggebende Krite-rium ist. Ein nachweisbarer kau-saler Zusammenhang zwischenQuantität und Qualität ist je-denfalls bislang nicht hinrei-chend dokumentiert. Nur weiljemand bspw. 100 Operationenim Jahr nachweisen kann, heißtdas nicht, dass diese besser, rou-tinierter, fehlerfreier, mit weni-ger Nebenwirkungen, Sepsenoder Beschwerden ablaufen alsin einer Klinik, in denen der Ope-rateur nur 50 oder 60 davonmacht. Nicht die Menge alleinzählt, auch die Nebenkriterien
müssen untersucht werden, be-vor eine Aussage gemacht wer-den kann. Bei Rankings, die sichallein auf den Zusammenhangzwischen Menge und Qualitätstützen, wird einfach unterstellt,dass bei höherer Anzahl au-tomatisch auch mehr Know-how, mehr Sorgfalt und mehrDisziplin gegeben ist. Das kann,muss aber nicht der Fall sein. Beihöherem Durchlauf könnte ge-nauso gut ein Schlendrian ein-treten, eine Nachlässigkeit auf-grund der Routine, wo gegen-über bei weniger Operationenmöglicherweise die Konzentra-tion höher bleibt, sich ggf. mehr
Mühe gegeben wird. Ebensokönnte bspw. operativ wie amFließband in höchster Qualitätgearbeitet werden, aber in derpflegerischen Nachsorge be-stehen Mängel – was nutzt daein implizierter Zusammenhangvon Quantität und angeblicherQualität, wenn es trotzdem zuKomplikationen kommt? Waszählt, ist immer der Gesamt-zusammenhang.
Wären Sie dafür, dass auchMortalitätszahlen und Er-folgsstatistiken zu den jewei-
ligen Eingriffen in die Be-richterstattung aufgenommenwerden?
Wenn solche Zahlen und Statis-tiken nachvollziehbar und plau-sibel erstellt werden, spricht ausmeiner Sicht nichts dagegen.Unbestritten gehören auch sol-che Daten dazu, wenn man dieErgebnisqualität der Klinikenuntersucht und dokumentiert.Ich lehne dies überhaupt nichtab, wenn es objektiv dargestelltwird. Es macht aber wenig Sinn,wenn eine Klinik solche Zahlenohne Zusammenhang präsen-tiert und meint, nur weil sie be-reit ist, diese Daten an die Öff-entlichkeit zu bringen, sei sie diebeste. Insbesondere viele Kran-kenkassen sehen in den Mortali-tätsraten und Erfolgsstatisti-ken das Non plus ultra der Qua-litätsberichterstattung. Dieseeinseitige Präferenz ist für michschwer nachvollziehbar, v.a.wenn man sich anschaut, wieunzureichend solche Daten oft-mals zusammengestellt werden.Das wirkliche Problem bei denmeisten vorliegenden Statisti-ken ist, dass sie eben viel zu un-genau sind, viel zu wenig erläu-tert werden und bedauerlicher-weise die Tendenz zur Manipu-lation haben, weil sich hier alleum ein größeres Stück vom be-grenzten Budgettopf bemühen.
Aber für die Patienten sindErfolgsraten doch sicher injedem Fall interessant …
Nicht unbedingt. Studien zeigenimmer wieder, dass Patientenwider Erwarten gar kein vorran-giges Interesse daran haben, wiegroß die Erfolgsstatistik bei ei-
„ Ein nachweisbarer kausaler Zusammen-
hang zwischen Quantität und Qualität ist
bislang nicht hinreichend dokumentiert. “

nahdran 03/05 17
ner bestimmten Behandlung ist,und schon gar nicht, wie hochggf. die Sterblichkeitsrate ist.Wer operiert oder wegen einerbestimmten Krankheit behan-delt werden muss, will das soschnell und letztlich so bequemwie möglich hinter sich bringen.Patienten interessiert viel mehrdas Grundlegende:
� wo liegt die Klinik, � wie ist die Behandlung dort,� welche Therapiemöglich-
keiten gibt es, � werden ggf. alternative
Methoden angeboten, � wie ist der Arzt-Patienten-
Umgang, � wie umfassend und
individuell ist die Aufklärungüber die Krankheit und dieBehandlungsmöglichkeitenund
� wie leicht kann das persönliche Umfeld dorthingelangen.
Was haben eigentlich die Kli-niken von der gesetzlichenVerpflichtung zur Erstellungvon Qualitätsberichten?
Bereits jetzt versuchen die Klini-ken, den strukturierten Quali-tätsbericht als Kommunika-tionsmittel zu nutzen, mit demsie bei Patienten um Vertrauenwerben. Die Qualität von Klinik-leistungen wird bei der Ent-scheidungsfindung von Patien-ten künftig eine noch größereRolle spielen als bisher. Einenwesentlichen Vorteil zur Ver-pflichtung zu den Qualitätsbe-richten sehe ich aber auch darin,dass jede Klinik gehalten ist, sichmit der Qualitätssicherung aus-einander zu setzen. Das Gros der
Kliniken, die sich vorher nochnicht damit beschäftigt haben,erkennt spätestens dabei, dassman diese mit viel Aufwand er-hobenen Daten wesentlich sinn-voller einsetzen kann, als es bis-lang geschieht. Langfristig kanndaraus für die Klinik ein echterNutzen entstehen. Allerdingsnur, wenn sie sich mit den Datenüber die gesetzlich vorgeschrie-bene Form hinaus beschäftigt.Denn ein Feedback bzw. eineAuswertung oder gar Empfeh-lungen für die Kliniken sind indem bisherigen Prozedere nichtvorgesehen. Da müssen die Häu-ser bislang von sich aus aktivwerden. Ich bin aber der Mei-nung, dass man die Kliniken hierunterstützen sollte.
Was tun Sie in Schleswig-Holstein für eine umfassendeund transparente Qualitäts-sicherung?
Das Instrument Qualitätsbe-richterstattung ist für uns nichtsNeues. Bereits von 1997 bis2001 haben wir unseren Klini-ken die Teilnahme am Quali-tätssicherungs-Report Schles-wig-Holstein auf freiwilligerBasis ermöglicht. Knapp dieHälfte unserer Mitglieder hatdieses Angebot mindestens ein-mal genutzt. Wir haben daherlangjährige und in der Praxisgetestete Verfahren, um Klinik-leistungen vergleichbar zu ma-chen. Aufgrund dieser Erfah-rungen streben wir eine landes-spezifische Auswertung desstrukturierten Qualitätsberichtsan – den Länderqualitätsbe-richt. In enger Zusammenarbeitmit den Kliniken wollen wir denBericht um weitere Informatio-
nen ergänzen, die im Interesseder Patienten eine bessere Ver-gleichbarkeit der Krankenhaus-leistungen zulassen. Geplantist, weitere Daten, etwa ausunserer landesweiten Patien-tenbefragung wie auch aus derexternen Qualitätssicherung,dem BQS-Verfahren, hinzuzu-ziehen. Was uns aber auch in-tensiv beschäftigt, ist die Frage,welche Informationen den Pa-tienten denn überhaupt inte-ressieren. Dieser Länderquali-tätsbericht könnte der Einstiegin einen seriösen bundesweitenVergleich der Krankenhausan-gebote werden.
Und welche grundlegendenMaßnahmen schlagen Sievor, um das Unternehmen„Qualitätsberichte“ zukünf-tig in eine konstruktive Rich-tung zu lenken?
Letztendlich ist jede Weiter-entwicklung von qualitäts-sichernden Maßnahmen alsSchritt in die richtige Richtungzu sehen. Damit ist die Wir-kung des strukturierten Quali-tätsberichts nicht zu unter-schätzen. Trotzdem kann er inseiner jetzigen Form besten-
falls ein Einstieg in das ThemaQualitätsmanagement sein.Der „Krankenhaus-TÜV“ ist mitdem derzeitigen Instrumenta-rium noch in weiter Ferne. Zieldes strukturierten Qualitätsbe-richts muss langfristig sein,den Patienten und Ärzten zu-verlässige, glaubwürdige, ob-jektive und bundesweit mitei-nander vergleichbare Daten zuliefern. Qualitätssicherung undvor allem ihre Dokumentationist für die Kliniken auf jedenFall mit erheblichem Aufwandverbunden. Also sollten auchdie Kliniken etwas von dergesetzlichen Verpflichtung zu
diesen strukturierten Qualitäts-sicherungsberichten haben. Dasist bisher nicht der Fall. Auchhier wollen wir ansetzen. EineRückkopplung an die Klinikenzu ihrer Positionierung undzum Aufzeigen ihres weiterenEntwicklungspotenzials ist des-halb im Länderqualitätsbe-richt fest eingeplant, was imEndeffekt wiederum langfristigden Patienten zugute kommenwird.
Herr Krämer, wir danken Ihnen für das Gespräch! �
Bernd Krämer ist Geschäftsführer der Krankenhaus-gesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH), und auf The-men der Krankenhaus- und Gesundheitspolitik spezi-alisiert. Der Diplom-Ökonom ist sowohl Magister derVerwaltungswissenschaften als auch Assessor desVerwaltungsdienstes. Die KGSH vertritt zurzeit 100Krankenhäuser im Land mit insgesamt 18.645 Betten.
Kontakt:Krankenhausgesellschaft, Schleswig-Holstein e.V.Feldstraße 7524105 Kiel
Telefon: 0431-88105-10 Telefax: 0 431-88105-15
E-Mail: [email protected]: www.kgsh.de
„ Letztendlich ist jede Weiterentwicklung von
qualitätssichernden Maßnahmen als Schritt in
die richtige Richtung zu sehen.“

18 nahdran 03/05
Eine umfassende chirurgischeAusbildung ist eine wichtige In-vestition in die Zukunft. Aber diezunehmende Arbeitsverdichtungin den Kliniken führt dazu, dassgerade so wichtige Fertigkeitenwie Naht- und Knotentechnikenoftmals zu kurz kommen. Wasalso kann man als Unternehmentun, um jungen Chirurgen hieraktiv und praxisnah Wissen zuvermitteln?
Die BBD Aesculap bietet alsKomplettversorger für chirurgi-sche Nahtmaterialien unter demTitel „BBD Aesculap On Tour“seit Jahren regelmäßig regiona-le Workshops an, in denen jungeChirurgenmitUnterstützungvonerfahrenen Referenten Basis-kenntnisse zu sämtlichen Naht-und Knotentechniken erlernenkönnen. Bei den dezentral orga-nisierten Kursen stehen Praxis-nähe und Anwenderorientierungebenso im Vordergrund wie derEinsatz innovativer Methoden.Die Kursinhalte werden kontinu-ierlich an die wachsenden An-sprüche der Chirurgen und diesich ständig ändernden Techni-ken in allen chirurgischen Diszi-plinen angepasst.
Zusätzlich zu den Klinik-Work-shops und den eigenen Work-shops ist die BBD auch Part-
ner der jährlich stattfindendenHildesheimer Nahtkurse (s. In-terview im Anschluss) und der
„Jeder Assistent in einem schneidenden Fach sollte den Nahtkurs absolviert haben...“
Bei den BBD-Naht-Workshops geht es unkompliziert zu und die Mischung aus Theorie und Praxis ist stimmig. Man hat einen sofortigen Lerneffekt,weil ständig erfahrene Dozenten und engagierte BBD-Trainer mit viel Know-how als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die Materialien sindhochwertig und die begleitenden Präsentationen sehr strukturiert und gut verständlich aufgebaut. Hier wird Wissen vermittelt, dass in der Aus-bildung oft zu kurz kommt. Denn das Nähen wird einem kurz im PJ erklärt, dann treten die Operateure ab, wenn die Assistenten zunähen, und manglaubt jahrelang, man hätte ordentliche Kenntnisse in Naht- und Knotentechniken. Einigen Assistenten wurde im Workshop z.B. der Sinn eines kor-rekt durchgeführten Knotens erst richtig klar. Meines Erachtens sollte jeder Assistent in einem schneidenden Fach den Nahtkurs absolviert haben.
Dr. Nicolas Stamer ist Assistenzarzt im zweiten Ausbildungsjahr bei Prof. Link, Chefarzt der Chirurgie der Asklepios Paulinen-Klinik in Wiesbaden.Gemeinsam mit Prof. Link ist er für die Organisation der Naht-Workshops verantwortlich.
Nahtkurse in Rostock-Warne-münde. Hinzu kommen Koope-rationen mit Lehrkranken-häusern und Universitäten, dieihre Studentennahtkurse mitder BBD Aesculap organisieren.Die Dienstleistung funktioniertdenkbar einfach. Interessiertsich eine Klinik für den Work-shop, fordert sie den Kurs beider BBD an und vereinbarteinen Termin. QualifizierteAußendienstmitarbeiter schu-len dann vor Ort das Personal:vom Studenten bis zum prak-tizierenden Seniorchirurgen,vom OP-Pflegepersonal bis hinzu den neuen Berufsgruppenwie OTAs und CTAs. Dazugehört auch die Bereitstellungund Lieferung aller benötigtenMaterialien für einen Work-shop – von den Instrumenten,über spezielle Abfallbehält-nisse für Nadeln, bis hin zuTierpräparaten.
Für weitere Informationenwenden Sie sich bitte an UlrikeWinston, BBD Aesculap GmbH, Telefon: 074 61-9115-623 E-Mail:[email protected]
Naht-Workshops:
BBD Aesculap „On Tour“
Praxisnähe und Anwenderorientierung

nahdran 03/05 19
Die Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie umfasstdas breite Spektrum der Viszeralchirurgie, ein-schließlich der minimal invasiven Techniken, sowieder Unfallchirurgie. Darüber hinaus wird der Weiter-bildungsassistent aber auch bereits in der Aus-bildung mit einer Reihe von Teilgebieten, wie derGefäßchirurgie, der Thorax- oder auch der Plasti-schen Chirurgie konfrontiert. Trotz der erheblichenTechnisierung des chirurgischen Alltags bleibt dieGrundlage die manuelle Nahttechnik. Aus diesemGrund organisieren die chirurgischen Kliniken derKlinikum Hildesheim GmbH mit ihren ChefärztenProf. Dr. A. Richter, Prof. Dr. B. Wippermann undProf. Dr. B. Rieck, seit 2001 den Hildesheimer Naht-kurs. In diesen fünf Jahren entwickelte sich der Kurszu einer überregional bekannten Veranstaltung. Wirhaben mit Prof. Dr. Richter über Ablauf und Inhalteder Kurse gesprochen.
Herr Prof. Richter, welche In-halte werden in den Hildeshei-mer Nahtkursen vermittelt?
Im zweitägigen Kursprogrammdurchlaufen die Teilnehmer inGruppen zu maximal 20 Teilneh-mern insgesamt 6 Übungssek-tionen. Diese jeweils 2 1/2-stün-digen Übungsblöcke bilden denSchwerpunktdesKurses.DieThe-menkomplexederSektionensind:
� Gastrointestinale Naht undKnotentechniken (Handnaht)
� Gastrointestinale Nahttech-niken (Klammernaht) �
Know-how in Naht und Knoten Ein Gespräch mit Prof. Dr. Axel Richter, Klinikum Hildesheim
Der Hildesheimer Nahtkurs: Eine Institution in der chirurgischen Aus- und Weiterbildung
Foto
s: B
BD A
escu
lap
Gm
bH
Foto
: Klin
ikum
Hild
eshe
im

20 nahdran 03/05
� Laparoskopische Techniken
� Gefäßchirurgische Naht-techniken
� Nahttechniken in der Unfallchirurgie
� Nahttechniken in der Hand-und Plastischen Chirurgie
Außerdem erfolgt die Gruppen-zuordnung nach dem Ausbil-dungsstand der Teilnehmer, sodass die Übungen in den jewei-ligen Sektionen entsprechendvariieren. Abgerundet wird dasKursprogramm durch einenEinführungsvortrag am Freitag-morgen zu Naht- und Knoten-techniken sowie zur Materi-alkunde und einer „aktuellenStunde“ am Samstagmorgenmit Kurzvorträgen anerkannterExperten zu verschiedenen chi-rurgischen Themen. Neben denTutoren aus den eigenen Kli-niken engagieren sich erfahre-ne Chefärzte aus namhaftenKliniken Deutschlands als Do-zenten in der sogenanntenGastfakultät. So profitieren dieKursteilnehmer von einem sehrbreit gestreuten Erfahrungs-schatz langjährig klinisch täti-ger Chirurgen.
Glauben Sie, dass die Naht-kurse eine sinnvolle Ergän-zung zur universitären bzw.
klinischen Aus- und Weiter-bildung sind?
Unbedingt. Das Feedback dervergangenen Kurse zeigt, dassdie chirurgische Ausbildung inDeutschland immer stärkerunter dem Druck der zu-nehmenden Arbeitsverdichtungund knapper Personalressour-cen steht. Aus diesem Grundsind derartige Kurse nicht nureine sinnvolle Ergänzung, son-dern eigentlich unverzichtbarfür die Aus- und Weiterbil-dung. Das hat auch Prof. Dr.Saeger, Präsident der Deut-schen Gesellschaft für Chirur-gie, in seiner Eröffnungsrede zuunserem diesjährigen Nahtkursbetont (2. Foto von oben). DerHildesheimer Nahtkurs ist auchals Fortbildungsveranstaltungzum „Curriculum Minimal In-vasive Chirurgie“ der CAMICzugelassen.
Inwieweit berücksichtigenSie innovative Verfahren inden Kursen?
Neben den Grundlagen dermanuellen Naht- und Knoten-techniken werden im Hil-desheimer Nahtkurs natürlichauch alle innovativen Techni-ken im Bereich der Klammer-naht, im Bereich der minimalinvasiven Techniken und deraktuelle Stand der Gewebs-
versiegelungstechniken ver-mittelt. Die enormen techni-schen Möglichkeiten und dasweite Spektrum der modernenChirurgie bedeuten aber aucheinen erheblich logistischenund materiellen Aufwand, umeinen solchen Kurs zu or-ganisieren. Ohne die tatkräf-tige Unterstützung der Part-ner aus der Industrie, wie z.B.die BBD Aesculap GmbH, wäredie Durchführung eines sol-chen Kurses nicht möglich,bzw. für die Teilnehmer nichtfinanzierbar. Durch das ver-lässliche und großzügige En-gagement der Industrie kannder Kurs bei einer moderatenSelbstbeteiligung der Teilneh-mer (100,- bis 200,- Euro jenach Ausbildungsstand) einegroße Fülle an praktischer Er-fahrung vermitteln. Die Struk-tur des Kurses ermöglicht dasÜben in kleinen Gruppen. Soist gewährleistet, dass jederTeilnehmer die Übungen je-weils auch selbst durchführenkann. Die Übungszeiten sindmit 150 Minuten je Sektioninsgesamt großzügig bemes-sen. Und durch permanenteVideoprojektion in allen Sälenist eine optimale Vermittlungder Übungsinhalte gewähr-leistet.
Herr Prof. Richter, vielenDank für das Gespräch! �
Prof. Dr. med. Axel Richter (FACS) istseit Dezember 2000 Chefarzt der Chirur-gischen Klinik I für Viszeral-, Gefäß- undThoraxchirurgie in Hildesheim. Zuvorwar er als leitender Oberarzt an der Chi-rurgischen Universitätsklinik Mannheimtätig. Seine klinischen Schwerpunkte lie-gen in der Viszeral- und Pankreas-chirurgie, in der endokrinen Chirurgie,der Thorax- sowie der Gefäßchirurgieund Nierentransplantation. Wissen-
schaftlich beschäftigt er sich mit Pan-kreatitis, dem Pankreaskarzinom, derklinischen Immunologie und Immun-therapie sowie Hyperparathyreoidismus.
Kontakt:E-Mail: [email protected] [email protected]
Weitere Informationen unter:www.nahtkurs-hildesheim.de
Foto
s: K
linik
um H
ildes
heim

nahdran 03/05 21
Was haben eigentlich medizinischeInnovationen mit Evidenz, demGemeinsamen Bundesausschuss
und Ethik zu tun? Sie wissen es nicht?Dann geht es Ihnen wie den meisten Me-dizinern in diesem Land. Viele Ärzte undPflegende können den verstrickten undlangwierigen Verhandlungen zwischenGremien und Ministerien kaum noch fol-gen. Zumindest was den GemeinsamenBundesausschuss (GBA) und seinen Ein-fluss auf Innovationen im Gesundheits-wesen angeht, möchten wir mit diesemBeitrag etwas Licht ins Dunkel bringen.Denn die Beschlüsse des GBA haben fürden medizinischen Fortschritt in der deut-schen Krankenhauslandschaft weitreichen-de Konsequenzen. Einen äußerst erhellen-den Beitrag zum besseren Verständnisleistet Dr. Nicole Schlottman, die uns alsVertreterin der Deutschen Krankenhaus-gesellschaft (DKG) wichtige Fragen zumThema beantwortet hat. Vorab eine kleine Orientierungshilfe. �
Ein Gespräch mit Dr. Nicole Schlottmann,Geschäftsführerin Dezernat Medizin der DKG

22 nahdran 03/05
Prolog: Wie alles begann
� Der seit 2004 bestehende Ge-meinsame Bundesausschuss(GBA) ist ein Gremium der ge-meinsamen Selbstverwaltungvon Ärzten, Krankenkassenund Krankenhäusern – vertre-ten durch die KassenärztlicheBundesvereinigung (KBV), dieKrankenkassen sowie dieDeutsche Krankenhausgesell-schaft (DKG) und Patienten-verbände.
� Der GBA befasst sich u.a. mitder Bewertung medizinischerMethoden und soll konkreti-sieren, welche ambulantenoder stationären medizini-schen Leistungen zum Leis-tungsumfang der GKV gehö-ren bzw. ausgeschlossen wer-den.
� Grundlage für die Arbeit desGBA ist das Sozialgesetz-buch Nr. V. Dort hat derGesetzgeber den gesund-heitspolitischen Rahmen vor-gegeben, in dem das Gre-mium für die Umsetzungder gesetzlichen Vorgabenzu sorgen hat. Die vom GBAbeschlossenen Regelungenhaben den Charakter unter-gesetzlicher Normen.
� Der GBA beschließt also ei-nerseits die Zulassung neuerund andererseits den Aus-schluss etablierter Methoden.Dazu muss er sich in einerVerfahrensordnung auf diemethodischen Anforderungenan eine wissenschaftliche,sektorübergreifende Metho-denbewertung verständigen.
1. Akt: Die Tat
Mit der am 15. März 2005 be-schlossenen Verfahrensordnungwurde vom GBA eine – insbe-sondere für Krankenhäuser undPatienten – bedeutsame Rege-lung verabschiedet: der Nutzeneiner diagnostischen oder the-rapeutischen Methode sollte„in der Regel“ durch qualitativangemessene Unterlagen derEvidenzstufe I belegt werden,also durch wissenschaftlich be-sonders hochwertige und auf-wändige Studien. Zusätzlichsollten stationäre Leistungen, zudenen heute keine Studien derEvidenzstufe I vorliegen, unmit-telbar aus der GKV-Versorgungausgeschlossen werden.
2. Akt: Das Verhängnis
Im stationären Sektor folgt dieAnwendung innovativer Metho-den dem Prinzip „Erlaubnis mitVerbotsvorbehalt“: ärztliche Un-tersuchungs- und Behandlungs-
methoden können hiernach imklinischen Alltag so lange ange-wendet werden, bis ihre man-gelnde Erforderlichkeit durchden GBA festgestellt wird. Die-ses Prinzip wurde aber durchden GBA ausgehebelt und gera-dewegs umgekehrt: eben nursolche Leistungen sollten künf-tig von den Kassen bezahlt wer-den dürfen, deren Nutzen aufEvidenzstufe I nachgewiesen ist.Eine solche restriktive Regelungkönnte im stationären Sektordazu führen, dass innovativeMe-thoden entweder zu spät odergar nicht mehr in die Versorgungder Patienten einfließen würden.
3. Akt: Die Entscheidung
Beschlossen wurde die ersteVersion der Verfahrensordnunggegen die Stimmen der DKG unddas Patientenvotum. Tatsächlichwurde nach deren heftiger In-tervention eine neue Verfah-rensordnung verabschiedet, dieseit Oktober 2005 in Kraft ist.Mit der neuen Version sollen
Ausnahmen stärker berücksich-tigt werden. Zum Beispiel Berei-che, in denen Studien nur sehrschwer durchgeführt werdenkönnen, etwa bei seltenen Er-krankungen. Auch für Fälle, beidenen der Leistungsausschlussethisch nicht zu verantwortenwäre, sollen Ausnahmen gelten,wie bei schweren Erkrankungenohne Behandlungsalternative.Zudem soll die Nutzenbewer-tung im ambulanten und statio-nären Bereich nach einer ein-heitlichen Methodik vorgenom-men werden.
Epilog: Was vom Tage übrig blieb
Der DKG reicht dieser Kompro-miss prinzipiell aber noch nichtaus. Sie befürchtet, dass deut-sche Kliniken vom medizini-schen Fortschritt abgekoppeltwerden, weil die Übernahme in-novativer Therapien in die klini-sche Patientenversorgung nochimmer mehr behindert als ge-fördert würde.

nahdran 03/05 23
Frau Dr. Schlottmann, wiemuss man sich die Bewertungmedizinischer Verfahren durchden GBA überhaupt vorstel-len?
Um die Erforderlichkeit einerMethode festzustellen, mussgeprüft werden, ob sie ausrei-chend (Frage nach dem Nut-zen), zweckmäßig (Frage nachder Notwendigkeit) und wirt-schaftlich ist. Die Bewertungeiner Methode stellt also im-mer einen umfassenden Abwä-gungsprozess unter Berück-sichtigung zahlreicher Einzel-aspekte dar. So spielen bei derBeurteilung der Notwendigkeiteine Reihe von Faktoren einebesondere Rolle, wie z.B. dieDringlichkeit der Behandlungs-notwendigkeit, die Verfügbar-keit, der Stellenwert diagnos-tischer und therapeutischerAlternativen u.v.m. WährendLiteraturrecherchen und Evi-denzklassifizierungen zur Be-wertung des Nutzens ein eherstandardisiertes Vorgehen er-lauben, erfordert die Prüfung
der medizinischen Notwendig-keit zunehmend die Berück-sichtigung ethischer Frage-stellungen.
Können Sie das etwas genauererläutern?
Wird im stationären Sektor eineLeistung für GKV-Versicherteausgeschlossen, so steht sie ih-nen grundsätzlich nicht mehrzur Verfügung. Insofern sindsehr hohe Anforderungen mitder Feststellung verbunden, obeine Leistung indikationsspezi-fisch für alle Patienten oder nurfür gewisse Patientengruppenausgeschlossen werden soll.Auch gilt es im Rahmen derNotwendigkeitsprüfung die Viel-falt individueller Krankheits-konstellationen zu berücksichti-gen, um für alle Patienten überausreichende Behandlungsal-ternativen zu verfügen. Inso-fern berücksichtigt die Prüfungder Notwendigkeit nicht nurethische Aspekte, sondernstellt gleichzeitig sehr hohe An-forderungen an fachlich-in-
haltliche Details. Letzter Schrittim Verfahren ist die Beurteilungder Wirtschaftlichkeit einer Me-thode. Sofern jedoch der Nutzenund die medizinische Notwen-digkeit verneint werden müssen,ist die Bewertung der Wirt-schaftlichkeit entbehrlich.
Was lag Ihnen bei der erstenVersion der GBA-Verfahrens-ordnung besonders schwer imMagen?
Hauptkritikpunkt der DKG wardie Tatsache, dass die vorge-sehenen Regelungen die wei-tere Implementierung relevan-ter Innovationen im stationä-ren Sektor hätten verhindernkönnen. Denn die vorgeseheneBewertung der Methoden wä-re fast ausschließlich auf diePrüfung des Nutzens reduziertworden. Hierdurch wäre ent-gegen den gesetzlichen Vor-schriften der Abwägungspro-zess – also die Prüfung derNotwendigkeit und Wirtschaft-lichkeit – nahezu vollständigaußer Kraft gesetzt. Zudem
wurde bei fast jeder Methodegefordert, den Nutzen aufBasis randomisierter und kon-trollierter Studien der Evi-denzstufe I zu belegen. Sofernder Nutzenbeleg auf diesemEvidenzniveau nicht vorliegt,sollte nach Auffassung vonGKV und KBV eine Leistunggrundsätzlich von der statio-nären Versorgung ausgeschlos-sen werden. Und die Studiensollten sich maßgeblich auf sogenannte patientenrelevanteEndpunkte, wie z.B. Mortali-tät, beziehen. Dies hätte zu-sätzlich sehr lange Studien-laufzeiten vor Einführung ei-ner Innovation erfordert. DaStudien dieser Güte nur zusehr wenigen Methoden inder Medizin vorliegen, hättediese Verfahrensordnung nichtnur den Ausschluss zahl-reicher bereits etablierter Me-thoden provoziert, sonderngleichermaßen das Aus fürviele Innovationen bedeutet.Aber medizinischer Fortschrittbraucht Innovationen – keine Bürokratie. �

24 nahdran 03/05
Und welche Vorteile bietet dieneue Version aus DKG-Sicht?
Die massive Kritik der DKG aberauch der Patientenvertreter haterfreulicher Weise sowohl inder Öffentlichkeit als auch imBundesministerium für Gesund-heit und Soziale Sicherheit(BMGS) Gehör gefunden. Inzahlreichen Gesprächsrundenim BMGS konnten mit Unter-stützung externer Wissen-schaftler die besonderen Gefah-ren der neuen Verfahrensord-nung dargestellt werden. Er-gebnis sind die vom Minis-terium an den GBA übermit-telten Vorgaben zur Änderungder Verfahrensordnung. Aberauch bei den neuen Regelungenhandelt es sich um einen vonSeiten der DKG eher kritisch be-äugten Kompromiss. Die fakti-sche Orientierung ausschließ-lich an der Evidenzstufe I wurdezwar grundsätzlich zurückge-nommen, sodass die Nutzenbe-wertung auf Basis der bestver-fügbaren und somit der tat-sächlich vorliegenden Evidenz
erfolgen kann. Das ist sicher einVorteil. Dennoch zeigt auch dieneue Verfahrensordnung be-züglich des Umfangs der Rege-lungen eine deutliche Evidenz-lastigkeit bei Vernachlässigungdes Abwägungsprozesses.
In der neuen Verfahrens-ordnung wurde ja noch eineweitere Möglichkeit nebendem Ausschluss einer Methodefür den stationären Sektor ge-schaffen. Diese erlaubt in Fäl-len, in denen keine aus-reichende Evidenz vorliegt, dieBeschlussfassung zu einer Me-thode befristet auszusetzen.
Das ist prinzipiell positiv zu be-werten. Krankenhäuser könn-ten dann die Leistung weiter-hin im Rahmen der GKV-Ver-sorgung erbringen. Die Ausset-zung der Beschlussfassung ist
insbesondere für solche Me-thoden vorgesehen, bei denenzu erwarten ist, dass Studien innaher Zukunft vorgelegt wer-den können. Darüber hinaushat der Ausschuss in diesenFällen Anforderungen an dieStruktur- und/oder Ergebnis-qualität zu definieren. Insofernmüssen Krankenhäuser künftigdefinierte Qualitätsanforderun-gen bei Einführung dieser in-novativen Leistungen erfüllen.Die befristete Aussetzung sollAnreize für die Durchführungvon Studien zur weiteren Klä-rung des Nutzens einer Metho-de setzen.
Ihnen reicht das aber nochnicht. Warum?
Weil die entschärften Regelntrotzdem mit Risiken für in-novative Methoden behaftet
sind. Die neue Verfahrensord-nung suggeriert z.B., dass Kran-kenhäuser allein für den Nut-zenbeleg zu allen medizinischenVerfahren im Rahmen von Stu-dien verantwortlich seien. Diebefristete Aussetzung löst nichtdas grundsätzliche Problem,dass die Studiendurchführunghäufig mit enormen Kosten undviel Aufwand für die Kranken-häuser verbunden ist und dienotwendigen Mittel dafür nichtbereitstehen. Die Einführungder DRGs erschwert die Voraus-setzungen zusätzlich. So stelltsich also die Frage, was miteiner Methode geschehen soll,wenn nach Ablauf der Fristkeine neuen Studien zur Nut-zenbewertung vorliegen. Diestrittige Frage, ob eine Methodeallein auf Basis einer mangeln-den Studienlage von der Versor-gung auszuschließen ist, wird

nahdran 03/05 25
mit der neuen Verfahrens-ordnung lediglich auf einenspäteren Zeitpunkt verlagert.
Stehen Sie evidenz-basiertenVerfahren grundsätzlich kri-tisch gegenüber?
Nein. Die DKG befürwortet einevidenz-basiertes Gesundheits-system und möglichst hoch-wertige Studien für den Nutzen-beleg medizinischer Verfahren.Aber es gilt, im GBA ver-antwortungsvoll über heute undkünftig verfügbare Leistungenfür GKV-Versicherte zu ent-scheiden. Dass für medizinischeVerfahren nicht ausreichendhochwertige Studien vorliegen,ist bedauerlich, darf aber nichtdazu führen, Patienten notwen-dige Leistungen vorzuenthalten.Die alleinige Orientierung anEvidenzkriterien ist ethisch
höchst bedenklich, da sich ein-zelne Patientengruppen nichtmehr sachgerecht versorgt imSystem wiederfinden würden.So klingt die alleinige Forderungnach Evidenzstufe I vorder-gründig zunächst nach mehrQualität, ist aber in der Realitäteine elegante Ausgrenzungzahlreicher medizinischer Ver-fahren, die in letzter Konse-quenz von den Patienten dannselbst zu finanzieren sind. Ausdiesem Grund wird eine solcheBewertung auch in keinemanderen Land praktiziert.
Kann denn eigentlich das Feh-len einer Studie ein hinrei-chender Beleg für die Unwirk-samkeit einer Methode sein?
Nein, natürlich nicht. Es exis-tieren zahlreiche Beispiele fürnotwendige Leistungen in der
Medizin, die nicht durch ange-messene Studien belegt sind.Der Wunsch, eine bessere Studi-enkultur in Deutschland zu för-dern, wird uneingeschränkt vonder DKG geteilt. Aber statt demundifferenzierten Ausschlusszahlreicher Leistungen bedarf eshierfür vielmehr konstruktiverAnsätze, um die dafür notwen-digen Voraussetzungen zuschaffen. Den Blick auf dieohnehin derzeit sehr ange-spannte Situation in den Kran-kenhäusern gerichtet, wäre fürdiesen Zweck eine gezielteFörderung die durchaus ge-eignetere Vorgehensweise.
Gibt es noch weitere Kritik-punkte der DKG an der Arbeitdes GBA?
Durchaus. Es stellt sich z.B. dieFrage, ob die im GBA vorgesehe-nen Regelungen zur Beschluss-fassung immer sachgerechte Lö-sungen zulassen. Nicht nur dasThema Methodenbewertung,sondern auch andere zentralePunkte zeigen, dass die vom Ge-
setzgeber angestrebten Ziele imGBA nicht immer erfolgreichumgesetzt werden können. Hierwäre z.B. der fehlende Fort-schritt in Bezug auf die Öffnungder Krankenhäuser gem. § 116 bSGB V zu nennen. Es erfolgen le-diglich zahlreiche Anstrengun-gen von KBV und GKV, die imGesetz bereits verankerten Mög-lichkeiten durch unzulässigeMaßnahmeneinzuschränken. In-sofern erscheint mir eine erneu-te kritische Diskussion der Rege-lungen zur Beschlussfassung imGBA dringend erforderlich. Die KBV fordert in ihrem politi-schen Sofortprogramm vom 11.Oktober 2005, innovative Leis-tungen wie im ambulanten auchim stationären Sektor grund-sätzlich zuzulassen – entgegenden Regelungen der Verfahrens-ordnung. Dies verdeutlicht denUnmut der KBV an den gültigenRegelungen und zeigt, dass dasRingen um Innovationen geradeerst begonnen hat.
Frau Dr. Schlottmann, vielen Dank für das Gespräch! �
Dr. med. Nicole Schlottmann studier-te Humanmedizin an der UniversitätBonn. Nach ihrer klinischen Tätigkeitwar sie wissenschaftliche Mitarbeiterinam Zentralinstitut für die Kassenärzt-liche Versorgung und beratende Ärztinbeim AOK-Bundesverband in der Ver-tragsabteilung für den stationärenSektor. Von Oktober 2000 bis März2004 leitete sie den Bereich Medizinbei der Deutschen Krankenhaus Gesell-schaft (DKG); seit April 2004 ist sie Ge-schäftsführerin des Dezernates Medi-zin der DKG.
Kontakt:Dr. Nicole SchlottmannGeschäftsführerin Dezernat Medizin der DKGWegelystraße 310623 Berlin

26 nahdran 03/05
„Aus der Vergangenheit kann jeder lernen.Heute kommt es darauf an, aus derZukunft zu lernen.“ Die Worte des ameri-kanischen Kybernetikers und FuturologenHermann Kahn könnten das Motto von„ConceptHospital“ sein. ConceptHospitalist eine Ideenschmiede, in der sich Exper-ten unterschiedlicher Branchen gemein-sam dem Krankenhaus der Zukunft wid-men. Hier wird auf Vorrat gedacht – mitdem Ziel, sich auf künftige Herausforde-rungen vorzubereiten, Entwicklungen frü-her zu erkennen als andere und Chancenrechtzeitig zu nutzen. Was so faszinierendvisionär klingt, hat für Kritiker auch Schat-tenseiten. Der Mensch der Zukunft ist „onhealth“: zwar gesund – aber gleichzeitigvernetzt und gläsern. Von Geburt an sollendie Patientendaten gespeichert und füreine umfassende Gesundheitspräventiongenutzt werden. Mit solcherlei Gedanken-spielen provozierten die Veranstalter desvirtuellen Zukunftskonzepts das Publikumbeim diesjährigen Hauptstadtkongress inBerlin. Wir haben mit den „führenden Köp-fen“ von ConceptHospital über die Hinter-gründe gesprochen.
ConceptHospital erinnert starkan die so genannten „Con-cept Cars“ der Automobil-branche – also z.B. PKWs oh-ne Lenkrad, dafür aber mitBordcomputer und Seitenauf-prallschutz. Was lernen Sievon der Autoindustrie und wogibt es Gemeinsamkeiten mitIhrem Konzept?
Bei der Konzipierung des Brain-pools ConceptHospital standuns tatsächlich die Automobil-
industrie Pate, die ihre inno-vativen Ideen Jahr für Jahr aufden Automobilsalons als Con-cept Cars präsentiert. DieseAutos werden zwar jenseitsder Straßenverkehrsordnung,dem TÜV oder sonstigen Re-geln konzipiert, aber 5-10 %der realisierten Ideen findensich in den nächsten Jahrenals Innovation in den Spitzen-modellen des Premiumseg-ments wieder, denken Sie anAirbags, ABS oder Naviga-
Ein Interview mit Dr. med. Dirk Richter, Pascal Scher und Dr. med. Markus Müschenich, ConceptHospital, Berlin
Schöne neue KlinikweltConceptHospital – Das Krankenhaus der Zukunft?

nahdran 03/05 27
tionssysteme. Das gleiche Prin-zip kann auch im Kranken-hausmanagement angewandtwerden. Ohne auf gesetzlicheRegeln und tradierte Organi-sationskulturen zu achten,werden bemerkenswerte Ide-en für das Krankenhaus derZukunft in einem kreativenProzess entwickelt. Der Reali-sierungsgrad, also die an-schließende Umsetzung in diePraxis, soll bei der Entstehungder Ideen eine untergeordnete
Rolle spielen und damit un-gebremste Kreativität sicher-stellen.
ConceptHospital will wegvon alten Gedankenpfaden.Innovationsmotor sollen dieWünsche und Erwartungender beiden wichtigsten Kun-dengruppen, nämlich derPatienten und der Kosten-träger sein. Wie funktio-niert ConceptHospital kon-kret?
Das Krankenhaus der Gegenwartwird durch einen grundlegendenGegensatz bestimmt. ModernsteHightech-Medizin wird häufigin einer steinzeitlichen Organi-sationsstruktur betrieben. Dieinnovative Forschung in der Me-dizin wird leider nur zu seltenmit einer Kultur der Forschungund Entwicklung im Kranken-hausmanagement kombiniert.Dies ist insbesondere deshalbbemerkenswert, weil sich au-genscheinlich auch die traditio-
nellen Anforderungen vonPatienten und Kostenträgern anein Krankenhaus in einemTransformationsprozess befin-den. Deshalb haben wir bereitsvor mehreren Jahren den Brain-pool ConceptHospital gegrün-det, wo wesentliche Entwick-lungen und Trends der Gegen-wart in Visionen für das Kran-kenhaus der Zukunft übersetztwerden. Veraltete Abteilungs-strukturen werden dabei genau-so überwunden, wie die �

28 nahdran 03/05
sektorale Gliederung des Ge-sundheitswesens in ambulantund stationär. Das ConceptHos-pital wird dabei von Concept-Units gebildet, die als flexibleOrganisations- und Strukturein-heiten spezifische Lösungen fürden Bedarf der Zukunft bieten.
Können Sie uns ein Beispielfür eine solche „Concept-Unit“ nennen?
Natürlich. Nehmen wir dieConceptUnit „Success“: Hierkann der Patient online das Be-handlungsergebnis simulieren,bevor er sich für eine Therapieund einen bestimmten Thera-peuten entscheidet. Über einenFragealgorithmus, in den bio-grafische Daten, Vorerkrankun-gen, die Ergebnisse von Vorun-tersuchungen etc. eingehen,wird eine Ergebnis-Simulationdurchgeführt, die für den Pa-tienten die Erfolgswahrschein-lichkeit der Behandlung ermit-telt. Dabei kann der Patientselbst alle für ihn relevantenParameter festlegen. Zum Bei-spiel, ob die Schmerzfreiheit imVordergrund stehen soll. Ziel istes, diese Ergebnissimulation ineinigen Jahren in die regel-haften Aufklärungsgesprächevor einer Operation oder Inter-vention zu integrieren.
Auf dem diesjährigen Haupt-stadtkongress haben Sie mitIhren Visionen zum Kranken-haus der Zukunft Diskussio-nen ausgelöst. Menschen, die„on health“ sind, im ständi-gen Austausch mit dem Ge-
sundheitswesen stehen undvon einem Kleincomputer na-mens „Personal onHealth-As-sistant“ überwacht werden –das klingt ein bisschen nachScience Fiction. Würden Siees wirklich begrüßen, wennein solches Szenario einesTages Wirklichkeit würde?
Mit dem „Personal onHealth-Assistant“ (POA) haben wireine potenzielle Möglichkeitaufgezeigt, den Trend einer zu-nehmenden Vernetzung unse-
rer Informationsgesellschaft indie Gesundheitswirtschaft zuübersetzen. Geleitet wurdenwir dabei von der Idee, dass inZukunft die Prävention einewesentlich stärkere Position inunserem Leben einnehmensollte. Die Diskussion der Politikin Bezug auf eHealth beschränktsich heute bedauerlicherweisenur auf die Einführung einerelektronischen Patientenakte.Und die kommt auch erst dannzum Einsatz, wenn eine Erkran-kung vorliegt und behandeltwerden muss. Die Funktionali-tät eines POA beginnt aller-dings schon wesentlich früher,wenn es nämlich um die Ver-meidung von Krankheiten geht.Die Nutzer des POA können z.B.im Supermarkt digital und ganzindividuell bei der Auswahl vonLebensmitteln unterstützt wer-den, die zur Bewahrung und
Förderung ihres Gesundheits-zustandes dienlich sind. Reali-siert wird dies durch den Online-abgleich persönlicher gespei-cherter Gesundheitsdaten mitden jeweiligen Produktinforma-tionen. Welches Produkt dermündige Bürger letztendlichauswählt, wird ein POA nichtbestimmen, aber vielleicht kannes gelingen, durch die Bereit-stellung notwendiger Informa-tionen Auswahlentscheidungennachhaltig gesundheitsdienlichzu beeinflussen.
Ist das nicht datenschutz-rechtlich bedenklich? Was,wenn die Daten in falscheHände geraten und sich je-mand eben nicht „gesund-heitsfördernd“ verhält?
Natürlich soll das alles nicht amDatenschutz vorbei gehen, aberwir leben nun einmal in einerInformationsgesellschaft undsollten auch die Daten einesMenschen zur Prävention vonErkrankungen nutzen. Wirprognostizieren, dass künftig einMarketingaspekt eines Kranken-hauses u.a. die Bereitstellungvon Speicherkapazität sein wird.Sämtliche Informationen einesPatienten, also Impfungen, Er-krankungen, Besonderheiten,Röntgenaufnahmen etc. werdenin der Datenbank des Kranken-hauses gespeichert und der Pa-tient kann sich, natürlich unter
Berücksichtigung aller Daten-schutzbestimmungen, von je-dem Ort der Welt in die Daten-bank des Krankenhauses ein-wählen. Das ist die Zukunft: dievirtuelle Krankenakte als Marke-tingaspekt eines Krankenhauses.
Laut einer im Mai 2004 ver-öffentlichten Studie des Rhei-nisch-Westfälischen Institutsfür Wirtschaftsforschung undder UnternehmensberatungAdmed sind rund 26% allerKliniken bis 2008 von derSchließung bedroht. Sie, HerrMüschenich, haben demtraditionellen Krankenhaus-betrieb bescheinigt, keineZukunft zu haben. WelcheDefizite gilt es nach IhrerEinschätzung vor allem zubeheben?
Das Krankenhaus der Gegen-wart verharrt häufig in histori-schen Strukturen und Denk-weisen. Dabei ist es unerläss-lich, die geänderten Rahmen-bedingungen eingehend zuanalysieren, die Konsequenzenabzuschätzen, seine Schlüssezu ziehen und Handlungs-strategien für die jeweilige in-dividuelle Situation daraus ab-zuleiten. Dieser Prozess ist invielen Krankenhäusern erst imAnsatz eingeleitet. Wer jedochmorgen erfolgreich sein will,der sollte heute die Zukunftmitgestalten. Das bedeutet füruns die strategische Ausrich-tung auf Gesundheitsstandorteim Gegensatz zur herkömm-lichen Ausrichtung nur auf dasKrankenhaus.
PD Dr. med. Dirk Richter ist Facharzt für Chirurgie undHochschullehrer am Erwin-Payr-Lehrstuhl für Unfall-chirurgie an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-wald. Darüber hinaus leitet der Gesundheitsökonomden Bereich Pharma/Health Care bei der MünchnerUnternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner.
Kontakt:[email protected]
Pascal Scher studierteHumanmedizin an derErnst-Moritz-Arndt Uni-versität Greifswald undarbeitet heute als Assis-tent des Vorstandes imVerein zur ErrichtungEvangelischer Kranken-häuser (VzE) Berlin.
„ In Zukunft wird die Prävention eine
wesentlich stärkere Position in unserem
Leben einnehmen.“

nahdran 03/05 29
Und wie trägt nun Concept-Hospital konkret zu Verbes-serung der Lage bei?
Das ConceptHospital generiertvielversprechende Zukunftssze-narien, auf die sich das Kran-kenhaus der Gegenwart einlas-sen sollte. Das Krankenhaus vonübermorgen ist nur noch be-grenzt mit dem Krankenhausvon heute vergleichbar. Voraus-sichtlich werden dort stationärePatienten in der Minderzahlsein. Das ConceptHospital istvielmehr ein Standort, der alsBetriebssystem und Netzknotenim Gesundheitssystem verstan-den werden wird. Hier wird derAlltag der Bürger mit Medizinvernetzt werden können. Esentstehen neue medizinischeDienstleistungen, wie z.B. derfachliche Support des PersonalonHealth-Assistant, die in we-sentlichem Maß auf die Präven-tion und den normalen Lebens-alltag ausgerichtet sind. Einemaximale Informations- undServiceorientierung wird zumentscheidenden Erfolgsfaktor.
Das Krankenhaus der Zukunftsoll also High-Tech-Medizinmit Dienstleistungscharakterbieten: Worte wie Kundenori-entierung, Kostenfaktor undRentabilität fallen in diesemZusammenhang häufig. DerBerliner Palliativmediziner Dr.Christof Müller-Busch kriti-siert an ConceptHospital u.a.,dass Begriffe wie Schmerz undTod in der „schönen neuen Kli-nikwelt“ keinen Platz hätten.Wie stehen Sie dazu?
Die Idee des ConceptHospitalist es, ein Zukunftskrankenhauszu entwickeln, das vom Patien-ten hundertprozentig akzep-tiert wird. Daher ist es unab-dingbar, dem Patienten eineprofessionelle Unterstützungzu gewährleisten, die seinenindividuellen Bedürfnissen undseinem Krankheitsbild ent-spricht. Dies gilt selbstver-ständlich auch für den schwer-kranken Patienten.
Wir sind heute auf dem Wegzum Höhepunkt der Wissens-und Informationsgesellschaft,allerdings soll diese gesell-schaftliche Entwicklungs-periode in spätestens zehnJahren überschritten sein.Jedenfalls laut der Zyklen-theorie des russischen Öko-nomen Kondratieff. Demnachstehen wir am Beginn des 6.Kondratieff-Zyklus, dessenzentraler Antrieb eine enor-me Nachfrage nach Gesund-heit und Wellness sein wird.Wie stellen Sie sich das Ge-sundheitswesen in zehn Jah-ren vor?
Vor dem Hintergrund einer po-litisch unzureichend geführtenDiskussion über innovativeWeiterentwicklungsmöglich-keiten unseres Gesundheitswe-sens hat sich ConceptHospitalim vergangenen Jahr auch aus-führlich mit dem Thema Con-ceptHealth beschäftigt. DasGesundheitssystem der Zukunft
wird in den Alltag der Bürgerintegriert werden. Die Vermei-dung von Krankheiten bildetdabei den Fokus der Verände-rungen, die alle gemeinsam dasZiel haben, einen wirklichenGesundheitsmarkt zu etablie-ren. Die heutige Gesundheits-wirtschaft kann zunehmend imKern durch einen Krankheits-
markt charakterisiert werden,bei dem die Kostenträger daraufaus sind, eine möglichst kosten-günstige Behandlung ihrer Ver-sicherten durch die Leistungs-erbringer zu erreichen. Die Kon-zentration auf Kostenreduktionsteht hier im deutlichen Wider-spruch zu der Vision, Deutsch-land zum gesündesten LandEuropas zu machen.
Vielen Dank für das Ge-spräch! �
Dr. med. Markus Müschenich, Masterof Public Health, Facharzt für Kinder-heilkunde, ist Medizinischer Vorstanddes Vereins zur Errichtung Evangeli-scher Krankenhäuser (VzE) in Berlin.Zuvor war er als Referent des Ärzt-lichen Direktors im UnfallkrankenhausBerlin (UKB) tätig.
„Der Alltag der Bürger wird mit Medizin
vernetzt werden können.“

30 nahdran 03/05
Geringe Patientenbelastung,kosmetisch ansprechende Er-gebnisse, weniger Wundhei-lungsstörungen und eine ver-kürzte Liegedauer: währendsich in der Erwachsenenchirur-gie die Vorteile der MIC amBeispiel der weit verbreitetenCholezystektomie gut verdeut-lichen ließen, brauchte man inder Kinderchirurgie etwas län-ger, um die innovativen Ver-fahren einzuführen. Denn einederart weit verbreitete Ope-ration, die sich zudem sehr gutfür die minimal invasive Tech-nik eignet, gibt es hier nicht.Aber auch die noch immerproblematische DRG-Vergü-tung für minimal invasive Ver-fahren in der Kinderchirurgieerschwert eine flächendecken-de Etablierung. Am Universi-tätsklinikum Mainz lässt mansich davon nicht beirren: in derKinderchirurgie sind minimalinvasive OP-Techniken heutean der Tagesordnung. Wir ha-ben Prof. Felix Schier gebeten,für Sie den aktuellen Stand derminimal invasiven Kinderchi-rurgie in einem Überblick zu-sammenzustellen.
Mittlerweile lässt sichauch in der Kinder-chirurgie ein eindeu-
tiger Trend zur MIC auf in-ternationalem Niveau ausma-chen. So wird z.B. nur nochselten die „offene“ Fundopli-catio durchgeführt. In denUSA ist die laparoskopischeFundoplicatio die wahrschein-lich häufigste minimal inva-sive Operation bei Kindernüberhaupt (Abb. 1).
In Europa hingegen werden zu-nehmend laparoskopische Ap-pendektomien durchgeführt.Allerdings sind die Vorteile derminimal invasiven Technik ge-genüber der traditionellen Vor-gehensweise besonders in die-sem Fall bei Experten umstrit-ten. Wir nehmen dennochpraktisch 100% aller Appen-dektomien laparoskopisch vor.Aus folgenden Gründen: derChirurg sieht bei der laparo-skopischen Technik sehr gutund kann so das Ausmaß derErkrankung wesentlich bessereinschätzen. Hinzu kommt,dass die Bauchhöhle gründli-cher gespült werden kann, fallses zu einer Perforation kom-men sollte. Wählt man dieTechnik mit einer Optik undkoaxialem Arbeitskanal, lässt
sich der Eingriff allein durchden Nabel vornehmen. Manbraucht allerdings ein zusätzli-ches 2-mm-Instrument, um dieAppendix zu halten. Mit dieserMethode bleiben keinerlei Nar-ben zurück.
Eine typische Indikation für dieminimal invasive Technik beimKind ist weltweit der Kryptor-chismus. Hier stellt sich zu-nächst die Frage, ob es über-haupt einen Hoden gibt undwo er sich befindet. Diagnosti-sche Laparotomien sind dabeiheute sicher obsolet. Liegt derHoden relativ weit unten imBauchraum (Abb. 2), lässt ersich – in der gleichen Sitzung –auch bis ins Skrotum beför-dern, allerdings oft nicht bisganz nach unten. Liegt er wei-
ter oben in Richtung Niere,bleibt nichts anderes, als zu-nächst seine Blutgefäße zudurchtrennen und ihn dann ei-nige Monate später über einenLeistenschnitt ganz nach untenzu verlagern. Die Durchtren-nung der Blutgefäße ist unpro-blematisch, weil der Hoden ei-ne gute zusätzliche Blutversor-gung durch von unten kom-mende Gefäße hat. Es gibtauch Kinderchirurgen, die denHoden gleich nach unten ver-lagern. Wir halten das für et-was zu riskant. Wir wollen erstdie Ausbildung ausreichenderUmgehungskreisläufe abwar-ten. Zudem gibt es Chirurgen,die den Hoden ohne Leisten-schnitt über eine am Skrotumeingebrachte Fasszange nachunten ziehen. Uns ist dabei das
Fundoplicatio und Gastrostomie mit
2-mm-Instrumenten.
1
Minimal invasive ChirurgieAktuelle Trends in der Kinderchirurgie Ein Beitrag von Prof. Dr. med. Felix Schier, Kinderchirurgie, Universitäts-Kliniken Mainz

nahdran 03/05 31
blinde Präparieren von obenetwas unheimlich, deswegensetzen wir stattdessen bevor-zugt die inguinale Inzision ein;denn schließlich liegt das Pro-blem im Leistenkanal.
Auch sonstige typische kinder-chirurgische Routineoperatio-nen können heute minimal inva-siv vorgenommen werden, wiez.B. die Leistenbruch-Opera-tion (Abb. 3+4). Die OP gehtschnell (für eine doppelseitigeLeistenbruch-Operation benöti-gen wir etwa 25 Minuten) undhinterlässt keine Narben. Manoperiert nur die betroffene Seite,und verschließt auch sogleichdie andere Seite, falls sie uner-wartet offen sein sollte. Dasminimal invasive Vorgehen isthier zudem diagnostisch zuver-
lässiger: man findet die unge-wöhnlicheren Bruchformen, wiez.B. direkte Leistenbrüche, vielhäufiger als in der offenen Chi-rurgie. Dort werden sie tatsäch-lich oft übersehen. Ein weitererVorteil: der Eingriff kann ambu-lant vorgenommen werden.
Die Pyloromyotomie wegen„Magenpförtner-Krampf“ wirdebenfalls kaum mehr offen, son-dern an den meisten kinderchi-rurgischen Kliniken ausschließ-lich minimal invasiv durchge-führt. Da bei dieser Operationdas Aufschneiden und Zunähender Bauchwand die meiste Zeitin Anspruch nimmt, dauert derminimal invasive Eingriff meistweniger als 10 Minuten. Tat-sächlich können die Kinder auchfrüher wieder nach Hause.
Diese Eingriffe gehen minimalinvasiv so schnell, weil beiKleinkindern das Aufblasen derkleinen Bauchhöhle mit CO2
nur wenige Sekunden dauert.Bei einer Flussrate von 0,5 Literpro Minute und einem Fas-sungsvermögen von vielleicht100 ml ist der Bauch in 12 Se-kunden voll. Genau so schnellgeht es am Ende der Operation.Wird der 5-mm-Trokar am Na-bel zum OP-Ende gezogen,entweichen die 100 ml CO2
sofort aus dem Nabel. Es istdann nur noch eine Naht derFaszie am Nabel erforderlich(Zugang für den 5-mm-Trokar),eine Hautnaht ist nicht not-wendig.
Bei den Öffnungen für 2-mm-Trokare, die wir fast für alle
Operationen verwenden, ver-zichten wir komplett auf Näh-te. Steristrips und ein Pflasterreichen hier vollkommen aus.
Wir verzichten bei allen diesenOperationen ebenfalls auf dennoch in vielen Kliniken ge-bräuchlichen „postoperativenKostaufbau“. Er war ohnehinwissenschaftlich nie gut be-gründet. Wir haben ihn abge-schafft und lassen die Kinder,sobald sie sich von Operationund Narkose erholt haben,direkt wieder zu ihrer normalenKost zurückkehren. Auch da-durch wird der stationäre Auf-enthalt natürlich verkürzt.
Es gibt kaum eine klassischekinderchirurgische Operation, die – sofern sie in einer �
Hoden liegt im kleinen Becken. Minimal invasiv
leicht zu sehen. Lässt sich in der gleichen Sitzung in
das Skrotum verlagern.
… und nach laparoskopischem Ver-
schluss.
Leistenbruch vor …
2 3 4

Körperhöhle durchgeführt wird– nicht minimal invasiv mach-bar wäre. Hinzu kommt, dassminimal invasive Verfahren fürdas Kind eigentlich in jedemFall günstiger sind, sofern derChirurg über ausreichend Er-fahrung verfügt. Dies gilt auchfür die größeren Eingriffe.Drei dieser klassischen Opera-tionen seien noch angeführt:
� Ösophagus-Atresie imBrustkorb
� Ureter-Abgangsstenose alsurologische Operation
� Choledochus-Zyste alsBauchoperation
Alle diese Eingriffe haben wirmit 2-mm-Instrumenten durch-
geführt. Die durchschnittlicheVerweildauer in unserer Klinikbeträgt dabei nur 2.7 Tage, ein-schließlich Traumatologie undTumoren.
Die Ösophagus-Atresie ist dieklassische Parade-Operation derKinderchirurgie. Beim abgebil-deten Fall (Abb. 5) fehlt einStück der Speiseröhre, das obe-re Ende ist blind, das untereEnde, Richtung Magen, mündetfalsch in der Luftröhre. Bisherwurde bei diesen Neugeborenender Brustkorb aufgeschnitten,die Verbindung zur Luftröhredurchtrennt und beide Endenzusammengenäht. Minimal in-vasiv ist das nicht nötig. DerEingriff wird mit zwei 2-mm-Instrumenten durchgeführt. Zwardauert es etwas länger, dafür
muss sich das Kind nicht vomTrauma des aufgeschnittenenBrustkorbes erholen. Von demEingriff wird später übrigensnichts mehr zu sehen sein.
Bei der Ureter-Abgangsste-nose ist der Abfluss des Urinsaus dem Nierenbecken auf-grund einer Engstelle behindert(Abb. 6). Der Operateur entferntdie Engstelle und näht denHarnleiter und das Nierenbe-cken wieder zusammen. Bei deroffenen Operation entsteht einFlankenschnitt. Bei der minimalinvasiven Technik ist auch nachdiesem Eingriff später praktischnichts mehr zu sehen. Legt mankeine Schienung ein (eine nachwie vor umstrittene Maßnah-me), können die Kinder amnächsten Tag nach Hause ge-
hen. Bei der offenen Operationwäre das undenkbar.
Bei einer Choledochus-Zysteist der Gallengang massiv auf-geweitet. Das Kind wird gelb,weil die Galle nicht in denDarm abfließt. In einer rechtaufwändigen Operation wirdder zystische Gallengang ent-fernt und eine zuvor durch-trennte Darmschlinge direkt andie Leber angenäht.
Der Unterschied zwischen derherkömmlichen, im tatsäch-lichen Wortsinne „offenen“Operation und der minimalinvasiven Technik ist hierdrastisch. Entsprechend un-terschiedlich ist der Erho-lungsbedarf der kleinen Pa-tienten: minimal invasiv ope-rierte Kinder können nach 2Tagen nach Hause gehen. Zudieser Zeit befindet sich dasoffen operierte Kind unterUmständen noch auf derIntensivstation.
Um so dringlicher ist es, dieVerbreitung neuer Methodenund innovativer Techniken zufördern und minimal invasiveVerfahren in der Kinderchirurgie weiter zu etablieren. �
32 nahdran 03/05
Speiseröhrenfehlbildung (Ösophagus-
atresie). Die beiden Speiseröhren-
Enden sind vernäht.
Abfluss der Niere behindert durch
aberrierende Blutgefäße.
Prof. Dr. med. Felix Schier ist seit 2005 stellvertretender ÄrztlicherDirektor der Universitäts-Kliniken Mainz. Der gebürtige Tuttlingergehörte zu den ersten Kinderchirurgen weltweit, die minimal invasi-ve Eingriffe erfolgreich beim Kind vornahmen und erhielt zahlreichePreise für seine Arbeit. Er hat unzählige Fachartikel und Vorträgepubliziert, organisiert Kongresse und führt in der ganzen Welt Lapa-roskopie-Kurse durch. Als Mitglied u.a. der Deutschen Gesellschaftfür Chirurgie sowie der Schweizerischen, der Österreichischen undder Britischen Gesellschaft für Kinderchirurgie wurde er 1999 in denVorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie gewählt.International am bekanntesten geworden ist sein mittlerweile zumStandardwerk avanciertes Buch „Laparoscopy in children“ (FelixSchier, Springer-Verlag 2003, ISBN 3-540-42975-1).
Kontakt:Prof. Dr. med. Felix SchierKlinikum der Johannes Gutenberg-Universität MainzKinderchirurgieLangenbeckstraße 155101 Mainz
E-Mail: [email protected]: www.kinder.klinik.uni-mainz.de
5 6

nahdran 03/05 33
Lappenplastiken in der rekonstruktivenHNO-TumorchirurgieChallenger Ti® im Einsatz: reduzierte Komplikationsrate und verkürzte OP-Dauer
Ein Beitrag von Dr. med. Emil Zenev, Klinikum Augsburg
Nach der Resektion großer Tumoren im Bereich derMundhöhle oder des Pharynx können Defekte entste-hen, die eine Rekonstruktion der betroffenen Arealenotwendig machen. In der rekonstruktiven HNO-Tu-morchirurgie ist dabei die Verwendung freier Haut-transplantate eine bewährte Methode zur Defekt-deckung im Kopf-Hals-Bereich. Die Weichteilrekon-struktion wird an der HNO-Klinik des ZentralklinikumsAugsburg bevorzugt mit dem Radialislappen (Unter-armlappen) durchgeführt.
Die HNO-Spezialisten verwenden bei der Transplanta-tion des Radialislappens den Clip-Applikator ChallengerTi®. Das resterilisierbare Kombinationsprodukt der BBDAesculap GmbH kommt sowohl bei der Unterbindungder A. radialis als auch ihrer venösen Begleitvenen zumEinsatz. Durch das spezielle Handling und die in-novative Technik des Challenger Ti®-Systems wird nichtnur die OP-Dauer signifikant verkürzt, sondern auch diepostoperative Komplikationsrate gesenkt. �

34 nahdran 03/05
Tumorresektion und Transplantat-Planung
Eine komplikationsarme Wundheilung istnach der Resektion großer Tumoren oft-mals nicht möglich. Besonders gefürchtetist die Ausbildung einer sogenannten Spei-chelfistel, deren Versorgung in der Regeleinige Operationen sowie eine Verlän-gerung des Krankenhausaufenthaltes ummindestens drei Wochen nach sich zieht.
Um dies zu vermeiden, wird die Defekt-deckung mit dem Radialislappen durchge-führt. Sowohl für die Rekonstruktion amäußeren Hals als auch in der Mundhöhle istdieses fasziokutane Transplantat aufgrundseiner Modellierbarkeit gut geeignet.
Je nach Lage des Tumors im Bereich derMundhöhle oder des Pharynx erfolgt übereine temporäre Unterkieferspaltung derZugang zum Tumor und seine Resektion.Im Anschluss daran wird die Transplantat-planung durchgeführt.
So lässt sich erstmals die genaue Größe des benötigten Gewebetransplantatesermessen. Anschließend entfernt ein zwei-tes Operationsteam die Halslymphknoten-metastasen und das cervikale Fettgewebein Form einer Neck-Dissection.
Hierbei werden auch die arteriellen undvenösen Gefäße im Halsbereich für diespätere mikrovaskuläre Anastomosierungdes Transplantates dargestellt.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass es nachder Transplantation zu einer Gewebe-schrumpfung um bis zu 25% kommenkann. Die benötigte Transplantatgrößewird an der volaren Seite der nicht domi-nanten Hand markiert und mobilisiert.
Arteria Radialis: Ideale Gefäßstruktur
Von der volaren Unterarmseite der nichtschreibenden Hand kann, je nach Bedarf,ein Hautareal mitsamt der darunter liegen-den Unterarmfaszie mobilisiert werden.Zur Versorgung mit Blut hat sich, wegenihres konstanten Verlaufs, die A. radialisdurchgesetzt. Da sich bis auf die A. recur-rens radialis im gesamten Unterarmbereichkein nennenswerter Gefäßabgang von derA. radialis befindet, ist dieses Gefäß für denfreien Unterarmlappen nahezu ideal geeig-net. Als venöses Drainagesystem hat sichdie Verwendung der V. cephalica oder derVv. comitantes durchgesetzt.
Allen-Test im Vorfeld
Mit Hilfe z. B. des Allen-Tests muss vorEntnahme der A. radialis geprüft werden,ob die verbleibende A. ulnaris ausreicht,die gesamte Hand mit Blut zu versorgen.Hierbei öffnet und schließt der Patientzehnmal hintereinander die Hand. Beimletzten Mal hält er die Hand geschlossenund der Untersucher komprimiert die A. radialis. Füllt sich die Handfläche über die unverschlossene A. ulnaris, so ist derUnterarmlappen zur Entnahme geeignet.
Nach der Transplantation kann es zu einer Gewebeschrumpfung um bis zu 25% kommen.
Darstellung der V. cephalica nach Präparation des Unterarmlappens
Atraumatisches Clipping der V. cephalica mittelsChallenger Ti®
Lagerung des linken Armes vor der Transplantat-präparation mit proximal angelegter Blutsperre

nahdran 03/05 35
Die Lappenpräparation
Die Präparation erfolgt in Blutleere. NachS-förmiger Hautinzision wird die Unter-armfaszie durchtrennt. Es stellen sich dieBäuche des M. carpi radialis und des M. brachioradialis dar und müssen aus-einandergedrängt werden. Anschließendstellt sich die A. radialis mit ihren Begleit-venen dar, die sich zwischen den Muskel-bäuchen des M. flexor digitorum super-ficialis befinden.
Erst nach Hebung des Unterarmlappenserfolgt die weitere Präparation des gesam-ten Gefäßstiels nach proximal, indem dasGefäßbündel von seiner bindegewebigenUnterlage befreit wird. Sobald die Empfän-gerstelle vollständig für die Lappeneinnahtpräpariert ist, erfolgt die Absetzung desTransplantates vom Unterarm und diemikrovaskuläre Anastomosierung an denHalsgefäßen. Die Defektdeckung am Un-terarm wird mittels Oberschenkelspalthautdurchgeführt.
Challenger Ti® im Einsatz
Auch bei schwierig zu erreichenden Stellenerlaubt der Challenger Ti® aufgrund derSchaftlänge sowie der Drehbarkeit um360° Grad und den schlanken Clipbrancheneine sichere Clipapplikation.
Entsprechend kommt es während des post-operativen Verlaufs weder zu Nachblutun-gen noch zu Entzündungen im Entnahme-bereich. Ein weiterer Vorteil des Systemsliegt in der deutlichen Zeitersparnis bei derGefäßligatur: Aufgrund der halbautomati-schen Nachladefunktion können mehrereSeitenäste nacheinander beidseitig geclipptwerden, ohne das Instrument zeitaufwändignachladen zu müssen.
In Augsburg wird der Challenger Ti® darü-ber hinaus mit sehr gutem Erfolg auch beider Unterbindung von venösen Halsge-fäßen, wie z.B. der V. jugularis externa, sowie bei Tumorresektionen und bei Neck-Dissections eingesetzt. �
Kontakt:Dr. Emil ZenevKlinikum AugsburgHNO-AbteilungStenglinstr. 286156 Augsburg
E-Mail: [email protected]
Produkt in fo Cha l l enge r T i ®
Das resterilisierbare Challenger Ti®-System ist eine Kombination auswieder verwendbarem Multifire-Clip-applikator und Einmal-Titanclip-Magazin. Er besteht aus modularen Bausteinen und ist in verschiedenenGrößen erhältlich:
� 5 mm kur z (PL 600R)
Ø 5 mm, 205 mm LängeMagazine: SM (Small Medium)
� 5 mm (PL 512R)
Ø 5 mm, 310 mm LängeMagazine: SM (Small Medium)
� Mit te l (PL 508R)
Ø 10 mm, 260 mm LängeMagazine: LM (Large Medium)
� Lang (PL 506R)
Ø 10 mm, 370 mm LängeMagazine: LM (Large Medium)
Für weitere Informationen stehen Ih-nen die BBD Aesculap-Außendienst-mitarbeiter gerne zur Verfügung.
Clipping der Kollateralgefäße der A. radialis Proximale Absetzung der A. radialis nach vollständiger Lappenpräparation

36 nahdran 03/05
Aller Hochleistungs-Technologie zum Trotz: auch diemoderne Medizin muss vor vielen Erkrankungen bisheute kapitulieren. Vor allem beim Auftreten malignerTumoren ist eine kurative Therapie oft nicht (mehr)möglich. Aber in welchem Umfang sind lebensverlän-gernde Eingriffe sinnvoll und zumutbar für den betrof-fenen Patienten? Eines scheint festzustehen: Lebens-verlängerung ohne Verbesserung der Lebensqualitätmacht keinen Sinn. Die Palliativchirurgie setzt genau andiesem Punkt an: sie ermöglicht Linderung vonBeschwerden bei unheilbar kranken Patienten. Expertengehen davon aus, dass die Umsetzung palliativ-chirur-gischer Eingriffe in Zukunft weiter an Bedeutunggewinnen wird, da mit steigendem Prozentsatz ältereund hochbetagte Patienten betroffen sind.
Aber die ökonomische Krise des Gesundheitssystemserfordert heute mehr denn je ein Nachdenken überden sinnvollen Einsatz der zur Verfügung stehendenMittel. Eine Frage beschäftigt vor diesem Hintergrundnicht nur Theoretiker, sondern auch Ärzte und Pfle-gende in der Praxis: Wie können wir Ressourcen wirt-schaftlicher einsetzen – ohne dabei ethische Grund-sätze aufzugeben? Wir haben mit dem österreichischen GefäßchirurgenProf. Dr. Peter Polterauer über Möglichkeiten undGrenzen der Palliativchirurgie gesprochen.
Prof. Polterauer, welchen Stel-lenwert hat die palliative Chi-rurgie in Zeiten von „ManagedCare“ und Kostendruck?
Die palliative Chirurgie hatauch in Zeiten multimodalerTherapiekonzepte und Algo-rhythmen einen hohen Stel-lenwert in Bezug auf Ethik,Sinnhaftigkeit des Machbarenund Verbesserung der Lebens-qualität. Natürlich stellt sichauch hier die Frage nach denKosten – wie ja in allen Be-reichen der Medizin eine Ab-wägung unter ökonomischenGesichtspunkten immer ent-scheidender wird. Darauf wür-de ich gerne im Anschluss nochgenauer eingehen. Aber zu-nächst einmal bedeutet Pallia-tivchirurgie – wenn sie über-legt eingesetzt wird – eine er-höhte Lebensqualität für un-heilbar kranke Patienten …
Und eine Entlastung auch fürdie Angehörigen?
Selbstverständlich. Zum Bei-spiel schwere Atemnot über ei-nen langen Zeitraum oder beieinigen TumorerkrankungenArrosionsblutungen aus derHalsschlagader, die letztlichzum Verblutungstod des Pa-tienten führen können, sind ei-ne entsetzliche Belastung füralle Beteiligten. Hier kanndurch einen palliativen Eingriffdas Leiden doch in beträchtli-chem Maße gelindert werden.
Palliativchirurgie: Wie viel Würde wollen wir unsEin Interview mit Univ.-Prof. Dr. Peter Polterauer, Gefäßchirurgie, Medizinische Universität Wien
Palliativchirurgie: Linderung, wenn Heilung nicht mehr möglich ist
Palliative Eingriffe sind Operationen, die zur Verrin-gerung von Beschwerden und zur Verbesserung derLebensqualität durchgeführt werden. Dabei werdenweder die Ursachen der Erkrankung beseitigt, nochkommt es zwingend zu einer Lebensverlängerung.Denn bei palliativen Erkrankungen besteht keineMöglichkeit mehr auf Heilung. Eben weil die ursäch-lich gegen die eigentliche Krankheit gerichtete The-rapie nicht fortgeführt werden kann, steht hier derAspekt der Linderung (Palliation) im Vordergrund.

nahdran 03/05 37
Zunehmend geraten Chirur-gen in Bedrängnis, das chi-rurgisch aber auch ökono-misch Machbare gegenüberdem für den Patienten Nütz-lichen abzuwägen. Und imZusammenhang mit palliati-ver Chirurgie wird gerne derösterreichische Chirurg KarlChiari zitiert: „Man soll nurdas operieren, was man ope-rieren muss und nicht das,was man operieren könnte.“Nach welchen Kriterien ent-scheiden Sie für oder gegeneinen palliativen Eingriff?Können Sie hierzu ein Bei-spiel nennen?
Nehmen wir als Beispiel denPatienten mit einem hochmalignen Halstumor, der aufdie Halsschlagader übergreift.Aufgrund der Mikroskopie undDiagnose hat eine Krebsope-ration keine lebensverlängern-de Wirkung, vor allem wennbereits Metastasen gebildetwurden. Hier kann mit einerResektion des großen Halstu-mors mit gefäßchirurgischemErsatz der Halsschlagader dieLebensqualität verbessert unddie Wahrscheinlichkeit vonSchmerzen, Blutungen und Lei-den verringert werden. Ich ent-scheide grundsätzlich immerdann für einen palliativen Ein-griff, wenn damit eine Verbes-serung der Lebensqualität er-reicht werden kann – unab-hängig von der Prognose des Patienten. Würde der �
leisten?

38 nahdran 03/05
Eingriff lediglich eine Verlän-gerung des Leidens bedeuten,sollte man auf eine Operationverzichten.
Und wie stehen Sie zu öko-nomischen Fragestellungen?Können wir uns die Palliativ-chirurgie in Zukunft über-haupt noch leisten? Geradebei hochbetagten Patientenwird immer wieder einmalhinter mehr oder wenigervorgehaltener Hand über dieRationierung medizinischerLeistungen diskutiert …
Es stimmt, dass immer mehrMenschen immer älter werdenund sich die Kostenfrage weiterzuspitzt. Und es ist auch richtig,dass ein Großteil der Gesund-heitsressourcen für die letztenMonate in der Behandlungschwer kranker Menschen auf-gewendet wird. Aber nicht allesin der Medizin – und schon garnicht die Palliativchirurgie –kann ausschließlich mit ökono-mischen, monetarischen Me-thoden im Sinne einer Lebens-Ablebens-Versicherung beur-teilt werden. Innerhalb einessolchen Systems würde dergünstigste Zeitpunkt zum Able-ben direkt nach dem Ausschei-den aus dem Arbeitsprozesserrechnet. Das hieße u.a., chro-nisch kranke und ältere Patien-ten von der Behandlung auszu-schließen. Das kann ernsthaftniemand wollen, denn es wäreaus ethischer Perspektive in
keiner Weise vertretbar. Ummoralisch würdig bleiben zukönnen, müssen wir uns diePalliativchirurgie leisten – auchals regulierendes Element ge-genüber einer kurativen Radi-kalchirurgie. Es ist also ent-scheidend, dass im individuel-len Fall von Krankheit und Lei-den alles getan wird, um zu hei-len oder Beschwerden zu lindern– ohne ökonomische Grenzen.Das bedeutet aber, dass mit kol-lektiven Strategien prospektivgeplant werden muss, um einGesundheitssystem auch in Zu-kunft zu erhalten.
Das heißt also „Rationalisie-rung statt Rationierung“ …
So ist es. Nichts spricht dage-gen, Effektivität und Effizienz zuberechnen und Kosten-Nutzen-Analysen durchzuführen. Im Ge-genteil: es müssen auch vorder-gründig gleichwertige Metho-den zur Förderung von Gesund-heit und Lebensqualität mitei-nander verglichen werden, umdas bessere Vorgehen zu ermit-teln. Effizienter und damit kos-tengünstiger sind solche Me-thoden, die Ressourcen für wei-tere Patienten freisetzen und ei-ne Brücke von der Ökonomie zurEthik schlagen.
Können Sie das etwas genau-er erläutern?
Ethisch vertretbar ist es, ge-nau die Methoden zur Lebens-
verlängerung und Verbesse-rung der Gesundheit einzuset-zen, die sich z.B. bei gleicherEffizienz aber noch bessererEffektivität als kostengünsti-ger erweisen. Denn nur solässt sich Kapital für zukünf-tige Strategien freisetzen. Esbringt überhaupt nichts, dieGesundheitsbudgets auf 20-25 % des Bruttoinlandprodukts(BIP) anzuheben. Das ist eineimmer wieder einmal hervor-gebrachte, völlig unreflek-tierte Forderung, die kontra-produktiv ist, weil so dieLebensqualität einer Gesell-schaft insgesamt reduziertwürde. Mehr als 10 % des BIPsind in freien westlichen De-mokratiesystemen für das Ge-sundheitsbudget weder finan-zierbar noch politisch durch-setzbar. Es kann also nur da-rum gehen, individuelle Le-benserhaltung und Lebensqua-lität mit allen gegebenen Mit-teln zu fördern – bei gleich-zeitiger prospektiver Entwick-lung von kollektiven medizini-schen Strategien.
Kosten bzw. Konsequenzenvon medizinischen Behand-lungsformen können auf ver-schiedene Weise gemessenwerden. In der Regel geht esaber dabei um quantitativeAspekte und nicht um quali-tative Werte wie z.B. Lebens-qualität. Gibt es trotzdemMöglichkeiten einer objekti-vierten Betrachtungsweise?
Mehr oder weniger schon. Alshilfreich in diesem Zusammen-hang haben sich Berechnungs-arten wir bspw. QUALY erwie-sen. QUALYs (Quality AdjustedLife Years) sind ein Instrumentder ökonomischen Evaluation,um die Kosten von Prozedurenund Technologien im Gesund-heitswesen mit ihren Ergebnis-sen zu vergleichen. Ein QUALYentspricht einem Jahr, das invollständiger Gesundheit ver-bracht wird. Über QUALYs kanndie Wirksamkeit einer therapeu-tischen Intervention gemessenwerden. In die Wirksamkeitsbe-messung fließen – im Gegensatzzu klassischen Kostenanalysen –neben den quantitativen Aspek-ten (Verlängerung des Lebens)auch qualitative Aspekte (Ver-besserung der Lebensqualität)ein. Die Verlängerung des Le-bens durch eine Behandlungwird anhand von medizinischenStudien objektiv ermittelt, dieLebensqualität wird von den be-handelten Patienten subjektivbeurteilt. QUALYs erlauben zu-dem einen Vergleich verschie-dener Interventionen. In sog.QUALY-Tabellen werden dieseim Hinblick auf die Kosten progewonnenem QUALY verglei-chend zusammengestellt. Damitkönnte der Nutzen verschiede-ner medizinischer Interventio-nen direkt gegeneinander abge-wogen werden.
Herr Prof. Polterauer, wir dan-ken Ihnen für das Gespräch! �
Univ.-Prof. Peter Polterauer leitet seit 1993 als Ordi-narius die klinische Abteilung für Gefäßchirurgie ander Medizinischen Universität Wien. Der Gefäßchirurgist u.a. Direktor des Ludwig Boltzmann-Instituts fürinterdisziplinäre klinische Gefäßmedizinforschung undwar 1999/2000 Präsident der Österreichischen Gesell-schaft für Gefäßchirurgie. Seine klinischen Schwer-punkte liegen insbesondere in der Aortenaneurysma-Therapie, der Carotis-Halsschlagader-Chirurgie und inder Varizenchirurgie.
Kontakt:Univ.-Prof. Dr. Peter PolterauerOrdinarius für GefäßchirurgieMedizinische Universität WienWähringer Gürtel 18-20A-1090 Wien
E-Mail: [email protected]
„Effizient sind Methoden, die eine Brücke von der Ökonomie zur Ethik schlagen“

20.-21.01.2006 Ulm17. Ulmer Kurs für Mikrochirurgiewww.uni-ulm.de
20.-21.01.2006 Mönchengladbach10. Neuwerker Nahtkurs Infos:[email protected]
03.-04.02.2006 BielefeldCAQ 2006 - 14. Jahrestagung:Qualität durch gute Weiter-bildung und evidenz-basiertesHandelnwww.caq.uni-bonn.de
09.-11.02.2006 HannoverCAMIC 2006 - 5. Dreiländer-treffen der Arbeitsgemein-schaften für MIC (D, A, CH)www.camic.de
19.-22.02.2006 Hamburg35. Jahrestagung der DeutschenGesellschaft für Thorax-, Herz-und Gefäßchirurgiewww.dgthg.de
gemeinsam mit der BBD-Veranstaltung
21.-22.02.2006 Hamburg24. Fortbildung fürOP-Schwestern und OP-PflegerInfos:[email protected]
24.-25.02.2006 Bielefeld13. Ostwestfälisches Gefäß-Symposiumwww.ggo-bielefeld.de
03.-05.03.2006 Nürnberg8. Bundeskongress der nieder-gelassenen Chirurgenwww.bncev.de
22.-26.03.2006 Berlin27. Deutscher Krebskongresswww.krebskongress2006.de
31.03.-01.04.2006 BottropErkrankungen die keiner will:ExtremitätenverlustInfos: [email protected]
29.04.2006 Potsdam7. Symposium: Ports, Pumpen und Katheterwww.operieren.de
02.-05.05.2006 ICC Berlin123. Jahreskongress der Deut-schen Gesellschaft für Chirurgiewww.chirurgie2006.de
termine AUSSTELLUNGEN KONGRESSE TAGUNGEN WORKSHOPS FORTBILDUNGEN SEHEN WIR UNS ?
nahdran 03/05 39
Wie lässt sich der Nutzen einer Therapie messen?Die Kosten-Nützlichkeits-Analyse
Bei dieser Analyseform wird der Nutzen einer Therapie im Ge-gensatz zu anderen Berechnungsarten nicht allein in gewonne-nen Lebensjahren, sondern als „Nützlichkeit“ (utility) definiert.Es ist in der Regel nicht gleichgültig, ob ein Patient, bei dem miteiner speziellen Therapie das Leben um eine bestimmte Zeit-spanne verlängert wird, in der gewonnenen Zeit beschwerdefreiist oder ob er das zusätzliche Jahr mit ständigen Schmerzenbettlägerig in einem Pflegeheim verbringt. Zur Quantifizierungder Nützlichkeit, die sich zusammensetzt aus der Lebensver-längerung und der Lebensqualität, wurde der Begriff QUALY ge-prägt. Der Nutzen einer Intervention wird also nicht nur in Zeit-einheiten angegeben, sondern in Relation zur Lebensqualitätgesetzt. Die Lebensqualität (LQ) wird dabei numerisch mit Wer-ten zwischen 1 (vollkommen gesund) und 0 (tot) angegeben.
Beispiel:Mit der Therapie A kostet ein gewonnenes Lebensjahr 45.000 Euro,mit Therapie B 58.000 Euro. Die Lebensqualität in dem gewonne-nen Lebensjahr wird mit der Therapie A auf 0,4 und mit Therapie Bwesentlich höher, nämlich auf 0,7 geschätzt. Es ist verständlich,dass ein gewonnenes Lebensjahr mit der Qualität 0,7 als „nützli-cher“ beurteilt wird als eines mit der Qualitätsstufe 0,4. Das ge-wonnene Lebensjahr unter Therapie B ist zwar teurer als mit The-rapie A, aufgrund der höheren Lebensqualität dem Patienten abermehr wert. Zum Vergleich werden die Kosten pro gewonnenes Le-bensjahr mit dem Faktor der Lebensqualität korrigiert:
Therapie A:45.000 Euro pro gewonnenes Lebensjahr LQ 0,4Kosten pro QUALY = 45.000 Euro u1/0,4 = 125.000 Euro
Therapie B:58.000.Euro pro gewonnenes Lebensjahr LQ 0,7Kosten pro QUALY = 58.000 Euro u1/0,7 = 82.360 Euro
Ergebnis: Obwohl die Therapie A billiger ist als B, sind die qualitätskorri-gierten Werte für die Therapie B günstiger.

I h r e Me inung i s t uns w i ch t ig !
Schreiben Sie uns, wenn Sie zu einem Thema Stellungnehmen möchten. Wir veröffentlichen Ihren Leserbrief inder kommenden Ausgabe – auf Wunsch auch anonym.
Aus de r P rax i s fü r d i e P rax i s !An spannenden Beiträgen aus OP, Chirurgie und Krankenhausmanagement sind wir immer interessiert! Die Themen können Sie per E-Mail und Fax an die Redaktion senden oder telefonisch mit uns abstimmen.
Anja JasperRedaktion nahdranTelefon: 00 49 (0)5 61-9 58 98-11Telefax: 00 49 (0)5 61-9 58 98-58E-Mail: [email protected]
Kos ten lo se s Abo und Adre s sände rung
� Bitte nehmen Sie mich in Ihren Ver-teiler auf.
� Bitte senden Sie mir kostenfrei folgen-de erhältliche Ausgaben der nahdranan u.g. Adresse:� 12. Ausgabe 02/05
� 13. Ausgabe 03/05
Falls unsere Adressdaten nicht mehr aktuellsein sollten, teilen Sie uns dies bitte mit – wiraktualisieren unseren Verteiler umgehend.
Name/Funktion
Klinik/Abteilung
Straße
PLZ/Ort
Telefon/Telefax
Datum: Unterschrift:
Telefax: (08 00) 222 37 82Kostenfreie Fax-Rufnummer nur innerhalb der BRD möglich.
Bei Sendungen aus dem Ausland wählen Sie bitte die Fax-Nr.
0049 - 74 61 - 91 15 - 692
BBD Aesculap GmbH
Redaktion nahdranPostfach 31
D-78501 Tuttlingen
Bes te l l ung DVD Fokus Naht
Gebündeltes Expertenwissen rund um das Thema „Nahtmaterial“: umfassend – praxisnah – qualifiziert
� Bitte senden Sie mir DVD Fokus Naht zum Preis von 19,— Euro (zzgl.Versandkosten) an u.g. Adresse.
B i t t e k reuzen S i e an , ob e s s i ch um Ih re K l in i kansch r i f t � ode r I h re P r i va tansch r i f t � hande l t .
l e s e r f o r u m
A b s e n d e r
12. und 13. Ausgabe